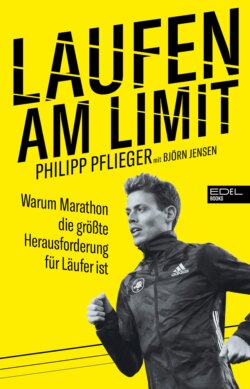Читать книгу Laufen am Limit - Björn Jensen - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KILOMETER 8 LEISTUNGSDRUCK
ОглавлениеWer eine Studie über die Bedeutung der psychischen Stabilität für die Leistungsstärke im Sport erstellen möchte, sollte mal vor einem Langstreckenrennen den Callroom aufsuchen. Das ist der Bereich, in dem die Eliteathleten auf den Start warten. Manche behaupten, dort würde mehr Theater gespielt als in der Wiener Burg oder im Moskauer Bolschoi. Ich glaube, dass man an diesem Ort wunderbar beobachten kann, wie sich Leistungsdruck auf Menschen auswirkt.
Natürlich gibt es immer Sportler, die durch übertriebene Mätzchen versuchen, ihre Unsicherheit zu überspielen. Oder es gibt jene, die mit Psychospielchen versuchen, in die Köpfe ihrer Gegner zu kriechen. Psychologische Kriegsführung wird das manchmal genannt, kein schöner Begriff, denn Krieg und Sport sollten nicht in einen Zusammenhang gestellt werden. Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass die meisten Athleten im Callroom – kurz bevor es um alles geht – ihren wahren Charakter offenbaren.
Im Callroom findet man sich rund 20 Minuten vor dem Start ein, was wichtig ist, damit der Zeitplan eingehalten werden kann. Die Ausrüstung und die Spikes, sofern man auf der Bahn läuft, werden überprüft, man fühlt sich ein wenig eingepfercht, wie Rennpferde, die hinter dem Startauto mit den Hufen scharren. In diesem Moment kam und kommt es für mich immer darauf an, mich auf mein Rennen zu fokussieren. Ich bin heute nicht mehr so verbissen wie noch mit 18, 19, 20 Jahren. Damals habe ich krampfhaft versucht, alles um mich herum auszublenden. Heute nehme ich durchaus wahr, was um mich herum passiert, grüße andere Sportler oder Bekannte in meinem Blickfeld. Ich bin sogar in der Lage, für Fotos mit Fans kurz vor dem Start zu lächeln. Das wäre vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen.
Die Frage, wie Leistungsdruck entsteht, habe ich mir erst in der Entstehungsphase dieses Buches ernsthaft gestellt. Es gibt wohl zwei Arten von Druck: den inneren, den man sich selbst auferlegt, und den äußeren, der im Umfeld oder durch äußere Einflüsse entsteht. Ich kann für meine persönliche Karriere sagen, dass ich Druck von außen eigentlich so gut wie nie gespürt oder auferlegt bekommen habe. Meine Eltern haben mich in meiner sportlichen Ambition unterstützt, aber niemals mehr Leistung eingefordert. Auch meine Trainer gehören und gehörten nicht zu denen, die ständig unzufrieden sind und Druck auf ihre Athleten projizieren.
Geschichten solcher Abhängigkeitsverhältnisse, in denen Athleten unter der harten Hand ihrer Trainer zwar Höchstleistung abrufen, aber darunter über kurz oder lang zerbrechen, gibt es reichlich. Meine Trainer sind wirklich verständige, menschliche Übungsleiter, die mich auf Augenhöhe coachen. Wir haben uns ein gemeinsames Ziel gesteckt, hinter dem beide Seiten stehen. Und das versuchen wir dann zusammen zu erreichen.
Druck von außen kann natürlich, aber nicht nur durch das persönliche Umfeld, also Familie, Partnerin oder Trainingsgruppe, erzeugt werden. Auch die Medien, heute insbesondere die sozialen Netzwerke, spielen eine Rolle. Das Internet hat in den vergangenen Jahren Tür und Tor geöffnet für Menschen, die unreflektiert und unter dem Deckmantel der Anonymität eine unsachliche, polemische und leider oft auch verletzende Kritik raushauen. Die verselbstständigt sich mitunter sehr schnell und ist schwer wieder einzufangen.
Wer empfänglich dafür ist, sich von so etwas beeindrucken lässt, ist vielleicht gut beraten, weitgehend auf Social Media zu verzichten, weil diese einem sonst zu viel Energie rauben. Ich habe schnell gelernt, mir nur Kritik der Menschen zu Herzen zu nehmen, die mich und die Umstände meiner Leistungen kennen. Ein Shitstorm im Netz lässt mich dann relativ unbeeindruckt.
Apropos Sturm: Natürlich zählt auch das Wetter zu den äußeren Einflüssen, die Druck erzeugen können. Bei extremen Distanzen wie bei einem Marathon kann das Wetter das Erreichen einer gesteckten Bestzeit unmöglich machen, auch wenn man in der Vorbereitung alles getan hat und in der Form seines Lebens ist.
Für Einflüsse, die man selbst nicht in der Hand hat, gibt es wieder zwei Herangehensweisen. Man nimmt alles schicksalsergeben hin und versucht, sich über diese Dinge keinen Kopf zu machen. Oder man stellt sich in der Vorbereitung auf jede Eventualität ein und legt einen Plan für den Fall bereit, dass eine oder mehrere davon eintreffen. Ich habe mich über die Jahre auf die zweite Variante eingestellt. Mir gibt es ein gutes Gefühl zu wissen, dass ich im Fall des Falles nicht intuitiv falsch, sondern situativ richtig entscheide. Also gehe ich in den Tagen vor einem Rennen durch, was alles passieren könnte und wie ich darauf reagieren kann.
Wenn am Tag des Marathons, bei dem ich mir eine neue Bestzeit zum Ziel gesetzt habe, Regen und Sturm toben, bin ich halt machtlos. Es gibt Läufer, denen Hitze nichts ausmacht, Mittelstreckler über 800 und 1500 Meter. Aber als Langstreckenläufer ist mir trockenes, sonniges, kühles Wetter am liebsten. Stürmischer Regen geht gar nicht, denn er bremst, der Untergrund wird rutschig, die Muskeln kühlen aus. Und wenn ein solches Wetter auf den Tag fällt, den du dir als deinen Tag ausgeguckt hattest, dann ist das einfach Pech. Abhaken, Ruhe bewahren und zufrieden sein mit dem, was an Leistungs-Output möglich ist.
Es hat Jahre gebraucht, bis es mir gelungen ist, diese Einstellung in meinem Bewusstsein zu verankern. Aber irgendwann, den Zeitpunkt kann ich nicht festlegen, habe ich begriffen, dass ich nicht mehr tun kann, als in einem Rennen alles zu geben, was in mir steckt. Manchmal reicht es für die neue Bestzeit, manchmal nicht.
Als Läufer musst du bereit sein, den Schmerz zu umarmen, sonst geht es nicht. Das ist besonders im Marathon unumgänglich, denn da schreit dir dein gepeinigter Körper über die letzten zehn oder 15 Kilometer zu: „Hör auf, hör endlich auf!“ Da hast du sehr viel Zeit, darüber nachzudenken, was du da größtenteils freiwillig treibst. Wenn du dann nicht weitermachst, solange es geht, betrügst du deinen Körper und dich selbst. Deshalb sage ich: Wenn ich weiß, dass ich alles gegeben habe, was möglich war, muss ich auch zufrieden sein.
Warum ich gerade „größtenteils freiwillig“ geschrieben habe? Na ja, es gibt einen letzten Aspekt im Bereich der äußeren Einflüsse, und das ist der wirtschaftliche Zwang. Es gab Zeiten, in denen ich als Student wenig Geld zum Leben hatte und von der Hand in den Mund lebte. Mit 500 Euro im Monat auszukommen war für mich die Regel, nicht die Ausnahme. Mein Anspruch war von jeher, mich nicht von meinen Eltern aushalten zu lassen, denn schließlich war der Sport ja meine eigene Spinnerei, ich hatte mich dazu entschieden, auf diese Karte zu setzen, also wollte ich es auch aus eigener Kraft schaffen.
Über in Rennen verdiente Siegprämien konnte ich mein Auskommen einigermaßen finanzieren, das bedeutete hier und da allerdings, dass ich eben teils dann starten musste, wenn ich eigentlich nicht wollte oder mich nicht ausreichend vorbereitet fühlte. Und nicht nur starten, sondern gewinnen. Das führte in jener Phase, zwischen 2012 und 2015, dazu, dass ich die Notwendigkeit des Laufens gelegentlich höher bewerten musste als den Spaß daran. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die Deutschen Zehn-Kilometer-Meisterschaften 2012 in Nagold. Der Sommer war hart gewesen, ich fühlte mich ausgebrannt. Aber ich brauchte die Siegprämie eines damaligen Sponsors, die ungefähr bei 2000 Euro lag. 500 Meter vorm Ziel war mein Hauptkonkurrent Musa Roba-Kinkal vom SC Gelnhausen weggezogen, aber ich brauchte das Geld und musste gewinnen. So gelang es mir, ihn in eine Sprintentscheidung zu zwingen und schließlich mit Ach und Krach zu siegen. Dieses Gefühl, dass auch äußerer Druck Kräfte freisetzen kann, war ein wichtiger Lerneffekt. Schön war es trotzdem nicht.
Dennoch halte ich es für wichtig festzuhalten, dass Leistungsdruck nicht per se etwas Negatives ist. Das Nebennierenhormon Adrenalin, das durch Stress freigesetzt wird und eine Erhöhung von Blutdruck, Herzfrequenz und Blutzuckerspiegel sowie eine Erweiterung der Bronchien verursacht, ist ein wichtiger Helfer im Wettkampf. Es macht uns kampfbereit, deshalb kommt es viel mehr darauf an, entstehenden Druck richtig zu kanalisieren.
Wenn ich gesagt habe, dass ich selten äußeren Druck wahrgenommen habe, muss ich nun zugeben, dass ich umso anfälliger für den inneren Leistungsdruck war. Das begann, als ich mit 13 erstmals für den Landeskader Württembergs nominiert wurde. Ich fühlte mich, weil es uns suggeriert wurde, einem auserwählten Kreis zugehörig und sollte mich auf einmal mit den Besten des Landes messen. Natürlich wollte ich beweisen, dass ich zu Recht dazugehörte. Allerdings begriff ich damals nicht, dass der Einzige, der einen solchen Beweis einforderte, ich selbst war.
Ich habe damals zum ersten Mal so etwas wie Versagensangst gespürt. Woher dieses Gefühl rührte, weiß ich nicht zu sagen, es war ja unbegründet. Was aber genauso wichtig war als Lerneffekt aus dieser Angst: Sie hat mich nicht davon abgehalten, mich wieder und immer wieder solchen Situationen auszusetzen, und ich könnte mir vorstellen, dass das ein ganz entscheidender Punkt dafür ist, warum manche es ganz nach oben schaffen, obwohl sie weniger körperliches Talent mitbringen als andere, die auf dem Weg nach oben einbrechen. Talent bezieht sich in meinen Augen eben nicht nur auf körperliche Fähigkeiten, sondern auch auf die mentale Stabilität, die es braucht, um Druck auszuhalten und auf den Punkt zu performen.
Ich möchte an dieser Stelle gern noch einmal an den Anfang dieses Buches springen, den Berlin-Marathon 2015. Dieser Tag war mein persönlicher Höhepunkt des Leistungsdrucks. Und es war zu 100 Prozent Druck, den ich mir selbst auferlegt hatte. Ich wollte meine Karriere beenden, wenn ich an dem Tag meine Zielzeit nicht erreichte. Aber ich glaube, dass mir diese ultimative Situation die Kraft verliehen hat, an ihr zu wachsen.
Im Vergleich dazu waren die Olympischen Spiele 2016 ein Klacks, obgleich die meisten vermutlich denken, dass beim sportlich größten Erlebnis des Lebens auch der Druck am höchsten sein müsste. Rio fühlte sich an wie der Abschluss eines bedeutenden Kapitels in meinem Leben, ich konnte dort den Spaß empfinden, der für mich beim Laufen stets im Vordergrund steht und ohne den ich niemals über so viele Jahre weitergemacht hätte. Natürlich steigt der Stresspegel, je größer dein Betätigungsfeld wird. Aber ich sage: Jede Erfahrung macht dich stabiler, und nach Berlin 2015 gab es keine Situation, in der ich auch nur annähernd einen solchen Druck verspürt habe.
Wie sich Leistungsdruck anfühlt, weiß jeder. Erinnert euch an die Abschlussprüfung in der Schule, an die Führerscheinprobe oder an das erste Date. Dieses Gefühl, dass die Eingeweide sich drehen, das Herz kurz vorm Zerspringen ist, die Schweißdrüsen auf Massenproduktion umstellen, ist nie angenehm. Bei manchen schlägt es auf den Magen, andere bekommen feuchte Hände, Langstreckenläufer gehen fünfmal vorm Rennen pinkeln, was allerdings zum Teil auch daran liegt, dass man ausschließen will, auf der Strecke zu müssen. Bei mir ist es meist so, dass ich mich etwas zittrig fühle und so, als sei ich etwas durch den Wind. Körperliche Schwächesymptome habe ich zum Glück weniger, dafür denke ich oft, einfach nicht zu starten, mich der Situation zu entziehen, anstatt sie auszuhalten. Mit zunehmender Routine ist diese Nervosität zwar in den Griff zu bekommen, vollständig verschwindet sie aber nicht, und das ist völlig normal. Fragt mal Live-Moderatoren nach Lampenfieber!
Obwohl mir bewusst ist, wie wichtig die Psyche für die generelle Leistungsfähigkeit ist und dass man sie genauso trainieren kann wie Muskeln, hatte ich bislang sehr wenig Berührungspunkte mit Mentaltrainern oder Sportpsychologen. Ich glaube, das liegt einerseits daran, dass der Bereich Sportpsychologie in Deutschland noch immer nicht so verbreitet ist wie beispielsweise in den USA, wo an jedem College entsprechendes Personal verfügbar ist. Andererseits war mir lange nicht bewusst, welche Angebote es in diesem Bereich gibt, und ich habe stattdessen immer für mich selbst einen Weg gefunden. Ich konnte noch nie etwas sofort perfekt. Alles, was ich kann, habe ich mir durch jahrelanges Wiederholen angeeignet. Und wenn mir irgendwann etwas leichtfällt, suche ich mir eine neue Herausforderung, weil meine Einstellung ist: Wenn dir etwas leichtfällt, wirst du darin nicht mehr besser.
Da ich ein visueller Mensch bin, hat mir immer geholfen, mit positiven Bildern zu arbeiten, die ich im Kopf entstehen lasse. Wenn ich also in der Marathon-Vorbereitung die langen Läufe vor mir habe, rufe ich mir Bilder von erfolgreichen Rennen ins Gedächtnis. Ich versuche, die Strecke zu visualisieren, auf der der Marathon stattfindet, sofern ich sie schon einmal gelaufen bin, und mich an schöne Szenen zu erinnern. Oder ich mache mir bewusst, wie oft ich ähnlich harte Einheiten oder Rennen schon durchgestanden habe. Zu wissen, was ich bereits geleistet habe, hilft mir auch im Trainingsprozess, das Motivationslevel nach oben zu treiben.
Ähnlich geht es mir, wenn ich vor Rennen den Zustand erreichen will, den Athleten gern als „Tunnel“ beschreiben. Ich visualisiere dann Dinge, die im Training gut funktioniert haben. Zum Ablenken und Aufputschen höre ich Musik, alles querbeet, ohne feste Playlist. Da uns Athleten im Wettkampf Musikhören nicht gestattet ist, trainiere ich allerdings ohne Knopf im Ohr.
Abstand genommen habe ich von Ritualen vor dem Rennen, die aus Aberglauben durchgeführt werden. Es ist besser, sich auf so viele Unwägbarkeiten wie möglich vorzubereiten, als sich an einem festen Ablauf festzuhalten und dann seine Fassung zu verlieren, wenn dieser aus irgendwelchen Gründen nicht eingehalten werden kann.
Das Einzige, was ich gern vor einem Rennen mache, wann immer es möglich ist: Rund eineinhalb Stunden vor dem Start (beim Marathon eher zwei Stunden) trinke ich als Kaffeejunkie, der ich bin, einen doppelten Espresso. Im Hotelzimmer wird dann noch penibel die Laufkleidung kontrolliert, denn je besser ich vorbereitet bin, desto weniger nervös bin ich, wenn es Richtung Callroom geht. Zu den anderen Nervenbündeln, von denen nur die wenigsten gute Schauspieler sind.