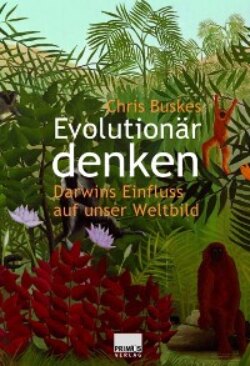Читать книгу Evolutionär denken - Chris Buskes - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Steinzeitlicher Geist
ОглавлениеDie Menschen kann man, wie gesagt, zu den tendenziell monogamen Säugetieren zählen. Da es zwischen den Männern (zumindest im zivilisierten „Normalfall“) nicht zum offenen physischen Kampf um das Vorrecht kommt, möglichst viele Frauen zu befruchten, ist der Sexualdimorphismus beim Menschen relativ schwach ausgeprägt. Männer sind durchschnittlich höchstens dreißig Prozent schwerer und knapp zehn Prozent größer als Frauen. Wie die Pfauenhähne buhlen sie auf subtilere Weise um die Gunst der Frauen, und daher spielt die zweite Form der sexuellen Selektion, die Damenwahl, eine wichtige Rolle. Die sexuelle Selektion wirkt sich im Verhalten und in den Vorlieben von Männern und Frauen aus. Man muss dabei bedenken, dass die Entwicklung des Menschen sich zu mehr als neunzig Prozent auf der afrikanischen Savanne abspielte, als unsere Vorfahren noch Jäger und Sammler waren. Während dieser langen Periode wurden bestimmte reproduktive Strategien von der Evolution belohnt, während andere allmählich verschwanden. Dieses evolutionäre Erbteil tragen wir noch heute mit uns.
Nach Ansicht der Evolutionsbiologen besitzen wir einen steinzeitlichen Geist. Es ist erst wenige Jahrtausende her, dass wir Städte bewohnen und in komplexen Gesellschaften leben, und diese Zeitspanne ist viel zu kurz, als dass sich Verhalten, Emotionen und sexuelle Vorlieben in evolutionärer Hinsicht tief greifend verändern könnten. Mit unserem Kopf stecken wir noch in der Prähistorie. Dass wir heute Verhütungsmittel haben und Sexualität nur um ihrer selbst willen erleben können, ändert daran nicht viel. Angeborenes Verhalten und angeborene Präferenzen lassen sich nicht einfach ablegen. Männer und Frauen haben sehr unterschiedliche reproduktive Strategien und damit zusammenhängende Vorlieben. Sie sind zum Teil genetisch bedingt und haben nach Ansicht der Evolutionspsychologen auch zu mentalen Unterschieden zwischen den Geschlechtern geführt.
Hinsichtlich der Partnerwahl gibt es stereotype, kulturübergreifende Vorlieben von Männern und Frauen. Männer präferieren junge, attraktive Frauen, während Frauen im Allgemeinen mehr Wert auf den sozialen Status und die Bereitschaft des Mannes legen, in die Beziehung zu investieren. Aus evolutionärer Sicht ist dies nicht schwer zu erklären. Von der Pubertät bis zur Menopause haben Frauen nur einen begrenzten Vorrat von drei- bis vierhundert Eizellen, während Männer bis ins hohe Alter aus dem Vollen schöpfen können. Eizellen sind zudem viel größer als Samenzellen, es erfordert mehr Energie, sie zu produzieren. Verglichen mit Spermien sind Eizellen also relativ selten und kostbar. Frauen können nur einmal im Jahr gebären, während Männer im Prinzip täglich mehrere Kinder zeugen können. Überdies wird bei Säugetieren wie dem Menschen der Embryo innerhalb des weiblichen Körpers getragen und sind die Neugeborenen noch geraume Zeit von der Muttermilch abhängig. Man kann somit von einer deutlichen Asymmetrie sprechen. Die Fortpflanzung ist für Frauen viel einschneidender als für Männer, sie investieren viel Zeit und Energie in ihre Nachkommen. Männer investieren wesentlich weniger, ihr Beitrag kann sich im Prinzip sogar auf den Koitus beschränken.
Aufgrund dieser physiologischen Unterschiede lassen sich einige Voraussagen machen: Frauen sind in ihren sexuelle Beziehungen selektiver und vorsichtiger als Männer, da die Konsequenzen für sie viel einschneidender sind. Nach Ansicht von Evolutionspsychologen und Soziobiologen ist diese Einstellung nicht kulturell bedingt, sondern angeboren. Generell gilt die Regel: Das Geschlecht, das am meisten investiert, ist auch am wählerischsten. Wenn wie bei den Seepferdchen und einigen Froscharten das Männchen die Brutpflege übernimmt, ist es auch wählerischer bei der Wahl seines Sexualpartners. Diese Erkenntnisse verdanken wir dem amerikanischen Soziobiologen Robert Trivers, der die Auswirkung der sexuellen Selektion auf die Partnerwahl und das „elterliche Investment“ mit mathematischer Genauigkeit darzulegen suchte.
Fortpflanzung ist in gewisser Hinsicht eine Transaktion, die sowohl für den Mann wie die Frau mit Gewinn und Verlust verbunden ist. Unter evolutionärem Aspekt besteht ein Konflikt zwischen den Geschlechtern bezüglich des Elternaufwands. Da sich beide mit möglichst geringen Kosten fortpflanzen wollen, befinden sie sich in einem Dilemma. Welche Strategie sollen sie anwenden? Die Antwort fällt für Männer und Frauen unterschiedlich aus. Bei Säugetieren wie dem Menschen investiert die Frau aus nahe liegenden Gründen immer mehr als der Mann. Die Kinder werden relativ früh geboren und sind extrem lange abhängig. Entwicklungsgeschichtlich ist dies unter anderem darauf zurückzuführen, dass das Hirnvolumen unserer Vorfahren explosiv zunahm, von 500 Kubikzentimetern bei den ersten Hominiden bis 1500 beim modernen Menschen. Da der Geburtskanal der Frau nicht entsprechend mitwachsen konnte, kamen Kinder immer früher zur Welt. Mit der Zunahme der Gehirngröße ging auch ein immer längerer Lernprozess einher. Für Frauen galt es daher, einen zuverlässigen Partner zu finden, der für sicheres Unterkommen und für ständige Nahrung sorgen konnte. Diese Präferenz führte zu einem Selektionsdruck auf Männer, die bereit waren, einen Teil des elterlichen Investments auf sich zu nehmen. Für sie zahlte es sich aus, denn sie hatten bessere Chancen sich fortzupflanzen als ihre flatterhafteren Geschlechtsgenossen. Im Unterschied zu anderen Primaten sehen wir beim Menschen denn auch einen großen Beitrag des Mannes bei der Aufzucht der Nachkommen.
Entgegen der landläufigen Meinung sind Männer also nicht genetisch programmiert, sich mit möglichst vielen Frauen zu paaren. Männer sind im Allgemeinen gute Väter, die viel für ihre Kinder übrighaben, was man von männlichen Schimpansen und Bonobos nicht behaupten kann. Beim Menschen ist die hohe Investition des Mannes das Resultat der sexuellen Selektion, der weiblichen Präferenz. Frauen sind nicht nur an seinem genetischen Beitrag interessiert, sondern auch an seiner zukünftigen Unterstützung beim Aufziehen der Kinder. Die hohe Investition des Mannes bringt es mit sich, dass sich die sexuelle Selektion in zwei Richtungen auswirkt: Männer konkurrieren untereinander um die seltenen weiblichen Eizellen, und Frauen untereinander um die seltenen Männer, die bereit sind, Ressourcen in die Kinder zu investieren. Beim Menschen besteht daher sowohl Wettbewerb zwischen Männern wie zwischen Frauen. Bestätigt werden diese Mutmaßungen über die Auswirkung der sexuellen Selektion, wie bereits erwähnt, durch empirische Untersuchungen. So scheinen Frauen in verschiedenen Kulturen im Allgemeinen mehr Wert auf den gesellschaftlichen Status ihres Partners und seine Bereitschaft zur Investition zu legen als auf seine Attraktivität oder Jugendlichkeit. Bei Männern verhält es sich genau umgekehrt, sie bevorzugen jüngere Frauen mit vielversprechenden Rundungen, eine Vorliebe, die aus evolutionärer Sicht verständlich ist, denn junge Frauen sind mit ziemlicher Sicherheit fruchtbar. Der Status einer Frau gilt als weniger wichtig. Eine männliche Vorliebe für ältere Frauen wäre unter evolutionärem Gesichtspunkt eine Sackgasse, während für Frauen das Alter des Partners keine so große Rolle zu spielen braucht, da Männer sehr viel länger zeugungsfähig sind.
Neuere Untersuchungen weisen allerdings darauf hin, dass die Partnerpräferenz von Frauen vielleicht doch etwas komplizierter ist. Sie scheint sich nämlich während des Zyklus zu ändern. Außerhalb der fruchtbaren Perioden bevorzugen Frauen sanftmütige männliche Partner, die viel in eine Beziehung investieren, doch in der Zeit des Eisprungs empfinden sie den Macho mit breiten Schultern und kräftigem Kinn als anziehender. Eine clevere Frau profitiert so vom Besten aus zwei Welten. Für die „guten Gene“ wählt sie den attraktiven Macho und lässt den Softie für die Kinder aufkommen. Diese Taktik verfolgen auch die Weibchen anderer Tierarten, etwa Meisen. Auch dem Mann stehen übrigens mehrere Möglichkeiten offen. Wenn er schlau ist, wird er sich als Typ ausgeben, auf den man bauen kann, und sich nach der Kopulation aus dem Staub machen. Es gibt genügend Männer, die mit mehreren Frauen Kinder gezeugt haben und andere Männer dafür aufkommen lassen. Nach vorsichtigen Schätzungen sind zehn Prozent der Väter zu Unrecht davon überzeugt, sie zögen ihren eigenen Nachwuchs auf.
Nach Ansicht mancher Soziobiologen hat im Verlauf der menschlichen Evolution ein evolutionäres „Wettrüsten“ zwischen Mann und Frau stattgefunden. Männer verstanden sich immer besser darauf, Frauen vorzuspiegeln, sie seien rechtschaffene Gesellen, während Frauen immer gewiefter wurden im Entlarven dieser Betrüger. So ergibt sich die paradoxale Situation, dass von Untreue also nur bei Lebensgemeinschaften die Rede sein kann, bei denen sich beide Partner um den Nachwuchs kümmern. Bei Männchen anderer Arten, die wenig in die Nachkommen investieren, hat sie im Grunde keinerlei Bedeutung.