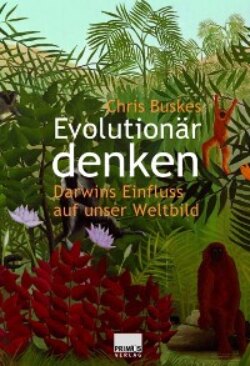Читать книгу Evolutionär denken - Chris Buskes - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das biologische Artkonzept
ОглавлениеNicht nur für die Biologie überhaupt, sondern auch für die Taxonomie war die Darwin’sche Theorie von großer Bedeutung, sie stellte das von Linné entwickelte hierarchische Ordnungssystem in einen evolutionären Zusammenhang. Die Verwandtschaft zwischen Organismen beruht auf der Abstammung. Alle Lebewesen sind im Grunde miteinander verwandt. Menschen, Taufliegen und Eichen haben gemeinsame Vorfahren. Geht man in der Zeit nur weit genug zurück, so kommen die verschiedenen Entwicklungslinien wieder zusammen. Den Grad der Verwandtschaft bestimmt die verstrichene Zeit und die Zahl der Verzweigungen, die stattgefunden haben. Zugleich brachte Darwins Entdeckung es mit sich, dass die Scala naturae, die hierarchische Schöpfung, einen dynamischen Charakter erhielt. Arten sind nicht ewig und unveränderlich, sondern vergänglich und wandelbar. Statt nach der Essenz, der allgemeinen Form einer Art zu suchen, müssen wir die Dynamik von Populationen studieren. Diese bestimmt letztlich auch, welchen Weg eine Art einschlagen kann, und damit kehren wir wieder zur Anfangsfrage zurück: Wie entstehen neue Arten?
Die heutige Auffassung über die Artbildung geht hauptsächlich auf den deutsch-amerikanischen Biologen und Ornithologen Ernst Mayr zurück, einen der Architekten der Synthetischen Evolutionstheorie. Mayr, der am 3. Februar 2005 im Alter von hundert Jahren starb, war viele Jahrzehnte Professor für Zoologie an der Harvard University. Auch nach seiner Emeritierung fuhr Mayr noch täglich zu seiner ehemaligen Wirkungsstätte, wo er ein Arbeitszimmer hatte. Als er neunundneunzig wurde, fand seine Familie, es sei genug und nahm ihm den Autoschlüssel ab. Ein Jahr später war er tot. Von Mayr stammt das sogenannte Biologische Artkonzept (Biological Species Concept oder BSC), das definiert, was eine Art ist:
Eine Art ist eine Gruppe natürlicher Populationen, die sich untereinander kreuzen können und von anderen derartigen Gruppen reproduktiv isoliert sind.
Mit „sich kreuzenden Populationen“ meint Mayr, dass die Individuen, aus denen eine Art besteht, untereinander Gene austauschen können, tatsächlich oder potenziell. Es muss theoretisch ein Genfluss zwischen den Populationen stattfinden können. Individuen, die zur selben Art gehören, können unter natürlichen Bedingungen fruchtbare Nachkommen hervorbringen, Individuen, die zu verschiedenen Arten gehören, können dies nicht. Wenn der Genfluss unterbrochen wird, entwickeln sich die Populationen unabhängig voneinander weiter, und auf diese Weise kann eine neue Art entstehen. Mayr zufolge ist die reproduktive Isolation der Motor der Artbildung.
Die Individuen einer Art verbindet zwar ein gemeinsamer Genbestand (Genpool), doch sie sind nicht alle gleich. Innerhalb jeder Art ist die Variation an Merkmalen und Eigenschaften groß, sie sorgt für eine morphologische Differenzierung zwischen Populationen. Man spricht dann von Unterarten oder Rassen. Die menschliche Spezies etwa, Homo sapiens, könnte man in Europide, Negride, Mongolide und Australide unterteilen. Es handelt sich jedoch um ein und dieselbe Art, da die Teilpopulationen (potenziell) ihre Gene austauschen können. Die Unterschiede zwischen den Unterarten des Menschen hängen zum Teil mit dem großen geographischen Verbreitungsgebiet zusammen. Menschen, die in der Nähe des Äquators leben, haben in der Regel ein anderes Aussehen als diejenigen in nördlicheren Gefilden. Am auffälligsten ist die unterschiedliche Hautfarbe: je intensiver die Sonneneinstrahlung, desto dunkler. Doch auch im Körperbau sind Unterschiede feststellbar. In der Evolutionsbiologie spricht man etwa von der Bergmann’schen Regel: Bei warmblütigen Wirbeltieren (und also auch beim Menschen) sind die Individuen einer Art in kühleren Gebieten durchschnittlich größer als die in wärmeren Lebensräumen. Ein größeres Körpervolumen hält die Wärme besser fest. Hiermit im Zusammenhang steht auch die Allen’sche Regel, nach der exponierte Körperteile wie Ohren oder Schwanz bei Säugetieren kalter Zonen kleiner sind als bei ihren Artverwandten in warmen Gebieten. In einem kalten Klima würden lange Ohren oder ein langer Schwanz leichter erfrieren.
Übrigens ist die genetische Variabilität des modernen Menschen verglichen mit unseren Verwandten, den Menschenaffen, erstaunlich gering. Die Unterschiede in Hautfarbe oder Körperbau sind nur oberflächlich und erst vor relativ kurzer Zeit entstanden. Wie lässt sich erklären, dass das Erbmaterial des Menschen eine so hohe genetische Homogenität aufweist? Es wurde in den letzten Jahren viel darüber spekuliert, und eine mögliche Erklärung wäre, dass unsere Art durch einen genetischen Flaschenhals (bottleneck) gedrückt wurde. Vor etwa hunderttausend Jahren hat demnach eine Katastrophe unsere Vorfahren drastisch dezimiert. Nach Schätzungen, die von der heutigen Verteilung der unterschiedlichen Genvarianten ausgehen, bestand die menschliche Spezies auf dem Höhepunkt der Krise (vor etwa achtzigtausend Jahren) aus nicht viel mehr als einigen tausend Individuen. Die Bevölkerung eines Dorfs! Es hätte nicht viel gefehlt, und wir wären gänzlich vom Erdboden verschwunden. Jedenfalls hat die Menschheit dadurch viel von ihrer ursprünglichen genetischen Vielfalt verloren: Wir stammen alle von einer kleinen Gruppe Überlebender ab. Die Ursache für die Dezimierung wird kontrovers diskutiert. Vielleicht war es eine Pandemie oder die Super-Eruption eines Vulkans im indonesischen Archipel mit weltweit verheerenden Folgen, für die es in diesem Zeitraum Hinweise gibt. Das Letztere würde allerdings nicht erklären, warum andere Arten, wie die Menschenaffen, offenbar nicht betroffen waren, da ihre genetische Vielfalt viel größer als die des Menschen ist.
Wie dem auch sei, im Lauf der Evolution können Teilpopulationen und Rassen aus verschiedenen Gründen isoliert werden, wodurch der Genfluss mit der Stammpopulation vermindert oder ganz unterbrochen wird. Eine dieser reproduktiven Barrieren wurde bereits kurz erwähnt: die geographische Trennung. Eine Population kann durch geographische Hindernisse, etwa einen Gebirgszug, einen Fluss oder einen Meeresarm, in zwei Gruppen gespalten werden. Die Finken auf dem Galapagos-Archipel sind hierfür ein gutes Beispiel. Einige Vögel wurden durch einen Sturm vom südamerikanischen Kontinent zu den Inseln getragen. Da der Genaustausch mit der Stammpopulation nicht mehr möglich war, entwickelten sie sich isoliert weiter. Im Verlauf einiger Jahrtausende entstanden so neue Finkenarten. Mayr bezeichnet diesen Vorgang als geographische oder allopatrische Artbildung (griechisch allos = anders; patra = Vaterland). Die Population hat sich in einer anderen Heimat niedergelassen und spaltet sich dort in verschiedene neue Arten auf. Nach Auffassung Mayrs ist die allopatrische Speziation die Regel.
Eine nicht unbedeutende Rolle bei der geographischen Artbildung spielt das Phänomen der Gendrift. Als Gendrift bezeichnet man die zufällige Veränderung der Genfrequenzen in einer Population. Die wenigen Finken, die die Galapagos-Inseln erreichten, stellten höchstwahrscheinlich keinen repräsentativen Durchschnitt der Ausgangspopulation dar. Bestimmten genetischen Variationen oder rezessiven (zurücktretenden) Merkmalen, die sich in der großen Stammpopulation nicht durchsetzen konnten, bietet sich nun in der kleineren Tochterpopulation eine Chance. Es ist einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Angenommen, in einer großen Kiste befinden sich Tausende von Murmeln in zehn verschiedenen Farben, die die Variation in der Stammpopulation darstellen. Greift man wahllos fünf Murmeln heraus, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass nur zwei oder drei Farben vertreten sind. Die fünf Murmeln sind nicht repräsentativ für die Gesamtpopulation. Im statistisch günstigsten Fall hält man Murmeln mit fünf verschiedenen Farben in der Hand. Gendrift kann also den Genbestand einer kleinen, isolierten Population einschneidend verändern. Mayr spricht in diesem Zusammenhang vom „Gründer-Effekt“. Gründer sind Individuen, die geographisch und genetisch isoliert wurden und so die Pioniere einer neuen Art werden. Im Prinzip reicht schon ein einziges befruchtetes Weibchen, um diesen Prozess in Gang zu setzen.