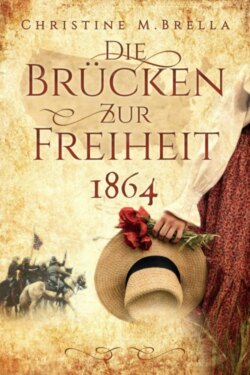Читать книгу Die Brücken zur Freiheit - 1864 - Christine M. Brella - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
12 Nick – 21. Dezember 1863
ОглавлениеN och vor dem Morgengrauen flüchtete ich aus dem Haus. Auf keinen Fall wollte ich dem Reverend, der in Andrews Bett vor sich hin schnarchte, beim Frühstück begegnen. Nach den Erlebnissen der letzten Woche musste ich allein sein.
Ich hasste jeden Tag, an dem ich in unseren vier Wänden eingesperrt war. Es war Zeit, endlich etwas zu unternehmen! Hoffnung flatterte in meiner Brust wie ein Vogelküken, das gerade flügge wird. Ben hatte Daisy gesehen! Wenn ich es schaffen würde, meinen Hengst einzufangen, konnte ich mich um Freddy Johnson kümmern und vielleicht auch den kläglichen Rest der Ranch erhalten.
Im Hinausgehen schob ich mir einen Kanten Brot und ein gekochtes Ei in meinen Beutel. Ich plante, nicht vor der Abenddämmerung zurück zu sein. Draußen war es kalt und ich zog Vaters Mantel fester um mich. Der Schecke war behelfsmäßig im verwaisten Hühnerhaus untergebracht. Schnell sattelte ich ihn und stieg auf. Sobald die Ranch hinter einer Bodenwelle verschwand, ging die Ruhe des Tieres auf mich über. Wie sehr hatte ich es vermisst, auf dem Pferderücken über das Land zu streifen!
Ich begann meine Suche in der unmittelbaren Umgebung. Mein Plan war, die Ranch einmal zu umkreisen und mich dann spiralförmig nach außen zu arbeiten. Wenn Daisy tatsächlich mehrmals in Sichtweite aufgetaucht war, entdeckte ich vielleicht seine Spuren. Dann musste ich diesen nur noch folgen und hoffen, dass sich mein Hengst nicht zu weit entfernt hatte. Daisy war mein einziger Freund. Wenn auch nur der Krümel einer Möglichkeit bestand, ihn wiederzufinden, konnte ich ihn nicht aufgeben.
Vor knapp vier Jahren hatte ich Daisy verletzt und von seiner Herde zurückgelassen auf der Prärie gefunden. Damals war er schon kein Jungtier mehr gewesen. Eine Wolfsmeute hatte seine Seite aufgerissen und er war zu schwach gewesen, um auf die Beine zu kommen. Lange Wochen hatte ich ihn gepflegt, bis seine Wunden geheilt waren. Nach und nach hatte ich sein Vertrauen erlangt. Seitdem war er mir ein treuer Begleiter.
Als die Sonne ihre ersten Strahlen über die Ebene warf, startete ich meine Suche auf der Erhebung, von der aus ich den Überfall beobachtet hatte. Meinen Blick auf den Boden gerichtet, ließ ich den Schecken zügig einen weiten Kreis traben, in der Hoffnung, sehr bald auf die gesuchten Hufspuren zu stoßen. Nach einer halben Stunde langte ich wieder am Hügelkamm an, ohne fündig geworden zu sein. Selbst die Abdrücke, die Daisy auf seiner Flucht hinterlassen hatte, konnte ich auf dem felsigen Untergrund nicht mehr ausmachen, und auch keinen Hinweis, dass fremde Männer hier gewesen waren. Die einzigen Anzeichen von Menschen oder Pferden stammten von der Kutsche des Reverends.
Für die nächste Runde entfernte ich mich aus der Sichtweite der Ranch und ließ mir mehr Zeit. Zunächst kam ich gut voran, während ich mit der Sonne im Rücken nach Westen ritt. Dann tauchte das Dornengestrüpp vor uns auf, in dem sich unsere Rinder früher vor den Cowboys versteckt hatten. Sich durchzukämpfen, hatte keinen Sinn – auch Daisy würde die Stacheln meiden – und so folgte ich den Ausläufern bis auf die andere Seite.
Jetzt schien mir die Sonne ins Gesicht. Vor meinen Augen tanzten schwarze Punkte. Im gleißenden Licht gingen alle Formen ineinander über, sodass ich nicht sicher sagen konnte, ob da wirklich Abdrücke im Gras waren oder mir meine Fantasie nur etwas vorgaukelte. Ich zog am Zügel und blinzelte mehrmals, aber auch dann verschwand die Fährte nicht. Mit klopfendem Herzen stieg ich ab, kniete mich auf die Erde und untersuchte die Eindrücke, die kaum sichtbar vor den Hufen des Schecken unseren Weg kreuzten. Sie stammten sicher nicht von Hufeisen, sondern viel eher von einem einsamen Hirsch. Danach entdeckte ich noch mehrmals Spuren von Großwild und Kaninchen, jedoch keine Hufabdrücke von Pferden.
Die vor Reif glitzernden Wiesen lagen verlassen da und ich war das einzige Lebewesen weit und breit, wenn ich den braven Schecken nicht mitzählte. Während ich von einer Bodenwelle in die nächste Senke ritt, holte ich meine Tonpfeife aus dem Beutel und steckte sie mir in den Mundwinkel. Statt echtem Tabak hatte ich nur Schilfgras, um sie zu stopfen, aber das war ich seit langem gewöhnt. Genussvoll inhalierte ich den beißenden Rauch und entspannte mich. Die Vorstellung, wie Mary die Augen verdrehen würde, wenn sie mich so sähe, ließ mich schmunzeln.
Plötzlich brach der Schecke durch das dünne Eis, das den Grund bedeckte und versank bis zum Bauch im Matsch. Um ein Haar wäre ich aus dem Sattel gerutscht. Meine Pfeife ging aus und ich fluchte verhalten. Steifbeinig stieg ich ab und kämpfte mich zu Fuß durch den Morast. Zwar hatte es das Pferd ohne Reiter leichter, trotzdem sank es immer wieder ein. Hoffentlich verletzte es sich nicht am scharfkantigen Eis!
Bis wir den Rand der Kuhle erreicht hatten und uns der Boden wieder trug, waren wir beide fix und fertig. Es gab weit und breit weder eine geschützte Stelle noch Wasser. Das Essen wollte ich mir für später aufheben. Stehenbleiben würde uns nur auskühlen. Also setzte ich mich nach einer kurzen Pause wieder in den Sattel und ließ den Schecken im Schritt weitergehen.
Immer wieder musste ich jetzt absteigen und mein Magen hörte nicht auf zu knurren. Das besserte meine Stimmung auch nicht gerade. Abermals fielen die Schatten auf den Weg vor uns und ich war am selben Punkt wie zu Beginn meiner Suche. Noch einmal vergrößerte ich den Abstand zur Ranch und hob den Blick nicht mehr vom Boden.
So viel hatte sich verändert, seit ich das Blut im Schnee entdeckt hatte. Doch schon davor hatte ich meine Familie regelmäßig enttäuscht.
Ich war acht Jahre alt gewesen, als James einen einjährigen Schimmel von einer Auktion mit nach Hause gebracht hatte. Das Tier schlug nach allen Seiten aus und erntete dafür von meinem Bruder Prügel. Sofort fühlte ich mich mit dem Pferd verbunden. Tagelang verbrachte ich in seiner Box, erzählte ihm Geschichten von Uncas und Lederstrumpf und sang ihm in einer Fantasiesprache Indianerlieder vor. Bis der Schimmel mich endlich auf seinem Rücken duldete. Er war das erste Pferd gewesen, das ich an den Sattel gewöhnt und trainiert hatte. Dieses eine Mal hatte ich gespürt, dass James stolz auf mich war.
Seitdem war es meine Aufgabe, neue Pferde zuzureiten. Aber ich hatte dieses Leuchten in James’ Augen nie wiedergesehen. Wieso, wusste ich nicht, und hatte alles gegeben, damit es zurückkam. Doch selbst die unzähligen blauen Flecken und Verstauchungen, die ich mir beim Zureiten der Pferde holte, brachten es nicht zurück.
Also hatte ich neben den Pferden auch die Rinder zu meiner Aufgabe gemacht. Vielleicht würde dieses Lächeln dann zurückkommen? Wann immer ich Ma entwischen konnte, lief ich meinen älteren Brüdern nach und kümmerte mich um verwaiste Kälber, spielte den Boten oder half beim Treiben. Dann hatte der Krieg begonnen und die Situation hatte sich geändert.
Ich war dreizehn gewesen und James hatte mir das Versprechen abgenommen, mich um die Rinder zu kümmern. Ma wusste nichts davon und es gefiel ihr auch jetzt noch nicht, dass ich untertags im Sattel saß und nachts draußen bei der Herde wachte. Aber da James und Andrew weg waren und uns immer mehr Cowboys verließen, konnte sonst einfach niemand die Arbeit übernehmen. Also hatte ich die Rinder gehütet, jedenfalls solange wir noch Longhorns besessen hatten. Doch obwohl ich viele Tage und Nächte im Sattel verbrachte, zerstreute sich die Herde mehr und mehr. Irgendwann hatten wir es einfach nicht mehr geschafft, unsere Kälber mit Brandzeichen zu versehen. Selbst wenn wir unsere Tiere nach stundenlanger Suche wiederfanden, oft genug bei den Rindern von Mr. Goodman, konnten wir nun nicht mehr beweisen, dass sie uns gehörten. Um einen Krieg mit unseren Nachbarn zu vermeiden, hatten wir schließlich alle unsere Longhorns an Mr. Goodman verkauft. Doch der Erlös war seit Monaten aufgebraucht. Ich allein war für den Verlust der Rinder verantwortlich, weil ich meine Aufgabe nicht ordentlich erledigt hatte. Damit hatte ich meine Familie schon lange vor Delilah im Stich gelassen – wieder einmal. Ma hatte recht behalten: Man konnte sich nicht auf mich verlassen.
Wieder sah ich Vater in die Knie brechen. Dieses Bild wechselte sich mit dem verzweifelten Ausdruck in Delilahs Gesicht ab, die ich ebenfalls nicht hatte retten können. Tränen gefroren auf meinen Wangen, doch ich wischte sie nicht weg.
Erneut trafen wir auf das Dornengestrüpp. Diesmal waren der Schecke und ich schon so weit westlich gekommen, dass es zu viel Zeit gekostet hätte, es zu umreiten. Ich ritt ein Stück daran entlang und entdeckte eine Stelle, die weniger dicht wirkte. Zu Fuß setzte ich mich an die Spitze und bahnte uns einen Weg, indem ich trockene Zweige abbrach oder auf die Seite schob.
Dornen verfingen sich in meiner Kleidung und zerkratzten mein Gesicht. Wenigstens meine Hände waren durch die rindsledernen Reithandschuhe geschützt. Ein Zweig schnellte zurück und hinterließ ein Brennen auf meiner Wange.
»So ein Mist!«
Tränen blendeten mich. Ich drückte den Daumen auf die Stelle. Als ich ihn zurückzog, war der Handschuh blutig. Wütend packte ich mein Messer und hackte auf das Gebüsch ein. Er gab nach und ich trat einen Schritt vorwärts. Plötzlich brach der Grund unter mir ein. Ich plumpste auf den hartgefrorenen Boden; gleichzeitig schoss eiskaltes Wasser in meinen Stiefel. Ich schrie auf. Nachdem ich einmal angefangen hatte, konnte ich nicht mehr aufhören. Ich heulte meine Verzweiflung in das feindselige Gestrüpp. Tränen rannen mir übers Gesicht und ich schlug mit dem abgebrochenen Zweig auf den Busch vor mir.
Es dauerte lange, bis meine Tränen versiegten und ich kraftlos den Arm senkte. Gebrochen kämpfte ich mich auf die Beine, leerte den Stiefel aus und hängte ihn an den Sattel. Als Ersatz schnitt ich mit meinem Messer einen Streifen der Satteldecke ab und wickelte ihn mir um den Fuß. So bestand immerhin die Möglichkeit, dass ich keine Erfrierungen davontragen würde, dachte ich stumpf. Nichtsdestotrotz musste ich die Suche abbrechen.
Als würde das Schicksal mich verhöhnen, erreichte ich nach einer weiteren Pferdelänge den Rand des Dickichts. Gerade wollte ich mich in den Sattel ziehen, als ich stutzte. Vor uns kreuzte eine frische Hufspur unseren Weg. Sie kam von der Ranch. Ich brauchte einige Sekunden, bis ich begriff: Ich hatte Daisy doch noch gefunden!
Mein Herz klopfte aufgeregt. Ich lenkte den Schecken auf die Fährte. Am Anfang war sie gut sichtbar und wir bewältigten zügig die ersten Meilen. Der Grauschimmel bewegte sich ungewöhnlich geradlinig, als ob er ein klares Ziel anstrebte. An einer Stelle hatte der Wind den Felsen komplett von Erde befreit, aber auch hier musste ich nicht lange suchen, denn die Spur setzte sich exakt am anderen Ende fort. Wir folgten dem Bachlauf und mussten immer wieder dichtem Ufergebüsch ausweichen.
Nach Mittag legten wir eine Rast ein. Ich war völlig durchgefroren und musste meine Kräfte einteilen. Mit meiner Blechtasse schlug ich ein Loch in das Eis, das an einer Stromschnelle relativ dünn war, und ließ das Pferd saufen. Ich kauerte mich an seiner Seite zusammen und knetete den stiefellosen Fuß, den ich mittlerweile kaum noch spürte. Hoffentlich fror mir kein Zeh ab! Dann schälte ich mit steifen Fingern mein Ei, zupfte Stücke vom Brot ab und schob mir beides abwechselnd in den Mund. Dazu schöpfte ich mir mit der Tasse Wasser, das so kalt war, dass meine Kehle schmerzte.
Ein kratziges Lachen wehte zu mir herüber. Ich zuckte zusammen. Eilig hobbelte ich den Schecken mit einem Strick und pirschte mich, gedeckt durch die Büsche, an das Grölen heran. Der taube Fuß behinderte mich und ich blieb immer wieder im Unterholz hängen. So ein Mist! Heute stellte ich mich eher an wie ein tapsiger Bär als wie ein Indianer.
Die Stimmen wurden lauter und ein unguter Verdacht keimte in mir. Hatte ich gar nicht Daisy verfolgt? Wer schlich sich hier in unserer Gegend herum?
Gerade noch konnte ich mich hinter einen Strauch ducken, als drei reiterlose Pferde vor mir auftauchten. Sie waren an einen Baum in meiner Nähe gebunden und noch aufgezäumt. Ein Sattel aus schwarzem Leder war protzig mit Silbernieten verziert. Das kam mir bekannt vor. Ich hielt den Atem an und ging in die Hocke. Wenn die Tiere meine Witterung aufnahmen, würden sie mich verraten.
»Hast du was herausgefunden?«
Meine Nackenhaare stellten sich auf. Den Besitzer dieser sanften Stimme konnte ich hinter den Büschen nicht sehen, trotzdem erkannte ich sie sofort. Sie gehörte dem weißblonden, bartlosen, erbarmungslosen Frederick Johnson. Ich grub meine Finger in die gefrorene Erde, damit sie aufhörten zu zittern; wollte mich mit bloßen Händen auf ihn stürzen! Jede Faser in mir schrie nach Rache. Aber gegen drei Gegner hatte ich keine Chance. Zum Glück war ich ein erfahrener Jäger und geduldig. Ich konnte den richtigen Zeitpunkt abwarten. Wenn es so weit war, würde ich ihn nicht entkommen lassen.
»Nicht wirklich, Boss. Außer gestern zur Beerdigung verlassen sie kaum noch das Haus. Viel haben sie draußen eh nicht mehr, wonach sie schauen müssten.« Der Sprecher stieß das gleiche kratzige Lachen aus, das mich hergelockt hatte.
»Lange machen die es nicht mehr!«, spottete ein Dritter.
»Halt die Klappe, Bill!« Das war wieder Freddy. »Hast du die Fallen zerstört?«
»Alle, die ich gefunden hab.«
Ich knirschte mit den Zähnen.
»Sehr gut! Spätestens wenn diese Niggerfreunde nichts mehr zu fressen haben, ziehen sie wieder in den Norden, wo sie hergekommen sind! Mexikaner, Nigger und Neusiedler – bald werden sie alle begreifen, wer in Texas das Sagen hat!«
»Nicht, wenn die Yankees den Krieg für sich entscheiden«, warf Bill ein.
Ein Sirren in der Luft; ein Klatschen; dann ein spitzer Schrei. Hatte Freddy seinen Kumpan mit der Peitsche gezüchtigt?
»Das wird nicht passieren!« Freddys Stimme war leise und schickte mir einen Schauer den Rücken hinab. »Mein Vater ist nicht umsonst 1847 gegen Mexiko gefallen. Texas gehört uns!«
»Besser gesagt: Mr. Goodman.«
Bill erntete ein weiteres kratziges Lachen, das abrupt abbrach.
»Hey Boss, ist das nicht schon wieder der verfluchte Grauschimmel?«
»Verdammt! Wenn ich den erwische, lernt er meine Sporen kennen!«
»Und wenn nicht, verpass ich ihm eigenhändig ’ne Kugel! Das letzte Mal hat er mich gebissen!«
Daisy! Sie sprangen auf und rannten zu ihren Pferden. Dabei lärmten sie so, dass sie nicht hörten, wie ich ebenfalls losstolperte. Ich musste ihnen zuvorkommen! Der Knoten in den Fußfesseln des Schecken widersetzte sich meinen zitternden Fingern; dann war auch ich im Sattel und der Schecke brach mit mir durch das Gebüsch. Nach einer Biegung zügelte ich das Pferd. Auch aus einer Meile Entfernung erkannte ich Daisy an seinen staksigen Beinen und seinem zu groß geratenen Schädel. Drei Reiter jagten den Mustang vor sich her. Sie wollten ihn an der Dornenwand in die Enge treiben! Jeder hatte ein Lasso griffbereit über das Sattelhorn gehängt und sicher auch die notwendige Erfahrung, es zu benutzen. Noch hatten sie mich nicht bemerkt – allerdings war das nur eine Frage von Sekunden, denn sie preschten direkt auf mich zu. Ich musste sofort handeln!
Ohne hinzusehen, legte auch ich mein Lasso zur Schlinge und behielt es in der Hand. Bewegungslos verschmolzen wir so gut es ging mit den Büschen hinter uns. In atemberaubender Geschwindigkeit kam Daisy in gestrecktem Galopp näher. Er war jetzt nur noch wenige Fuß entfernt. Ich sah die Panik im Weiß seiner Augen. Schmerzhaft zog sich mein Magen zusammen. Ich vergaß meine eigene Furcht; drückte dem Schecken die Fersen in die Flanken. Wir überwanden den Raum zum Grauschimmel innerhalb eines Wimpernschlags. Bevor Daisy reagieren konnte, lag mein Lasso um seinen Nacken. Voller Wut und Angst stieg er mit den Vorderläufen in die Höhe und wieherte schrill.
Aus den Augenwinkeln registrierte ich, dass auch seine Verfolger den Abstand verkleinert hatten. Wenn ich meinen Hengst nicht bald unter Kontrolle brachte, würden sie beide Pferde einfangen und mich dazu. Oder erschießen.
Entschlossen drängte ich den Schecken an Daisys Seite und hechtete mit einem Satz auf dessen Rücken. Die Zügel des anderen Pferdes ließ ich dabei nicht aus der Hand.
»Ruhig, Großer, ruhig!« Es kostete mich Mühe, sanft mit ihm zu sprechen, statt zu brüllen. Dabei klopfte ich seinen Hals und gab ihm Zeit, meinen Geruch und meine Stimme zu erkennen.
Ein Zittern ging durch Daisys Körper, dann stand er still. Keine Sekunde zu früh. Die Schurken waren nur noch zwei Pferdelängen entfernt, als ich mich über seine Mähne beugte und die Knie an seine Seiten drückte. Für einen Moment war ich dem Mörder meines Vaters so nah, dass ich ihn mit ausgestrecktem Arm hätte berühren können. Der minzige Duft von Mundwasser drang an meine Nase. Ich prägte mir sein engelhaftes Gesicht ein. Irgendwann würde die Zeit für meine Rache kommen!
Überrascht, dass ihnen ihre Beute jetzt entgegenkam, statt zu flüchten, reagierten Freddy und seine Kumpane erst, als wir schon an ihnen vorbei waren. Bis sie ihre Pferde gestoppt und gewendet hatten, gelangten wir aus der Wurfweite ihrer Lassos.
»Halt an, verflucht! Der Hengst gehört uns!«
Ich ignorierte die Schreie und Flüche hinter uns und ließ Daisy sein volles Tempo entfalten. Zugegebenermaßen war er keine Schönheit, aber er war schnell. Außerdem hatte er von allen Reittieren die leichteste Last zu tragen. Der Schecke konnte nur mit uns Schritt halten, weil er reiterlos war.
Ein Zischen an meinem rechten Ohr. Dann ein Knall. Sie schossen auf uns! Instinktiv schlug ich einen Haken nach links. Mein Ziel war eine kleine Baumgruppe weiter vorn. Der Grauschimmel stolperte in einer Kuhle, die vom Gras verborgen war. Einen langen Moment war ich mir sicher, dass wir stürzen würden, dann stand er wieder sicher. Trotzdem hatten wir Zeit verloren. Nochmals wagte ich es nicht, mich umzublicken; klammerte mich an den warmen, vertrauten Pferdehals; versuchte, Daisy mit der Kraft meiner Gedanken zu Höchstleistungen anzuspornen.
Wir donnerten über den hartgefrorenen Boden. Ich nahm nichts mehr wahr außer das Trommeln der Hufe und den aufstaubenden Schnee.
»Ho, ho, ho, nicht so stürmisch!«
Der spöttische Ruf kam nicht von hinten, sondern aus einiger Entfernung vor mir. Ich hob den Kopf und entdeckte, dass ich den Waldrand fast erreicht hatte. Davor stand die Kutsche des Reverends mitsamt ihren drei Insassen. Noch nie war ich so froh gewesen, den Reverend zu sehen. Verlegen zügelte ich die Pferde und warf einen Blick über die Schulter. Von den Cowboys waren nur noch drei Schneewolken geblieben. Sie hatten das Gefährt bestimmt vor mir bemerkt und würden erst versuchen, die Sache zu Ende führen, wenn ich allein nach Hause ritt. Irgendwann würden sie schon merken, dass ich geübt darin war, so geduldig zu warten wie eben notwendig.