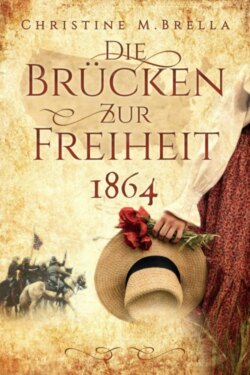Читать книгу Die Brücken zur Freiheit - 1864 - Christine M. Brella - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5 Annie – 13. Dezember 1863
ОглавлениеA nnika Bailey, bist du hier irgendwo?«
Die schneidende Stimme von Mrs. Hodgers drang in jeden Winkel des kleinen Stalls. Annie zuckte zusammen, versteckte eilig die Zeitung, über der sie die Zeit vergessen hatte, und duckte sich im Verschlag des alten Kutschgauls noch tiefer in das Stroh. Sie hielt den Atem an. Sekunden verstrichen, in denen sie nur das Schnauben des Pferdes und das gelegentliche Stampfen und Rascheln von Hufen vernahm.
»Suchen Sie irgendwas?«, dröhnte der Bass des Kutschers durch die Stille.
»Haben Sie Miss Bailey gesehen?«
»Was sollte sie denn im Stall verloren haben? Kommen Sie mit nach draußen, dann helfe ich Ihnen, sie zu finden.«
Für einen Moment erschien das Gesicht ihres Freundes Mr. Curtis über der Wand der Box. Verschwörerisch blinzelte der alte Mann Annie zu. Dann fiel die Tür hinter den beiden ins Schloss.
Sofort entspannte sich Annie. Sie musste noch besser aufpassen, wenn sie hierherkam! Keine andere Schülerin hätte Mrs. Hodgers ausgerechnet im Stall gesucht. Für Annie jedoch waren Pferde gleichbedeutend mit Freiheit. Der Stall bot ihr ein Versteck vor dem Trubel im Internat, wo sie nie allein war. Nicht im Schlafsaal, nicht im Unterricht, nicht im Speisesaal.
Annie schloss die Augen und sog den würzigen Duft nach Pferd ein. In der Zeit vor dem Krieg hatte sie auf dem Rücken ihrer Stute für ein paar Stunden dem Tadel ihrer Stiefmutter und den standesgemäßen Konventionen entfliehen können. All ihre glücklichen Kindheitserinnerungen waren mit Pferden verknüpft. Sie konnte immer noch die starken Arme ihres Vaters um sich spüren, wie er sie als kleines Mädchen vor sich im Sattel gehalten hatte. Das glockenhelle Lachen ihrer echten Mutter war ein fester Bestandteil dieser Erinnerung. Wenn Annie sich konzentrierte, konnte sie deren Silhouette im Gegenlicht ausmachen. So vertraut. Doch nie gelang es ihr, dem Umriss ein Gesicht zu geben.
Traurig streichelte das Mädchen dem Falben über die Nüstern und genoss das Gefühl von weichem, beweglichem Fell unter ihren Fingern. Sanft stupste der Hengst gegen ihre geöffnete Handfläche und sein warmer Atem strich darüber. Seit einem gefühlten Jahrhundert war sie auf keinem Pferd mehr gesessen. Sie vermisste den Wind in ihren offenen Haaren, die gleitende Bewegung unter sich, wenn sie mit ihrem Pferd zu einer Einheit verschmolz und über die Weide am Waldrand stob. Sehnte sich nach der Aufregung, wenn sie einen riskanten Sprung über einen gestürzten Baum wagte, und die Unabhängigkeit, wenn sie allein schnelle Entscheidungen treffen musste. Nur sie gab dann die Richtung vor!
Annies geheimes Ziel war es, nach ihrem Schulabschluss die heimatliche Pferdezucht mit ihrem Vater zusammen zu leiten. Natürlich war das für eine Frau unerhört. Aber die Welt der Züchter musste sie einfach anerkennen, wenn sie die Beste in ihrem Fach war und Zuchterfolge aufweisen konnte! Ihre Bildung würde der Grundstein werden für die Brücke in ein freies Leben.
Das nächste Mal, wenn sie ihren Vater sah, würde sie ihm ihren Traum anvertrauen. Er würde stolz sein. Bestimmt. Gedankenverloren zog Annie die Zeitung unter dem Stroh hervor und strich liebevoll mit dem Finger über die gedruckten Zeilen, ohne sie zu lesen. Bücher und Zeitungen waren ihr geheimes Fenster auf die aufregenden Geschehnisse außerhalb der Schulmauern seit ihrer Kindheit.
Annies Mutter Sue hatte in ihr schon als kleines Mädchen die Neugierde auf die Geheimnisse der Welt geweckt. Sie war es gewesen, die Annie enthüllt hatte, dass man mithilfe von Büchern alle Grenzen überwinden konnte. Seit Annika gelernt hatte, Buchstaben zu entziffern, sog sie jeden geschriebenen Text in sich auf, der ihr in die Hände fiel. Dass sie einen großen Teil der Lexika, Pferdezuchtbücher, Romane, Manöverstrategien, Geographiewerke und Ausführungen zum christlichen Glauben, die sie in der Bibliothek entdeckte, anfangs nur ansatzweise begriff, störte sie nicht im mindesten.
Sue hatte es sich nicht nehmen lassen, Annika zusammen mit den Kindern der Haushälterin George und Maggie persönlich zu unterrichten. Niemand hatte ein gütigeres Herz als ihre Mutter. Annie musste bei der Erinnerung schmunzeln. Wenn sie die Augen schloss, konnte sie noch die rauen Bretter der Tische im alten Schulhaus unter den Fingerspitzen fühlen. Zum ersten Mal kam ihr die Frage in den Sinn, warum ihre Mutter darauf bestanden hatte, das kleine Blockhaus im Wald als Schule zu nutzen. Vor dem Wiederaufbau war es halb verfallen gewesen – vermutlich stammte es noch von den ersten Siedlern. Vielleicht hatte es damit zu tun, dass Sue immer von einer eigenen Schule geträumt hatte und kurze Zeit als Lehrerin tätig gewesen war, bevor sie Annies Vater getroffen hatte. Zumindest hatte dieser ihr das einmal erzählt. Oder vielleicht hatte Sue es einfach genossen, dort im Wald ihr eigenes Reich zu erschaffen.
Annies Erinnerung duftete nach poliertem Holz und Tinte. Neben ihr saß George. Sein Kopf lag schief und dunkle Strähnen fielen ihm ins Gesicht. Vor Konzentration hatte er die Zunge aus einem Mundwinkel gestreckt. Trotzdem gerieten ihm die Buchstaben windschief und konnten kaum entziffert werden. Sobald sich Sue zur großen Tafel umdrehte und mit schönen Bögen ein kompliziertes Wort anschrieb, ließ George die Schreibfeder fallen, und sein spitzbübisch funkelnder Blick traf den Annies. Wie sehr sie ihn um seine langen, dunklen Wimpern und die blitzenden Augen beneidete. Sie waren schwarz wie ein Moorsee! Nie konnte sie sicher sein, was dahinter vorging und was er diesmal wieder ausgeheckt hatte. Genervt drehte sie sich weg, konnte es aber nicht lassen, zwischen den Haaren hindurch zu ihm hinüber zu schielen. Hatte er in seiner Hosentasche ein paar Regenwürmer in die Schule geschmuggelt? Oder hatte er ihr eine seltene Blüte mitgebracht, die er bei seiner Arbeit auf der Ranch entdeckt hatte? Oder würde er sie gleich mit feuchten Papierkügelchen beschießen?
Nach dem Tod von Annies Mutter hatte ihr Vater es in seiner Trauer versäumt, einen Hauslehrer oder eine Gouvernante einzustellen. Die achtjährige Annika hatte es ungerecht gefunden, dass ihrer aller Ausbildung auf einen Schlag beendet war. So setzte sie durch, dass der Unterricht beibehalten wurde und übernahm kurzerhand selbst das Zepter. Im Hier und Jetzt musste sie über ihr jüngeres Ich lächeln. Kaum nachdem sie den Entschluss gefasst hatte und die erste Stunde näher rückte, war sie immer nervöser geworden. Sie hatte sich nichts sehnsüchtiger gewünscht, als dass ihre Schüler nicht nur aus Pflichtgefühl teilnahmen. Sie wollte ihre Neugierde wecken und vielleicht auch George ein klein wenig beeindrucken.
Tagsüber ritt sie über die Wiesen und durchforstete in Gedanken alle Geschichten, die sie selbst besonders faszinierten. Schließlich verfiel sie auf Christopher Columbus, der für sie der Inbegriff von Forscherdrang war. Als Entdecker Amerikas war er prominent genug, um für die Foster-Kinder – insbesondere für den hibbeligen George – interessant zu sein.
Wieder zu Hause hatte sich die achtjährige Annie auf das Geschichtslexikon ihres Vaters gestürzt und sich in das Spanien des fünfzehnten Jahrhunderts entführen lassen. Sie kniete sich an Christophers Seite vor die Königin Isabella und erbat Geld für eine Expedition nach Indien; bangte, ob ihr Lebenstraum endlich in Erfüllung ginge; erlebte zusammen mit den Matrosen die endlose Seereise mit Krankheiten, Entbehrungen, Hoffnung im Herzen und dem berauschenden Gefühl der Freiheit; jubelte erleichtert »Land in Sicht!«, als die ersten Inseln auftauchten.
Annies erste Unterrichtsstunde war jedoch um Haaresbreite ins Wasser gefallen, weil George nicht auftauchte. Unruhig lief Annie auf und ab, kaute auf ihrer Unterlippe und zerbrach fast den Zeigestab, der länger war als sie selbst. Maggie saß stumm in ihrer Schulbank und verfolgte verängstigt, wie Annie immer nervöser wurde.
Erst mit einer ganzen halben Stunde Verspätung lud Mr. Foster seinen Sohn eigenhändig vom Pferd und schleifte ihn am Ohr herein. Mit verschränkten Armen, Schmutzstreifen im Gesicht und völlig verstrubbelt schmollte George in seiner Bank. Wenn Annie ihn aufrief, verweigerte er jede Antwort.
»Maggie, könntest du bitte für uns das Wort ›Pferd‹ buchstabieren, wenn das für deinen Bruder zu schwierig ist?«, versuchte sie es bei seiner Schwester. Vielleicht konnte sie George bei seinem Stolz packen. Bestimmt ließ er nicht zu, dass die Kleine ihn überflügelte.
Mit aufgerissenen Augen starrte Maggie ihre neue Lehrerin an. Als Annie schon die Hoffnung aufgegeben hatte, klappte die Kleine den Mund auf.
»Pferd buchstabieren«, wiederholte sie wenig hilfreich.
»Sei still«, blaffte George seine Schwester an. »Annie ist nicht unsere Lehrerin! Sie will sich nur aufspielen.«
Annie biss sich auf die Innenseite ihrer Lippe. Sie wollte George nicht die Genugtuung geben und ihn anschreien oder anfangen zu heulen. Er hatte ja recht – ihre Mutter sollte hier vorne stehen. Doch Sue war nicht mehr da.
Annie wollte nicht daran denken, dass ihre Mutter tot war. Wollte vergessen, dass ihr Vater zu irgendeiner Geschäftsreise aufgebrochen war und sie verlassen hatte. Wollte, dass alles wieder so wurde wie früher!
Also setzte sie sich an das Lehrerpult und begann zu erzählen: »Vor langer Zeit lebte ein Mann, der hieß Christopher Columbus. Wenn er 1492 Amerika nicht entdeckt hätte, säßen wir alle heute nicht hier.«
Während sie die Geschichte Stück für Stück vor ihren Zuhörern ausbreitete, bemerkte Annie zufrieden, dass Maggies Augen anfingen zu leuchten und Georges Arme sich lockerten. Gebannt hingen die Geschwister an ihren Lippen und saugten jedes Wort auf.
Angespornt von diesem Erfolg hatte Annie sich von da an mit Leib und Seele in die Vorbereitung des Unterrichts geworfen. Wenn sie nicht gerade ausritt, traf man sie mit großer Wahrscheinlichkeit in der Bibliothek ihres Vaters an. Natürlich hatte es George auch weiterhin nicht gefallen, dass Annie sich als Lehrerin gebärdete. Wenn es ihr jedoch gelungen war, ihn für ein Thema zu begeistern, hatte der Triumph jedes Mal umso süßer geschmeckt.
Annie konzentrierte sich wieder auf die Zeitung in ihren Händen und überflog die Überschriften nach Neuigkeiten aus dem Krieg. Hatte es der Norden endlich geschafft, weiter in den Süden vorzudringen? Gab es einen Hinweis, wo die Einheit ihres Vaters derzeit eingesetzt war? Annie stutzte, als ihr die Wörter »geflohene Sklaven« und »Torturen« ins Auge fielen. Irritiert sprang sie zum Anfang des Artikels und las: »Eine neue Enthüllung des Grauens! Um den Grad der Brutalität zu veranschaulichen, den die Sklaverei unter den Weißen im Süden erreicht hat, fügen wir den folgenden Auszug aus einem Brief der New York Times hinzu, in dem wir wiedergeben, was Flüchtlinge von Mrs. Gillespies Anwesen am Black River erzählt haben.«
War es Schicksal, dass dieser Artikel ausgerechnet heute in der Zeitung stand? Oder hatte sie derartige Berichte bis jetzt unbewusst übersprungen?
Mit einem mulmigen Gefühl studierte Annie die Stelle noch einmal langsam: »Die Behandlung der Sklaven ist in den letzten sechs oder sieben Jahren immer schlechter geworden. Das Auspeitschen des nackten Körpers mit einem Lederband ist häufig.«
Und weiter unten: »Eine andere Methode der Bestrafung, die für schwerere Verbrechen verhängt wird, wie z. B. Flucht oder anderes widerspenstiges Verhalten, besteht darin, ein Loch in den Boden zu graben, das groß genug ist, damit der Sklave darin hocken oder sich hinlegen kann. Das Opfer wird dann nackt ausgezogen, in das Loch gesteckt und eine Abdeckung oder ein Gitter aus grünen Stöcken über die Öffnung gelegt. Über diesen wird ein Feuer aufgebaut. Die brennende Glut fällt auf das nackte Fleisch des Sklaven, bis sein Körper Blasen bildet und bis zum Platzen anschwillt. Gerade noch lebendig genug, um kriechen zu können, darf sich der Sklave von seinen Wunden erholen, wenn er kann, oder seine Leiden durch den Tod beenden.
Charley Sloo und Overton, zwei Hilfsarbeiter, wurden beide durch diese grausame Folter ermordet. Sloo wurde zu Tode gepeitscht und starb an den Folgen kurz nach der Bestrafung. Overton wurde nackt auf sein Gesicht gelegt …«
Tränen bannten in Annies Augen und sie konnte nicht weiterlesen. Ungläubig starrte sie auf die Zeilen. Warum wurde etwas so Grausames gedruckt? Menschen wurden hier schlechter behandelt als jedes Tier! Wie konnte es sein, dass ein Sklavenbesitzer derartige Willkür walten lassen durfte und dabei durch das Gesetz geschützt war? Immerhin befand sie sich in Amerika, in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts! Wie konnten die Südstaatler stolz auf ihre Freiheit sein und gleichzeitig ihre Wirtschaft auf einem System der Sklaverei begründen?
Zu Hause in Kentucky waren Sklaven ein fester Bestandteil der Gesellschaft, den sie nie hinterfragt hatte. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass hier im Staat Ohio das Alltagsleben auch ohne Sklaven wunderbar funktionierte. Natürlich gab es auch hier Schwarze, doch die lebten in ihren Vierteln mit eigenen Kirchen, Schulen und Läden, die kaum je ein Weißer betrat. Heute hatte sie das erste Mal mit einem von ihnen gesprochen. Wie es dem Kleinen wohl ging?
Bis jetzt hatte Annie diese Abolitionisten, wie sich die Leute nannten, die sich für die Abschaffung der Sklaverei einsetzten, belächelt. Sollten sie doch singend und Banner schwingend durch die Straßen ziehen. Meinten sie wirklich, sie konnten damit auch nur einen Sklavenhalter zum Umdenken bewegen?
Doch nach dem Vorfall heute verlieh es ihr ein beruhigendes Gefühl, dass Menschen wie der kauzige Alte existierten, die sich um entlaufene Sklaven kümmerten. Im Grund konnte sie sich vorstellen, sich irgendwann für Flüchtlinge zu engagieren. Aber gerade jetzt hatte sie keine Zeit. Sie musste sich dringend auf ihre Prüfungen konzentrieren und Geschenke für Weihnachten besorgen.
Entschlossen wischte sich Annie die Tränen ab, steckte den Zeitungsbericht hinten in ihr Schulbuch, schlug ›Die Fibel der Ökonomie‹ an der eingemerkten Stelle auf und vertiefte sich in die Abwicklung von Kaufverträgen.