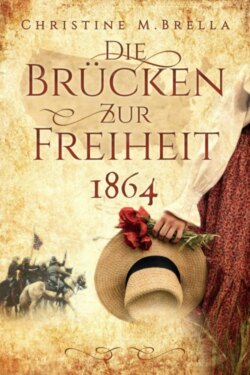Читать книгу Die Brücken zur Freiheit - 1864 - Christine M. Brella - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Nick – 13. Dezember 1863
ОглавлениеS chneidend blies der Wind über die texanische Grassteppe. Gerade erst hatte sich die Sonne fahl erhoben. Die frostüberzogenen Halme funkelten friedlich – trügerisch friedlich. Ich ballte meine eiskalten Finger zur Faust, kauerte mich tiefer in meinen Mantel und verschmolz wie ein echter Indianer mit dem Gestrüpp neben mir. Ich war Uncas, der letzte Mohikaner. Kein Hirsch, kein Eichhörnchen, nicht einmal eine Fliege würden meinem scharfen Auge entgehen.
Nach einer halben Stunde in dieser Position spürte ich meine Beine kaum mehr. Meine Ohren brannten und mein Magen grummelte. Seit Monaten waren unsere Vorräte knapp. Vorsichtig lockerte ich meine Schultern, ließ aber die Senke vor mir keine Sekunde aus den Augen. Falls nötig, würde ich hier noch bis zum Mittag ausharren, auch wenn ich damit eine Backpfeife von meiner Ma riskierte. Sie mochte es nicht, wenn ich mich draußen herumtrieb. War ich allerdings erfolgreich, würde ich mit einem vorwurfsvollen Blick davonkommen.
Tat sich da unten was? Meine Finger tasteten nach den bereitgelegten Kieseln. Mit einem Handgriff, den ich so lange geübt hatte, bis er mir in Fleisch und Blut übergegangen war, lud ich meine Steinschleuder. Vor Jahren hatte ich mir zusammen mit meinen Geschwistern Pfeil und Bogen gebaut. Im Gegensatz zu diesem Kinderspielzeug war die Schleuder eine tödliche Waffe.
Zwei fellige, rötlich braune Ohren tauchten hinter einem Felsbrocken auf und verschwanden sofort wieder. Die Jagd hatte begonnen. Tatsächlich wurde es unten plötzlich lebendig. Ruhig bleiben! Das Wild durfte nicht misstrauisch werden.
Ich zählte fünf Kaninchen, die sich aus ihrem Bau gewagt hatten. In aller Ruhe nagten sie an gefrorenen Grashalmen; hoppelten dann und wann hin und her; immer auf der Suche nach einem Stück Grün. Ein Langohr hüpfte auf mich zu. Jetzt war es etwa zehn Fuß entfernt. Langsam bog ich den Arm mit der Schleuder nach hinten und visierte es an. Alarmiert richtete es sich auf. Sein Kopf schoss in alle Richtungen. Das Näschen zuckte. Ich hielt den Atem an; wagte nicht, mich zu bewegen. Nach einigen langen Sekunden senkte das Tier die Vorderläufe auf den Boden und wandte sich wieder seiner Morgenmahlzeit zu. In dem Moment ließ ich den Riemen der Schleuder nach vorne peitschen. Das Kaninchen purzelte getroffen zur Seite und blieb mit einer blutigen Wunde liegen. Ich stieß ein wildes Kriegsgeheul aus, sprang auf und eilte zu meiner Beute. Deren überlebende Geschwister huschten verschreckt in alle Winde davon.
Ich bückte mich und hob das magere Fellbündel auf. Nicht gerade viel Fleisch, um sechs hungrige Mäuler zu stopfen.
Hoffentlich gewannen meine Brüder bald den Bürgerkrieg gegen die arroganten Nordstaatler! Lange würden wir hier draußen nicht mehr durchhalten. Die altbekannte Angst zog mir den Magen zusammen. Es wurde immer schwerer, der Verantwortung gerecht zu werden, die mir James vor drei Jahren übertragen hatte. Dabei war das doch meine Chance, ihm endlich zu beweisen, dass er auf mich zählen konnte!
»Nicky«, hatte er mich beschworen, »wenn wir weg sind, musst du für die Familie sorgen. Du kannst leidlich mit den Rindern umgehen, und wie man jagt, habe ich dir ja auch gezeigt. Ich will einfach nur, dass die Ranch so bleibt wie sie ist, bis wir wiederkommen.«
Wenn es doch nur bald soweit wäre! Mir wurde zwar schlecht, wenn ich mir vorstellte, wie er auf den Hof ritt und entdeckte, wie es um uns stand. Aber das war besser, viel besser, als wenn er nicht kam. Bis er und Andrew zurückkehrten, mussten wir uns irgendwie durchkämpfen. Später würde ich noch mal losziehen und meine Schlingen kontrollieren. Hoffentlich hatte ich damit mehr Erfolg.
Ich wandte mich zum Gehen. Da fiel mein Blick auf eine dunkle Vertiefung in einem Flecken makellos weißen Schnees. Eine Fährte, die ich nicht sofort zuordnen konnte, obwohl ich so was bei jeder Gelegenheit übte. Neugierig bückte ich mich. Eindeutig ein Abdruck von einem kleinen, nackten Menschenfuß. Rot gefärbt von Blut. Mein Herz zog sich zusammen. Unsere nächsten Nachbarn lebten einen halben Tagesritt entfernt. Kannte ich das Kind?
Ich sah mich rasch um, konnte aber keine Gefahr ausmachen. Keine Verfolger, keine wilden Tiere. Außer dem Wind war kein Laut zu hören. Mit angespannten Sinnen setzte ich mich in Bewegung und, folgte den blutigen Abdrücken. Den Blick auf den Boden gerichtet, kämpfte ich mich durch das brusthohe, mit Reif überzogene Dornengestrüpp. Sprang über einen gefrorenen Bachlauf. Erklomm einen steilen Hügel. Rutschte aus und riss mir die Finger auf. Egal! Weiter! Kam ich noch rechtzeitig?
Schlussendlich wäre ich um ein Haar über sie gestolpert. Sie lag reglos auf dem hartgefrorenen Boden, zusammengerollt wie das Eichhörnchenbaby, das ich im letzten Frühjahr gefunden und aufgepäppelt hatte. Beinahe wäre es ein friedliches Bild gewesen, hätte nicht überall Blut an ihr geklebt, getrocknetes an ihrem viel zu dünnen Hemd, frisches an ihren aufgerissenen Fußsohlen. Ich kniete mich zu dem Mädchen hinunter und berührte sacht ihre kohlschwarze Stirn. Es war das erste Mal, dass ich einem Sklaven so nahe war.
Ihre Haut fühlte sich seltsamerweise nicht anders an als meine, abgesehen davon, dass sie unter meinen kühlen Fingern glühte. Erleichterung durchströmte mich. Es war noch nicht zu spät.
»Heiliges Kanonenrohr«, murmelte ich. »Wem gehörst du denn?«
Was sollte ich mit ihr anfangen? Meine Gedanken überschlugen sich. Sollten wir einer entlaufenen Sklavin Unterschlupf bieten? Damit machten wir uns zur Zielscheibe für ihren Besitzer. Konnte ich sie hier liegen lassen? Nein! Das war weder mutig noch ehrenhaft. Es bedeutete ihren sicheren Tod. Hier würde heute keine zweite Menschenseele mehr vorbeistolpern. Schon eher eine Wolfsmeute.
»Mist!«
Ich atmete tief ein und aus. Sie musste so schnell wie möglich an einen wärmeren Ort. Eigentlich kam nur unsere Ranch infrage, aber meine Eltern würden ihre Anwesenheit unter keinen Umständen dulden. Somit blieb vorerst unser Stall. Dort konnte ich sie verstecken, bis mir eine bessere Lösung einfiel.
Ein letztes Mal zögerte ich. Durfte ich meine Familie einer so großen Gefahr aussetzen? Wieder sah ich mich nach allen Seiten um. Doch da war nichts als frostige Wildnis. Das Mädchen stöhnte und nahm mir die Entscheidung ab. Ich brachte es einfach nicht übers Herz, sie hier zum Sterben zurückzulassen.
Ich band mein Kaninchen am Gürtel fest und packte die Kleine behutsam unter den Armen. Obwohl sie bereits acht oder neun Jahre alt sein musste, wog sie nicht mehr als ein neugeborenes Kälbchen. Sie wachte nicht auf, als ich sie hochwuchtete und an mich presste. Keuchend schob ich sie ein Stück höher, sodass ihr Kopf und ihre Arme über meine rechte Schulter baumelten. Nur einmal stieß sie einen maunzenden Klagelaut aus, dann verstummte sie wieder.
Zum Glück hatte ich meinen Hengst nicht weit entfernt angebunden. Ich musste nur einige hundert Meter überwinden, aber mir brach der Schweiß aus und meine Muskeln zitterten vor Anstrengung. Daisy wartete geduldig. Jetzt hatte ich es fast geschafft. Schon wollte ich das Kind über seinen Rücken legen, da schnaubte mein Grauschimmel und tänzelte mit verdrehten Augen ein paar Schritte zur Seite.
»Ist schon gut. Ist schon gut«, beruhigte ich Daisy und fluchte innerlich.
Normalerweise erfüllte es mich mit Stolz, dass er außer mir keinen Menschen in seiner Gegenwart duldete. Jetzt aber hatte ich für seine Sperenzchen keine Kraft. Doch ich hatte keine Wahl. Diesmal näherte ich mich in Zeitlupe, den linken Arm besänftigend ausgestreckt, während ich mit dem rechten das Mädchen an meine Schulter drückte. Tatsächlich wich der Hengst jetzt nicht mehr zurück und hörte auf zu beben, als wollte ich ihn an die Wölfe verfüttern. Es gab noch einen kurzen Moment der Unsicherheit, als ich beide Hände benötigte, um die Kleine vor den Sattel auf den Pferderücken zu hieven. Dann hatte ich es geschafft. Mit einem Schwung war ich ebenfalls oben. Unser gemeinsames Gewicht war keine wirkliche Herausforderung für Daisy. Mit meinen fünfzehn Jahren war ich schmal gebaut und zusammen wogen das Mädchen und ich kaum so viel wie ein erwachsener Mann.
Im Schritt lenkte ich den Grauschimmel in Richtung unserer Ranch. Ich wollte der Kleinen auf keinen Fall weiteren Schaden zufügen. Sie wirkte so zerbrechlich. Kraftlos baumelten ihre Füße auf der einen Pferdeflanke herab und die Arme auf der anderen. Der Kopf wiegte bei jeder Bewegung hin und her und ihre sorgfältig geflochtenen Zöpfe hingen in ihr Gesichtchen, während die roten Schleifen im Wind flatterten.
Wer zum Teufel hatte ihr das angetan? Vor wem hatte sie sich so gefürchtet, dass sie barfuß querfeldein durch die Dornen geflüchtet war?
Bevor die Gebäude unserer Ranch in Sicht kamen, passte ich Daisys Laufrichtung an, sodass der Blick vom Wohnhaus durch eine Bodenwelle versperrt wurde. Ich hatte mir diesen Weg vor langer Zeit angewöhnt. Auf diese Weise nutzte ich jede Minute, die ich für mich allein hatte. Dass ein dichtes Gestrüpp am Kamm das Durchkommen erschwerte, war dabei von Vorteil. Zum ersten Mal heute war ich froh über das ungemütliche Wetter. So hielt sich wahrscheinlich niemand im Freien auf. Trotzdem saß ich ab und führte Daisy mit pochendem Herzen bis kurz vor den Hügelrücken.
Tatsächlich fand ich den Hof verlassen vor. Nur eine erloschene Laterne neben der Haustür schwankte knarzend im Wind und kratzte an meinen Nerven. Jetzt galt es, schnell zu sein! Natürlich würden die anderen im Haus das Hufgeklapper hören, aber daran konnten sie ja nicht ablesen, dass heute etwas anders war als sonst. Ich schob das Stalltor so weit auf, dass ich den Grauschimmel hindurchführen konnte. Dann zog ich es sofort wieder hinter uns zu.
Im Stall empfing uns der vertraute deftig-warme Geruch nach Gaul und Kuh. Hier waren im Winter neben unseren Pferden auch die beiden Milchkühe untergebracht, die uns noch geblieben waren. Die Bretterwand hatte zwar fingerbreite Schlitze, durch die der Wind pfiff, dafür war es hier drinnen aber auch nicht völlig dunkel und dank der Tiere immer noch deutlich wärmer als draußen.
Suchend blickte ich mich um. Die vorderen Boxen zur Linken waren mit Werkzeug und Futter für die Tiere gefüllt, in den folgenden standen die Kühe. Die Pferdeboxen rechts waren mit Gegenständen vollgestopft, die auf eine Reparatur warteten. Am anderen Ende war unsere Kutsche geparkt.
Ich entschied mich, für unseren Gast ein Lager im Heuvorrat in einer der Boxen weiter vorne einzurichten. Auf dem Kutschbock fand ich eine alte, schmierige Baumwolldecke. Die roch zwar penetrant nach Pferdeschweiß, würde die Verletzte aber warmhalten.
Die Kleine vom Pferd herunterzuziehen, war bedeutend leichter, als sie hinaufzuschaffen. In einem letzten Kraftakt manövrierte ich sie auf ihr improvisiertes Krankenlager und legte sie auf den Bauch.
Unschlüssig blieb ich in der Stallgasse stehen. Was jetzt? Bis hierhin hatte ich mich darauf konzentriert, das Mädchen aus der mörderischen Kälte in Sicherheit zu bringen. Weiter hatte ich noch nicht geplant. Ich schielte auf die blutigen Flecken, die sich auf dem Rücken ihres Hemds abzeichneten. Meine älteste Schwester Charlotte war diejenige, die sich mit Verbänden auskannte und sich stets geduldig um die kleineren und größeren Blessuren ihrer fünf Geschwister kümmerte. Wie würde sie jetzt vorgehen? Vermutlich erst mal das Problem eingrenzen und herausfinden, wie schwer die Verletzung tatsächlich war. Ich überwand meine Scheu; trat zu dem Mädchen; strich ihr sanft über die Wange. Was ich jetzt tun musste, war bestimmt schmerzhaft für sie. Ich zog mein Jagdmesser und schlitzte ihr Hemd von der Hüfte bis zum Kragen auf. Der verkrustete Stoff klebte an ihrer Wunde. Während ich ihn behutsam wegzupfte, wimmerte das Mädchen, noch immer ohne Bewusstsein. Endlich war es geschafft. Als ich die Fetzen zur Seite schlug, enthüllten sich fünf braunrote Krater, die von ihrer rechten Schulter quer über den Rücken liefen. Darunter leuchteten helle Geschwülste von älteren, längst verheilten Verletzungen. Entsetzt sog ich die Luft ein und unterdrückte die Tränen, die mir in die Augen traten. Ein Indianer weinte nicht.
Dass mancher Sklavenbesitzer die Peitsche gebrauchte, war mir klar. Aber was musste ein Kind verbrechen, um so eine Behandlung zu rechtfertigen? Hastig schlug ich den Stoff über den grausamen Anblick und zog die Decke über die mageren Schultern. Wenn ich die Wunden verband, würde ich bestimmt alles verschlimmern. Ich brauchte Hilfe.
So schlüpfte ich aus dem Stall und überquerte mit langen Schritten den eisigen Vorplatz bis zum Ranchhaus. Vor der Tür zögerte ich und sah hinunter auf das magere Kaninchen, das mich so viele Stunden gekostet hatte. Würde das bisschen Fleisch ausreichen, um Ma zu besänftigen? Wie würde sie reagieren, wenn sie von dem Mädchen erfuhr? Allein der Gedanke daran drehte mir den Magen um.
Ich war vielleicht sechs Jahre alt gewesen, als ich mit schlammiger Kriegsbemalung und einer Feder im Haar ins Haus gekommen war und Ma stolz meinen ersten Eselhasen hingehalten hatte. Er lebte noch, zappelte in meinen Händen und kitzelte mich mit seinem weichen Fell. Eine Ewigkeit hatte ich vor dem Gebüsch auf der Lauer gelegen. Als er aufgetaucht war, hatte ich mich auf ihn gestürzt, noch bevor er den ersten Haken hatte schlagen können. Aber danach hatte ich es nicht übers Herz gebracht, ihm den Hals umzudrehen.
»Was soll das?«, hatte Ma mich angefahren.
»Ich bin ein Mohikaner!«, verkündete ich, immer noch strahlend. »Heute können wir Fleisch in den Eintopf tun!«
»Hab ich dich nicht zum Wasserholen geschickt? Wo ist der Eimer? Hast du wenigstens die Hühner gefüttert?«
Schuldbewusst sanken meine Schultern herab. Die Hühner hatte ich völlig vergessen, nachdem ich mir die Feder ins Haar gesteckt hatte und der Hase vorbeigehoppelt war.
Ma lief rot an vor Wut. Mit einem langen Schritt trat sie auf mich zu und verpasste mir eine Ohrfeige. Vor Schreck ließ ich den Hasen los, der sofort die Flucht ins Freie ergriff. Mit Tränen in den Augen sah ich ihm hinterher.
»Nie kann man sich auf dich verlassen«, raunzte Ma und wandte mir den Rücken zu.
Ihre Worte stachen zu wie ein Skorpion – ohne Vorwarnung und giftig. Sie brannten schlimmer als meine Wange. Unsicher berührte ich die Stelle, an der sie mich getroffen hatte, und starrte Ma an.
In diesem Moment hörte ich Pa in meinem Rücken: »Was hat das Kind denn jetzt wieder angestellt?«
»Es ist zu nichts zu gebrauchen. Wasser holen und Hühner füttern. Was ist daran so schwer? Das kommt nur daher, weil du den Kindern mit deinen Indianergeschichten Flausen in den Kopf setzt.«
Ein kleiner Funke der Rebellion entzündete sich in mir. Dass ich meine Aufgaben vergessen hatte, war allein meine Schuld! »Pa kann nichts dafür! Ich …«
Bevor ich fortfahren konnte, schob mich Pa nach draußen. »Komm, ich helfe dir mit den Wassereimern. Besser wir ärgern deine Mutter heute nicht mehr.« Verschwörerisch zwinkerte er mir zu. So leise, dass Ma uns nicht hören konnte, flüsterte er: »Wenn du brav bist, erzähle ich dir als Belohnung die Geschichte, wie wir zwei Schwestern auf einem Hausboot gegen einen ganzen Stamm Mingos verteidigt haben!«
Am Abend hatten wir Kinder noch lange wachgelegen und gelauscht, wie unsere Eltern sich unten in der Stube anschrien. Seit wir nach Texas gezogen waren, kam das immer häufiger vor. Ma nannte Pa einen Träumer und er warf ihr vor, dass sie nicht an ihn glauben würde.
»Erzähl den Kindern wenigstens keinen solchen Blödsinn mehr!«, keifte Ma. »Du hast Nicky heute gesehen! Läuft herum wie ein dreckiger Indianer!«
Meine Geschwister starrten mich vorwurfsvoll an und ich kroch tiefer unter meine Decke. Es polterte fürchterlich, dann wurde die Tür zugeschlagen und es war ruhig.
»Du bist schuld«, zischte mir meine Zwillingsschwester Mary ins Ohr und drehte sich weg.
Als die Atemzüge meiner Geschwister ruhig wurden, lag ich immer noch hellwach auf meiner Pritsche. Ab jetzt würde ich alles tun, was Ma mir auftrug, schwor ich mir. Nie wieder wollte ich der Grund für einen Streit zwischen meinen Eltern sein. Ich würde Ma gegenüber genauso gehorsam sein wie Uncas gegenüber seinem Vater Chingachgook.
Doch egal, was ich seitdem versucht hatte, für Ma war ich eine Enttäuschung geblieben. Seit ich ihr über den Kopf gewachsen war, schlug sie mich nicht mehr oft, aber ihre kalten Blicke trafen mich ebenso hart.
Und heute hatte ich ein neues Ärgernis angeschleppt. Aber besser, ich erzählte ihr jetzt von dem Mädchen, bevor meine Familie es zufällig herausfand. Beherzt stieß ich die schwere Holztür auf und trat ein.
Mit einem Blick hatte ich den Wohnraum überblickt. Fünf Blondschöpfe, die sich so sehr von meinen eigenen rabenschwarzen Haaren unterschieden, waren über ihre jeweilige Tätigkeit gebeugt. Früher hatte ich mir oft erträumt, dass ich gar nicht wirklich das Kind meiner Eltern war. Vielleicht war ich in einem Binsenkörbchen am Ufer des Mississippis angespült worden? Hatte ich in Wirklichkeit indianische Ahnen? Aber welcher Indianer hatte Locken, blaue Augen und Sommersprossen? Letztlich hatte ich mich damit abgefunden. Ich gehörte in diese Familie.
Mein Vater saß in seinem Schaukelstuhl am offenen Kamin und schnitzte unbeholfen am neuen Stiel für unsere Axt. Wahrscheinlich hatte er wieder zu viel getrunken. Früher hatte er wunderschöne Spielzeuge aus Holz für uns Kinder gemacht. Dabei hatte er uns Geschichten aus seiner Jugend erzählt. Er war von zu Hause weggelaufen und Fallensteller bei den großen Seen geworden. Eine Zeit lang hatte er sogar unter den Indianern gelebt und mit dem Trapper Lederstrumpf und seinen indianischen Freunden Uncas und Chingachgook aufregende Abenteuer erlebt. James, Andrew, Mary und ich hatten das Gehörte immer nachgespielt und weitergesponnen. Meistens hatte Andrew Mary entführt und James und ich hatten sie dann vor grausamen Qualen am Marterpfahl gerettet. Charlotte waren unsere Spiele immer zu wild gewesen und Ben war damals noch zu klein. Später, als Ma ihn mit uns hatte ziehen lassen, durfte er manchmal als Jagdhund mitlaufen.
Seit seinem Unfall vor sechs Jahren hatte Vater selten ein freundliches Wort – oder überhaupt ein Wort – für uns übrig. Dass er mit seinem verkrüppelten Bein auf kein Pferd mehr steigen konnte, hatte aus ihm einen verbitterten Säufer werden lassen. Den stolzen Pionier, der uns 1855 aus den Wäldern um Memphis in Tennessee nach Texas in ein besseres Leben geführt hatte, gab es nicht mehr.
Zu seinen Füßen ließ mein zwölfjähriger Bruder Ben seine Holzsoldaten erbarmungslos gegeneinander anstürmen. Ob ihm bewusst war, dass das Spiel für unsere beiden älteren Brüder blutiger Ernst war? Ma und meine Schwestern bestickten am halbdunklen Küchentisch Charlottes Aussteuer. Charlotte hob den Kopf und warf mir ein zerstreutes Lächeln zu. Mary ignorierte mich wie meistens.
»Es zieht!«, polterte Pa, rutschte mit dem Messer ab, steckte sich den Finger in den Mund und fluchte gotteslästerlich.
Schuldbewusst zog ich die Tür lauter zu als notwendig und erntete prompt einen strafenden Blick meiner Ma. Mein Herz verkrampfte sich. Wie würde sie die Nachricht aufnehmen, dass ich ein entlaufenes Sklavenkind im Stall versteckt hatte?
»Ich hab da draußen Spuren entdeckt«, murmelte ich, ohne einen von ihnen direkt anzusehen.
Charlotte hob alarmiert den Blick. »Von Wölfen?«
»Wenn die von Menschen waren, geht uns das nichts an!«
Alle Köpfe fuhren zu Ma herum, die mich anfunkelte. Demonstrativ wandte sie sich der langen Unterhose auf ihrem Schoß zu.
»Wir haben dir was vom Maisbrot übriggelassen. Melkst du bitte die Kühe gleich?«
Für sie war die Angelegenheit erledigt.
Auch die anderen drehten sich von mir weg und ich stand vergessen im Raum. Ich legte das Kaninchen neben den Küchenherd. Den Mut für einen weiteren Versuch, mit der Wahrheit herauszurücken, brachte ich nicht auf. Das konnte genauso gut bis später warten.
»Waren nur Spuren von Karnickeln und Eichhörnchen«, durchbrach ich die Stille. Dankbar für die Gelegenheit, der Enge im Haus zu entgehen, schnappte ich mir mein Brot. »Nach dem Melken seh’ ich noch nach meinen Fallen.« Bevor mir jemand widersprechen konnte, fiel die Haustür hinter mir zu.
Bebend lief ich über den Hof zurück. Wann kamen James und Andrew endlich heim, damit sie wieder ihren Teil der Arbeit übernehmen konnten? Gleich darauf schämte ich mich für den Gedanken. Meine Brüder riskierten im Krieg ihr Leben für uns. Irgendjemand musste den Nordstaaten die Stirn bieten, die sich zu einer Union zusammengeschlossen hatten, um uns ihre Gesetze aufzuzwingen!
Ich dagegen hatte nur zwei Aufgaben: Ma gehorchen und Essen auf den Tisch schaffen. In beiden Fällen scheiterte ich kläglich. Manchmal wollte ich alles einfach nur hinter mir lassen und für immer fortgehen.
Sofort fegte ich die verräterischen Gedanken aus meinem Kopf. Unsere Familie hielt zusammen! Zuneigung offen zu zeigen, entsprach einfach nicht unserer Art. Trotzdem würde ich sie nie im Stich lassen!
Zurück im Stall vergewisserte ich mich, dass der Zustand meiner Patientin sich nicht verändert hatte. Sie war noch immer ohne Bewusstsein und ihre Stirn glühte. War ihre Temperatur noch gestiegen? Ich kaute nervös auf der Unterlippe. Wenn sie nicht wach geworden war, bis ich mit dem Melken fertig war, musste ich mir etwas einfallen lassen. Hatte ich sie am Ende zu spät gefunden? Ich durfte die Kleine nicht sterben lassen! Sie hatte bestimmt nichts anderes gewollt als die Freiheit! Wenn das der Preis war, war er zu hoch.
Ich suchte mir zwei Eimer. Der eine war für die Milch gedacht, der zweite als Melkschemel. Honey und Sugar traten unruhig auf der Stelle und begrüßten mich mit lautem Muhen. Schnelle Bewegungen vermeidend, richtete ich mich an Honeys Flanke ein, ließ aus jeder Zitze die ersten Tropfen auf den gestampften Erdboden spritzen und säuberte danach das Euter mit einem nassen Lappen. Dann ließ ich abwechselnd mit jeder Hand einen dünnen weißen Strahl in den leeren Kübel schießen. Ein hohler Klang ertönte in immer gleichem Rhythmus. Bis alle Zitzen abgemolken waren, dauerte es eine halbe Ewigkeit. Ich blendete jeden Gedanken an das Mädchen aus und versank in meiner Arbeit.
Es schepperte; ich fuhr auf. Mit dem Eimer noch in der Hand stürmte ich in die Box des Mädchens. Sie blickte mir mit großen, ängstlichen Augen entgegen. Beim Versuch sich aufzurichten, hatte sie die Heugabel zu Boden gerissen.
Minutenlang starrten wir uns an. Schließlich räusperte ich mich. Meine Kehle fühlte sich an wie mit einem Lasso zugeschnürt.
»Ich bin Nick. Du hast nichts zu befürchten. Ich hab dich draußen in der Wildnis gefunden.«
Ungläubigkeit und Angst wechselten sich auf ihrem hübschen Gesicht ab, bis schließlich ein scheues Lächeln über ihre Lippen huschte.
»Du hast mich beschützt?«
Ihre treuherzige, klare Kinderstimme rührte mich. Ich konnte nur nicken.
»Du wirst Master Johnson sagen, wo ich bin?«
Überrascht zuckte ich zusammen. Ausgerechnet Freddy Johnson! Der Vorarbeiter unseres Nachbarn Mr. Goodman war schon vor Ausbruch des Bürgerkriegs kein angenehmer Zeitgenosse gewesen. Er hasste alle Siedler, die wie wir nach dem Krieg gegen Mexiko nach Texas gekommen waren. In den letzten Jahren hatten er und seine Männer fast alle unsere Bekannten zum Aufgeben gezwungen. Am Ende mussten sie dankbar sein, wenn sie von Goodman ein paar Dollar für ihr gesamtes Hab und Gut bekamen. Eine Woche nachdem sich meine Brüder den Rebellen der Südstaaten angeschlossen hatten, war Freddy Johnson auch bei uns aufgetaucht. Vater hatte ihn mit der Flinte vom Hof gejagt. Beeindruckt hatte Johnson das nicht im mindesten. Wenn wir ihn in der Stadt trafen, beobachtete er uns mit dem lauernden Ausdruck einer Katze auf Mäusefang.
Ohne James und Andrew war es schwer, allen Aufgaben auf der Ranch gerecht zu werden. Dazu kamen die kleinen Unglücksfälle. Ein Kalb, das in der Nacht spurlos verschwunden war. Ein Hirschkadaver, den ich erst im Bachlauf gefunden hatte, als mehrere Rinder wegen des verseuchten Wassers verendet waren. Unsere Cowboys hatten sich entweder ebenfalls eingeschrieben oder arbeiteten jetzt für Arnold Goodman. Nach und nach hatten wir unsere gesamte Herde Longhorns verkaufen müssen, und die meisten Reitpferde noch dazu. Wie sollte ich James all das bloß beibringen, wenn er heimkam?
Je länger sie auf meine Antwort warten musste, desto hoffnungsloser wurde der Gesichtsausdruck der Kleinen. Langsam schüttelte ich den Kopf.
»Nein«, schwor ich. »Das werde ich nicht tun.«
Erleichtert sank sie zurück auf die Decke. Es war, als ob ihr diese Frage die letzte Kraft geraubt hätte.
»Ich bin Delilah«, murmelte sie noch, dann klappten ihre Augen zu. Kurze Zeit später zeugte ihr schwerer Atem davon, dass sie eingeschlafen war.
Ich brachte es nicht übers Herz, sie jetzt zu verbinden und damit zu wecken. Stattdessen ließ ich mich neben das Mädchen ins Heu plumpsen und tauchte ein Stück Maisbrot in die frische Milch. Während ich mir meine erste Mahlzeit des Tages schmecken ließ, beobachtete ich meinen Schützling beim Schlafen. Ich würde nicht zulassen, dass sie wieder in die Hände dieses Kerls fiel. Doch ich musste bald eine neue Unterbringung für sie finden! Solange schwebten wir alle in Gefahr.
Nachdem ich meinen Teil aufgegessen hatte, legte ich die andere Hälfte des Brots neben Delilah auf mein Halstuch und rückte den Milcheimer heran. Wenn sie das nächste Mal aufwachte, würde sie sicher hungrig sein.
Mit den Schlingen war ich erfolgreicher als mit der Schleuder. Zufrieden hängte ich das Kaninchen neben die drei Eichhörnchen an meinen Gürtel, machte mich auf den Rückmarsch und führte den Schecken dabei locker am Zügel. Daisy hatte ich im Stall gelassen, damit auch unser zweites Pferd Auslauf bekam. Tief sog ich die kalte Luft ein und genoss jeden Moment in Freiheit, in dem mir niemand vorschrieb, wie ich zu sein hatte.
Ich hatte es nicht eilig zurückzukommen. Heute Nachmittag würde ich ans Haus gefesselt sein und folgsam alle Aufgaben erledigen, die mir Ma auftrug. Dabei wusste ich jetzt schon, dass ich sie wieder enttäuschen würde, egal, wie sehr ich mich anstrengte.
Je näher ich unserem Heim kam, desto langsamer wurden meine Schritte. Ich wollte noch für ein paar Minuten so tun, als wäre ich ein einsamer Fallensteller. Ich hatte gerade eine Jungfrau in Nöten aus den Händen feindlicher Indianer befreit und wir wurden jetzt über die offene Prärie verfolgt. Wenn mir die Feinde vor die Büchse liefen und dann schworen, von uns abzulassen, würde ich Gnade vor Recht ergehen lassen.
Da zerriss ein Schuss die Stille über dem Grasland. Lautes Geschrei erklang; Hufe trommelten auf den harten Boden. Die Ranch! Meine Glieder gefroren mitten in der Bewegung und mein Herzschlag setzte eine Sekunde lang aus. Dann ließ ich die Zügel des Schecken los und begann zu rennen.