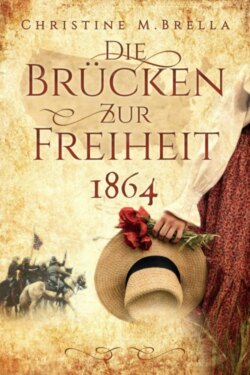Читать книгу Die Brücken zur Freiheit - 1864 - Christine M. Brella - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
14 Nick – 25. Dezember 1863
ОглавлениеW eihnachten, war mein erster Gedanke nach dem Aufwachen. Ich weigerte mich, die Augen zu öffnen. Stattdessen stellte ich mir die Gesichter meiner Familie an einem anderen, vergangenen Weihnachtsmorgen vor. Wir hatten uns erst kurz zuvor in Texas niedergelassen, und das Haus duftete nach frischem Holz und Schnee. Alle waren erfüllt mit der Hoffnung auf ein besseres Leben. Die Weiten der Prärie standen im Kontrast zu der dunklen Enge der Wälder, denen wir entkommen waren, und führten uns jeden Tag unsere neue Freiheit vor Augen. Unsere eigene Ranch! Ein Traum war in Erfüllung gegangen. Ben war noch ein Kleinkind gewesen, trotzdem war er der Erste, der seinen Strumpf vom Küchenherd pflückte und uns mit seinem begeisterten Gejohle weckte. Lachen und Fußgetrappel hallten durch das Haus. Damals hingen sechs prall gefüllte Strümpfe am Kamin; vollgestopft mit Nüssen, Zuckerwerk, selbstgestrickten Mützen, Murmeln für die Jungen und Puppenkleider für die Mädchen. Meine Geschwister strahlten um die Wette, als sie die Kostbarkeiten herausschälten, und brachen dann in lautstarke Zankereien aus. Wer hatte die besten Geschenke bekommen? Unsere Eltern standen zufrieden lächelnd im Türrahmen und hielten sich an den Händen. Diese Geste hatte mir Tränen in die Augenwinkel getrieben. So eine Zärtlichkeit zeigten sie vor uns Kindern sonst eigentlich nie. Beim Gedanken an das damalige Festessen aus Braten, Wildbret, Weizenbrot, Apfelkuchen und Brotpudding, das auf uns gewartet hatte, lief mir das Wasser im Mund zusammen. Mein Magen knurrte hungrig. Ich schlug die Lider auf und sprang aus dem Bett. Eine unsinnige Hoffnung brannte in mir.
Natürlich hingen heute nur die drei Strümpfe am Kamin, die wir gestern Abend aufgehängt hatten. Charlotte hatte erklärt, dass sie als verlobte Frau zu alt für Kinderbräuche sei. Jeweils eine einzelne Zuckerstange ragte aus dem Bund und nur Bens Socke wies eine kleine Beule auf. Zögerlich trat ich näher. Ben flitzte an mir vorbei und zog den Gegenstand heraus. Es dauerte einige Augenblicke, bis meine Fantasie eine geschnitzte Kanone hineininterpretiert hatte. Mein kleiner Bruder starrte auf das Ding und drehte es unschlüssig in den Händen. Das Kanonenrohr war kunstvoll geformt. Auch ein großes Rad mitsamt filigranen Speichen war fast vollendet. Doch das zweite war verschnitten und der Teil dazwischen steckte noch im unbearbeiteten Rohholz.
»Ich hab versucht, es fertigzustellen, aber meine Hände sind dafür nicht geschaffen.« Mas erstickte Stimme klang von der Tür. Sie strich über einen verkrusteten Schnitt an ihrem Zeigefinger, wahrscheinlich ohne es zu merken.
»Das macht nichts.« Ben lächelte tapfer. »So eine hab ich mir schon lang gewünscht!«
Still ließ er sich vor dem Kamin nieder und positionierte die Kanone so, dass sie auf die ungeschützten Fußsoldaten zeigte. Er stieß ein Knattern aus und ließ eine Holzfigur nach der anderen umkippen. Seelenruhig stoppte er dann den Beschuss, stellte jeden Soldaten wieder auf seinen Posten und begann von vorne. Wir Älteren suchten den Blick unserer Ma, die zu Boden blickte.
»Heuer hatten Vater und ich keine Zeit, auch für euch etwas zu besorgen.« Dann wurde sie wieder resolut wie früher. »Mary, du hilfst mir beim Brotbacken. Nicky, fache das Feuer an und bring danach mehr Holz von draußen – das musst du vorher aber noch zerkleinern. Mach die Scheite diesmal wenigstens ungefähr gleich lang! Charlotte, ich glaube, wir haben kein Wasser mehr im Haus – hol’ Eis vom Brunnen und lass es am Herd schmelzen.«
Kurze Zeit später stach mir der rauchige Geruch nach frisch entzündetem Feuer in die Nase und die Augen. Stolz blickte ich in die knisternden Flammen, deren Wärme meine kühlen Backen traf. Ich hatte einen dicken Ast als Stütze für die Späne verwendet. Obwohl die Scheite leicht klamm gewesen waren, war es mir mit nur einem Schwefelholz gelungen, sie zum Leben zu erwecken. Einen Moment wartete ich noch, bis das Feuer so kräftig war, dass es nicht mehr ausgehen würde. Dann schob ich noch zwei Prügel nach und legte das verbleibende Holz neben den Ofen, damit die anderen Nachschub hatten, wenn die erste Ladung heruntergebrannt war. Danach zog ich mir meinen Mantel über.
Draußen trieb ein Windhauch Herden aus losem Schnee über die Ebene. Obwohl es schon spät am Morgen war, war es noch düster. Ein Blick zum Himmel bestätigte meine Befürchtung. Grauschwarze Wolken türmten sich dort oben und kündeten einen Sturm an. Verbissen machte ich mich an die Arbeit.
Während ich Scheit um Scheit spaltete und meine Oberarme anfingen zu schmerzen, drehten sich meine Gedanken wie der Schneewirbel. Was sollten wir essen, bis der Krieg vorbei war? Für ein paar Tage hatten wir noch Vorräte, doch dann mussten wir in die Stadt zum Einkaufen. Nur war die Dose mit unserem Ersparten leer bis auf einen Blechknopf. Über die Monate hatten wir alles verkauft, was wir nicht zum Überleben benötigten. Zum hundertsten Mal ging ich die Dinge durch, die infrage kamen. Das Gewehr brauchten wir! Freddy und Konsorten lauerten immer noch irgendwo in unserer Nähe und konnten jederzeit wieder auftauchen. Beim nächsten Angriff würde ich mich ihnen stellen!
Axt, Messer und Nähnadeln konnten wir genauso wenig entbehren. Vielleicht den Schecken oder Daisy? Allein bei diesem Gedanken wurde mir schlecht.
Sollte ich losreiten und nach James und Andrew suchen? Meine Brüder würden wissen, was zu tun war. Ich stellte mir vor, wie ich sie nach endloser Suche fand und mitten in ihr Lager ritt. Der Gedanke an hunderte Soldaten, die sich um mich drängten, jagte mir einen Schauer über den Rücken. Danach müsste ich meinen Brüdern gegenübertreten und vom Überfall berichten – und von meinem Versagen.
Nein! Solange Freddy Johnson in der Gegend herumstrich, konnte ich meine Familie nicht allein lassen. Selbst wenn ich gewusst hätte, wo sich James und Andrew im Moment aufhielten, hätte ich nicht weggekonnt. Aber es war Monate her, seit wir das letzte Mal von ihnen gehört hatten. Irgendwie musste ich es aus eigener Kraft schaffen.
Meinem Magen zufolge war es Zeit fürs Mittagessen. Ich verstaute das Beil und belud mich mit ein paar Holzscheiten. Der Wind war jetzt so stark, dass ich mich auf dem Rückweg zum Haus gegen die schneidende Kälte stemmen musste. Es war beinahe nachtschwarz und immer wieder trafen mich aus dem Nichts Eiskristalle im Gesicht. Ein scharfer Schmerz durchzuckte meine Wange. Reflexartig drehte ich mich weg und schloss die Augen. Die Wunde, die das Gestrüpp vor wenigen Tagen in meinem Gesicht hinterlassen hatte, brach auf und warme Flüssigkeit lief meine Backe hinunter bis zum Kinn. Ich blinzelte – und sah in vollständige Dunkelheit. Panik kroch in mir hoch. Fast hätte ich das Holz zu Boden fallen lassen und wäre losgelaufen. Aber in welche Richtung? Ich zwang mich, ruhig zu atmen, balancierte das zentnerschwere Holz auf einem Arm und streckte vorsichtig den anderen nach vorne. Leere. Dann raue Bretter. Tastend folgte ich der festen Hauswand. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte ich den Eingang und stolperte hinein. Mary kreischte los und Charlotte sprang geistesgegenwärtig auf und schlug die Tür hinter mir ins Schloss.
Wärme und der Duft nach frisch gebackenem Brot hüllten mich ein. Eine Laterne am Tisch warf ihr flackerndes Licht in den Raum. Ausnahmsweise war ich heilfroh, innerhalb der schützenden vier Wände zu sein. Ich klopfte den Matsch von meinen Stiefeln und lud die Holzscheite polternd in einem Stapel neben dem Herd ab.
Aufatmend schüttelte ich meine schmerzenden Arme und Schultern aus und setzte mich zu den anderen an den Esstisch. Charlotte drückte mir einen Becher mit kaffeeartigem Inhalt in die kalten Finger. Statt Kaffeebohnen verwendeten wir dafür gerösteten Roggen.
»Danke!« Ich lächelte ihr zu und blies in die heiße Brühe.
Schweigend saßen wir alle da, mit einem Stück warmen Maisbrots in der einen Hand, lutschten hin und wieder an unserer Zuckerstange in der anderen und lauschten dem Sturm, der unerbittlich an den Fensterläden rüttelte. Probeweise weichte ich das Brot im sogenannten Kaffee auf. Dadurch, dass es nur aus Mehl, Salz und Wasser bestand – den einzigen Lebensmitteln, die noch in unserem Vorratskeller lagerten – war es schwer zu kauen. Mit Bedauern dachte ich an den Leichenschmaus vor wenigen Tagen. Diese Leckerbissen waren ursprünglich für das heutige Festessen reserviert gewesen.
Ein Klopfen ließ uns zusammenzucken. Wir tauschten Blicke und hofften, uns verhört zu haben. Erneutes Pochen. Lauter diesmal und mit mehr Nachdruck. Zögernd stand Charlotte auf. Ich folgte ihr und griff nach der geladenen Flinte über der Tür, während sie den Riegel zurückschob. Das Heulen des Windes verschluckte das Klicken, als ich das Gewehr entsicherte.
»Was wollen Sie, Mister?«, fragte Charlotte.
Die Antwort ging im Sturm unter.
»Kommen Sie herein. Mit erhobenen Händen und ganz langsam.«
Ich hielt den Lauf auf den Spalt gerichtet. Charlotte öffnete die Tür und wich zurück. Aus dem Dunkel schälte sich die Gestalt eines Mannes. Seine zusammengewürfelte Uniform war mit Schnee verkrustet, der rechte Ärmel knapp unterhalb der Schulter verknotet. Obwohl sein Gesicht unter der Hutkrempe im Schatten lag, kam er mir bekannt vor.
»Danke Ma’am, dass Sie mich hereinbitten.«
Der Spott war beinahe vollständig aus seiner Stimme verschwunden. Trotzdem erkannte ich sie sofort. Bill.
»Was wollen Sie von uns?«, wiederholte Charlotte drohend.
Ich ließ ihn keinen Wimpernschlag aus den Augen.
»Der Sturm hat mich überrascht«, sagte er kleinlaut. »Ich bin froh, zufällig auf Ihr Haus gestoßen zu sein …«
Von wegen Zufall! Wahrscheinlich war er wieder auf einer Beobachtungs- und Sabotagemission.
Charlotte war ebenfalls misstrauisch, aber die Höflichkeit siegte. »Legen Sie doch Ihren Hut und Mantel ab und setzen sich zu uns.«
Fünf Augenpaare verfolgten, wie der Neuankömmling neben seinen Kleidungsstücken auch langsam seinen Revolvergurt abschnallte und daneben hängte. Ein stummes Angebot zum Waffenstillstand. Zur Antwort stellte Charlotte eine große Blechtasse mit dampfender Flüssigkeit und ein Stück Brot vor ihn auf den Tisch.
Erkannte sie denn nicht, dass er beim Überfall dabei gewesen war? Wie konnte ich es ihr und Ma unauffällig mitteilen? Aber dann müsste ich gleichzeitig gestehen, dass ich den Angriff beobachtet und nichts unternommen hatte. Hatten der Rest meiner Familie überhaupt mitbekommen, dass die Mordbrenner Delilah bei uns auf der Ranch gefunden hatten?
In angespanntem Schweigen verfolgten wir jede Handbewegung unseres Gastes und lauschten dem genüsslichen Schlürfen, Schmatzen und Rülpsen. Für meinen Geschmack machte er eine zu große Schau um das karge Mahl. Nach und nach zupften auch wir wieder an unseren Broten. Schüchtern hielt Ben dem Fremden seine noch ganz ansehnliche, wenn auch nass glänzende Zuckerstange hin. Dieser lehnte mit einem Grunzen ab.
Bald war auch der letzte Krümel verzehrt, der Sturm aber wütete mit unverminderter Leidenschaft. Keiner wagte, sich zu erheben. Ben schlug rhythmisch mit seinem Fuß gegen ein Tischbein. Die Anspannung war eine fast sichtbare Besucherin im Raum. In aller Ruhe wischte sich Bill mit dem Ärmel über den Mund; seufzte zufrieden; griff in seine Tasche. Wir hielten die Luft an.
»Jemand Lust auf ’ne Runde Poker?« Er klopfte mit den Karten auf den Tisch, während er uns abschätzend der Reihe nach musterte.
Unsere Blicke glitten automatisch zu Ma. Als ob sie die Frage nicht gehört hätte, erhob sie sich, ließ sich in ihrem Schaukelstuhl am Feuer nieder und nahm ihr Strickzeug zur Hand. Das war wohl eine Zustimmung. Wie sollte ich ihr nur mitteilen, dass wir hier einen gewaltigen Fehler begingen? Dass wir uns in Gefahr befanden?
Meine Geschwister scharten sich eifrig um Bill und seine Karten – selbst Charlotte, die großen Wert auf Moral und Anstand legte, was Glücksspiel eindeutig ausschloss. Normalerweise. Ich konnte es ihnen nicht verübeln. Das Leben fern der Stadt bot kaum Abwechslung. Besonders jetzt im Winter waren wir oft tagelang ans Haus gefesselt und die Stunden zogen sich in die Länge. Unauffällig stellte ich mich zwischen den Mann und seine Waffe am Haken. Wenigstens würde ich es ihm nicht leicht machen. Egal was er insgeheim plante.
»Sind Sie Profispieler?«
Bill lachte rau über Bens unschuldige Frage. »Einarmige Profispieler gibt es nicht. Habt ihr irgendwas, das wir als Einsatz verwenden können?«
Unschlüssig sahen wir in die Runde.
Plötzlich leuchtete Marys Gesicht auf. »Wir haben Knöpfe!« Sie sprang auf und kam mit einer Handvoll davon zurück. Bill schaute zuerst etwas ungläubig, akzeptierte die Währung dann aber kommentarlos und reichte das Deck zunächst an Charlotte zum Mischen. Geschickt teilte er die Karten einzeln direkt vom Stapel aus.
Es dauerte, bis wir uns alle Symbole und Farben eingeprägt hatten und verstanden, welche Kombinationen andere übertrumpfen konnten. Dann aber ging es hoch her. Selbst ich ließ mich von der allgemeinen Aufregung anstecken. Charlotte schlug meine Zwillinge mit einem Full House, musste sich aber Bens Flush geschlagen geben. Mary verlor jedes Spiel, weil ihr Gesicht aufleuchtete, wenn sie passable Karten bekam, oder sie eine Schnute zog, wenn ihr das Glück nicht hold war. Trotzdem hatte ich sie selten so zufrieden erlebt. Charlotte konnte sich am besten von uns merken, welche Bilder wichtig waren, und ihre Miene verriet ihr Blatt nicht mal ansatzweise. Manchmal beobachtete ich, wie sie Ben den Vorzug ließ, obwohl sie ihn mit links hätte schlagen können. Wegen seines verkrüppelten Arms musste Bill seine Karten verdeckt vor sich legen. Trotzdem gewann er die Knöpfe am häufigsten für sich. Dabei schaffte er es irgendwie, uns zu unsinnig hohen Einsätzen zu bewegen. Nach einiger Zeit lag der gesamte Haufen vor ihm.
»Wollt ihr noch mal?«
Die Frage erübrigte sich. Natürlich wollten wir!
»Na, dann zeige ich euch vorher noch ein paar Tricks, wie ihr euren Gewinnchancen ein wenig auf die Sprünge helfen könnt.«
Zum Glück überhörte Ma die Bemerkung. Kartenspielen mochte sie noch tolerieren; Schummeln hätte das Fass zum Überlaufen gebracht.
Los ging es mit dem Mischen. Bill ließ es uns der Reihe nach versuchen und forderte uns dann auf, uns zu merken, wo bestimmte Karten im Deck steckten. Am schnellsten fand ich immer die Kreuz Neun, weil sie an einer Ecke eingeknickt war. Es war gar nicht so einfach, unauffällig unter die Karten zu linsen. Irgendwann gelang es mir aber leidlich, genauso wie die obersten und untersten Karten an ein und derselben Position im Stapel zu lassen.
»So. Es ist Zeit zum Schlafen!«, schritt Ma irgendwann ein.
Verblüfft blickten wir auf. War es schon so spät? Der Sturm musste sich vor Stunden gelegt haben. Von draußen klang kein Laut mehr herein.
Bill sammelte die Karten ein, erhob sich halb vom Tisch, doch dann ließ er sich auf den Stuhl zurücksinken. Sein Ausdruck war plötzlich grimmig.
Er blickte uns alle der Reihe nach an. »Nehmt euch vor Freddy Johnson in Acht!«
Sofort sah ich das bleiche Gesicht mit den kalten blauen Augen vor mir. Die wehenden weißblonden Haare. Mir stellten sich die Härchen im Nacken auf.
»Der Mann ist nicht ganz richtig im Kopf. Das müsst ihr verstehen! Im Krieg gegen Mexiko hat er mitansehen müssen, wie mexikanische Soldaten seine Mutter und seine Schwestern geschändet und ihnen danach die Kehle durchgeschnitten haben. Damals war er keine zehn Jahre alt und am Ende haben sie auch ihm den Hals aufgeschlitzt. Es grenzt an ein Wunder, dass er überlebt hat. Nachdem seine Wunde verheilt war, ist er losgezogen, um an der Seite seines Vaters gegen die Mexikaner zu kämpfen. Er stand direkt daneben, als sein alter Herr von einer Kanonenladung zerfetzt wurde.«
Wir schwiegen betroffen.
»Der arme Junge«, flüsterte Charlotte erstickt.
»Von wegen arm!«, zischte Mary. »Er hat Pa ermordet!«
»Was hat er eigentlich gegen uns?«, wagte ich, die Frage zu stellen, die mich seit dem Überfall quälte. »Dass er Mexikaner nicht mag, kann ich verstehen. Aber warum wir?«
Bill zuckte mit den Schultern. »Freddy verübelt es den Vereinigten Staaten, dass sie Texas annektiert haben. Sie haben der Republik Texas die Unabhängigkeit genommen und den zweiten Krieg gegen Mexiko begonnen. Er hasst jeden, der nach Texas eindringt und die gleichen Rechte fordert wie die Siedler, die hier seit Jahren leben und das Land den Mexikanern, Komantschen und der unbarmherzigen Natur mit Blut und Schweiß abgerungen haben. Deshalb ist er auch beim Heimatschutz, statt für die anderen Staaten des Südens an der Front zu kämpfen.«
Quietschend schob Bill seinen Stuhl zurück und stand auf. »Vielen Dank nochmals für Ihre Gastfreundschaft, Mrs. Albright! Die Karten könnt ihr behalten, Kinder.« Er zwinkerte uns mit einem traurigen Lächeln zu. »Gute Nacht, Ma’am.«
Gelassen nahm er Hut, Mantel und Revolver vom Haken. An der Tür drehte er sich noch ein letztes Mal um. »Übrigens. Was ich noch hinzufügen sollte: Im Januar schließt sich Freddy Johnson jetzt doch der regulären Armee an. Er hat eingesehen, dass er Texas nur retten kann, wenn der Norden nicht gewinnt – und leider sieht es gerade nicht gut aus für unsere Seite. Wenn ihr also bis Januar durchhaltet, habt ihr vorerst nichts mehr zu befürchten.«
Bevor wir ihn mit weiteren Fragen bombardieren konnten, verschwand Bill in die Nacht.