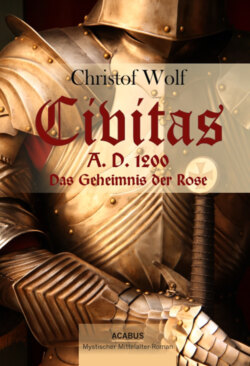Читать книгу Civitas A.D. 1200. Das Geheimnis der Rose - Christof Wolf - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LEXEMÜHLE
ОглавлениеNatürlich hielt es keinen der Mühlenbewohner lange im Bett. Die Baumwipfel der mächtigen Buchen des Kirchhölzchens lagen noch im Dunkeln. Als Kirchhölzchen bezeichnete man den großen Kirchenwald, an dessen Rand der Holzbach entlang floss und die Lexemühle lag. Auf der einen Seite versorgte sich die Eigentümerin, also die Kirche, zum Bau und Erhalt ihrer Gebäude mit dem Holz daraus, auf der anderen Seite war es den Einwohnern Severus’ gestattet, dass sie sich an abgeschlagenen Ästen bedienen konnten und Kleingehölz zum Anfachen ihrer Feuerstellen aufklauben durften.
Neben dem Gemurmel der Mägde waren auch bereits Emma und die Mädchen in der Küche zu hören. Das Stimmengewirr der Knechte im Mühlenhof, die üblicherweise vor Sonnenaufgang bereits mit dem Füttern begannen, schien heute ein wenig lauter als sonst. Das wiederum lag daran, dass niemand den Stall betreten durfte, bevor der Müller die Erlaubnis dazu erteilt hatte. So versammelten sie sich alle im Hof. Auch die beiden Söhne der Familie standen bereits dabei und warteten darauf, dass Arthur den Stall öffnete. Natürlich wollte jeder dabei sein und einen ersten Blick auf den Fremden werfen. Ob er überhaupt noch lebt? Das Getuschel und Gemurmel war groß. Es erstarb jedoch abrupt, als Arthur aus dem Haus kam, seine Hose zurechtzog und die dicke Wolljacke zuknöpfte. Es war lausig kalt, denn der sternenklare Himmel hatte noch einmal für Frost gesorgt. Raureif zierte die Dächer und die Atemschwaden der Menschen auf dem Hof umhüllten ihre Gesichter wie weiße Wattebausche. Nun aber schienen die Sterne zu verblassen und der aufgehenden Sonne Platz zu machen, die sich mit einem rotbläulichen Morgenhimmel ankündigte.
Zur Enttäuschung aller ordnete Arthur an, dass der erste Blick in den Stall ihm und vor allem Antonius zustehen würde. Schließlich sei dieser es gewesen, der die wundersame Gestalt in der Holzbachklamm gefunden habe. Außerdem mahnte er seine Leute, dass dies nicht ein Jahrmarktspektakel sei, sondern dass es sich hierbei um ein Unterfangen handelte, dass sehr schnell äußerst gefährlich werden könnte. „So wie der Kerl aussah, kann es durchaus sein, dass es sich um einen Verbrecher handelt!“ Die Frauen schrien erschrocken auf, während die Blicke der Männer entschlossener denn zuvor waren.
Nach einem ersten zaghaften Blick durch einen Spalt schloss Arthur die Stalltür sofort wieder. Er erkannte, dass die Helligkeit nicht ausreichen würde, sich sicher umzuschauen. Aus bekannten Gründen wollte er keine Fackel verwenden. Deshalb ordnete er an, sicherheitshalber so lange zu warten, bis der Pferdestall vom Tageslicht genügend ausgeleuchtet wurde. „So können wir vermeiden, dass wir einem hinterhältigen Angriff zum Opfer fallen!“ Sie vertagten sich für eine weitere Stunde. Während die Müllerfamilie im Haus ein gemeinsames Frühstück einnahm, verrichteten die anderen ihre außerhalb des Stalls zu erledigenden Arbeiten. Eine Stunde später war es dann schließlich soweit. Sie versammelten sich erneut. Arthur ließ den beiden kräftigsten Knechten, Berthold und Kerbel, eine frisch geschärfte Axt aushändigen. Zwei weitere Männer postierten sich rechts und links der Tür mit zwei hölzernen, aber nadelspitzen Mistgabeln. Es war von großem Vorteil, dass der Stall lediglich über einen Ausgang verfügte, der zum Hof hinaus führte. Somit müsste der Fremde, sollte er sich über Nacht tatsächlich aufgerappelt haben und fliehen wollen, auf jeden Fall an ihnen vorbei. Deswegen schickte Arthur seine Töchter in das Hauptgebäude. Nur unter großem Protest räumten sie das Feld und verzogen sich samt ihrer Tante Marga und ihrer Mutter in die Küche.
Arthur selbst verzichtete auf eine Waffe, forderte aber seine beiden Söhne auf, ihm mit ihren geschärften Messern, Sonderanfertigungen von Albert, zur Seite zu stehen. Vorsichtig löste er den Metallriegel und schob erneut die schwere Holztür, die sich nach innen öffnete, auf. Warme Luft und der vertraute süßliche Geruch der Pferde, insbesondere von deren kugelförmigen und dampfenden Exkrementen, schlugen ihnen entgegen. Der einfallende goldfarbene Lichtstrahl leuchtete das provisorische Krankenlager aus. Nachdem sich die Augen an das Düstere gewöhnt hatten, erkannten sie den Unbekannten, der mittlerweile wie ein Hund im Stroh zusammengekauert lag. Vorsichtig senkte zunächst Antonius, der direkt hinter seinem Vater stand, dann auch Albert seine Waffe. Leise traten sie, ihrem Vater auf dem Fuße folgend, in den Stall.
„Herr, könnt Ihr mich hören?“ Arthur versuchte es, um ihn nicht zu erschrecken, zunächst mit leisen Tönen. Als sich nichts tat, hob er seine Stimme, doch noch immer konnten sie keine Reaktion feststellen.
Plötzlich aber drehte sich der Körper des groß gewachsenen Mannes nach links und rechts. Sein Kopf schleuderte von der einen zur anderen Seite.
„Nei-i-i-n!“ Eine gequälte Stimme entglitt dem Geschöpf, die trotz aller Mutmaßungen vom Vorabend mehr einem Menschen als dem Leibhaftigen glich. „Blut! Überall Blut! Tötet sie, sonst werden sie euch töten! Tötet sie, im Namen des Herrn! Semper victrix!“ Sein Kopf wackelte immer noch heftig hin und her. Wieder und wieder rief er seine lateinische Losung: „Immer siegreich!“ Seine Augen waren halb geöffnet. Das Weiße der Augäpfel schimmerte unheimlich hervor und wurde dadurch verstärkt, dass der Rest seines Gesichts sonnengegerbt und nahezu mit Bart und Haaren zugewachsen war. „Sie reißen euch das Herz heraus! Sie werden es essen! Lasst es nicht zu! Bruder, sei auf der Hut! Rette die Ourida!“
Plötzlich verstummte sein Gebrabbel und Geschrei – es sah aus, als sei er wieder in einen tiefen Schlaf gefallen. Schweißperlen rannen seitlich von seiner Stirn. Die Lider seiner Augen flatterten. Sie bewegten sich auf und ab, als wollte irgendetwas sie von innen mit aller Gewalt geschlossen halten.
„Er fiebert! Wir müssen ihn von seinen Kleidern befreien und die Haut untersuchen. Vielleicht hat er doch irgendwo eine Wunde davongetragen, in der sich nun der Brand festsetzt“, sprach Albert. Gemeinsam traten sie auf ihn zu und knieten vor ihm nieder. Gerade wollte Arthur versuchen, ihm den Mantel auszuziehen, als der Mann sich, wie von Geisterhand nach oben gezogen, aufsetzte, die drei Männer, die vor ihm knieten, begutachtete und sagte: „Brüder der Rose, erhebt euch! Ich danke euch, dass ihr gekommen seid, um ihr zu huldigen.“ Dann folgte ein erschreckendes und angsteinflößendes „Tötet die, die ihrer nicht wert sind! Tötet die Ungläubigen! Rettet die Ourida!“ Unvermittelt und begleitet von einem kräftigen Seufzer sackte der Leib, der eben noch so dynamisch nach vorne geschnellt war, erschlafft in sich zusammen. Die drei Helfer schauten einander skeptisch an. Unisono erklang: „Wundbrand!“
Mit vereinten Kräften setzten sie die am gestrigen Abend nur oberflächlich begonnene Untersuchung des Fremden fort. Sie begannen, den schlaffen und bewusstlos wirkenden Körper nach rechts und dann nach links zu drehen. So gelang es ihnen, ihm den braunen Leinenmantel auszuziehen. Ein weiteres Kleidungsstück kam zum Vorschein – ein Mönchshabit. Im Originalzustand schien dieser einmal weiß gewesen zu sein. Unter diesem Überwurf trug der bewusstlose Reiter ein relativ leichtes Kettenhemd mit Kapuze, das von bester Qualität zu sein schien. Albert nahm prüfend einige Maschen des Eisenkonstrukts zwischen Zeigefinger und Daumen und kam nicht umhin, das Werk in den höchsten Tönen zu loben.
Als nächstes zogen sie ihm den Reiterhandschuh aus. Diesen schien sein Träger selten abgenommen zu haben. Das erkannten sie daran, dass die Hand fast schneeweiß schimmerte, während sein Gesicht und seine andere Hand von der Sonne tief braungebrannt waren. Die Fingernägel schienen regelmäßig gepflegt worden zu sein. Alle Nägel waren gleichmäßig gestutzt – bis auf den kleinen Finger, dessen weißes Nagelende fast einen guten Zentimeter maß. Am Ringfinger prangte ein Ring aus gedrehten oder geflochtenen Goldfäden. Ein großes, ebenfalls in Gold gefasstes Siegelrelief aus einem weißgrünlichen Stein war zu sehen. Die Gravur zeigte, umrandet von Schriftzeichen, die den Mühlenbewohnern überhaupt nichts sagten, zwei bewaffnete Reiter. Jeder war mit einem Schild ausstaffiert.
„Moment mal!“, stutzte Arthur, der an seinem Augenlicht zweifelte. „Sitzen die da auf einem oder auf zwei Pferden?“ Albert nahm die Hand und zog den Ring ein wenig ins Licht. Dann bestätigte er seinem Vater, dass es sich tatsächlich nur um ein Pferd handelte. Langsam legte er die Hand wieder ab und begann gemeinsam mit Antonius, den oberen Verschluss des Kettenhemdes zu lösen. Sein Geschick für handwerkliche Dinge, die mit Eisen und dergleichen zu tun hatten, half ihm dabei. So gelang es ihnen, den engen Kragen ein wenig zu lockern.
„Vielleicht sollten wir ihm erst einmal den Umhang ausziehen!“, schlug Antonius vor, wobei sein Augenmerk immer wieder auf den vergilbten Kittel fiel. „Der ist so schmutzig, dass er, wenn wir ihn dort in die Ecke stellen, mit Sicherheit vor Dreck stehen bleibt.“ Irgendetwas störte ihn daran, doch er wusste nicht, was es war. Albert half ihm, die Gürtelschnalle zu lösen. Vorsichtig hoben sie den Kopf des Mannes und befreiten ihn von dem Überwurf. Antonius erhob sich. Als er das verschmutzte Kleidungsstück zusammenlegen wollte, erkannte er, was ihm so unterschwellig aufgefallen war. Vorsichtig drehte er den Umhang um und erspähte ein Zeichen auf der Innenseite. Dieses hatte zuvor durch den Stoff geschimmert und war nur vage auf der Brust des Reiters zu erkennen gewesen. Anscheinend trug dieser den Habit absichtlich falsch herum. Wollte er ihn vor Verschmutzung schützen oder hatte er gar etwas zu verbergen? Auf jeden Fall zeigte es ein eindeutiges Symbol: Ein achtspitziges rotes Kreuz – ein sogenanntes Tatzenkreuz. Dieses hätte sich auf der Herzseite befunden, wenn der bewusstlose Mann seinen Umhang richtig herum getragen hätte.
„Ein Kreuz. Vielleicht handelt es sich doch um einen Mönch!“, rief Antonius.
„Vielleicht sollten wir ihn ins Kloster bringen“, schlug Albert vor.
„Ein Gottesmann!“, atmete Arthur erleichtert auf. Er war froh, das christliche Symbol zu sehen. Im Stillen hatte er sich bereits ausgemalt, welch wüstes Wesen, welch grausame und exotische Kreatur sein Sohn da angeschleppt hatte und wie er seine Familie vor diesem Geschöpf beschützen könnte.
„Wartet! Ich bin mir nicht ganz sicher“, warf Antonius plötzlich ein, „aber der Gregor hat mir erzählt, als wir uns gestern über diesen mysteriösen Reiter unterhielten, dass es eine ganz bestimmte Sorte von Mönchen gibt. Nein, vielmehr seien es eher Ritter, die sich dazu berufen fühlten und es sich zur Aufgabe gemacht hätten, die vielen Pilger zu beschützen, die in das Heilige Land gehen und dort an den Orten beten, an denen Jesus gewirkt hat. Ihr kennt die Bibelgeschichten, die uns die Mönche aus Sankt Severus immer erzählen. Ja, und diese Ritter schützen nicht nur die Pilger, sondern auch die Orte vor den Ung… Ungeheuern. Gregor erzählte aber auch, dass einige Kreise innerhalb der Kirche oftmals gar nicht so gut auf diese Rittersleute zu sprechen wären. Sie seien zu mächtig geworden, oder so.“ Die anderen schauten Antonius verwundert an ob dessen Weisheiten. „So hat es der Gregor erzählt!“, verteidigte dieser sich unbewusst. „Vielleicht ist dieser Mann hier solch ein Ritter? Immerhin trug er ein Schwert bei sich, als er an mir vorbeiritt!“
„Allerdings gleicht er jetzt eher einem Bettelmönch – so abgerissen wie er aussieht!“, ergänzte Albert. Sie lachten gelöst. Das rote Kreuz und Antonius’ Theorie, die auf Gregors Wissen basierte, beruhigten sie ein wenig. Der Knecht Gregor genoss in ihren Kreisen den Ruf eines weisen Mannes. Er arbeitete und lebte seit Jahren auf dem Hof der Nähers. Dort traf und sprach er tagein tagaus zahlreiche Leute von nah und fern. Und diese erzählten ihm die interessantesten Geschichten, unglaublichsten Anekdoten und fantastischsten Mären. Ja, Gregor war bestens über die Welt da draußen, also die hinter der Handelswegkreuzung bei Seckaha, aufgeklärt.
„Ich werde noch einmal in die Schlucht aufbrechen, vielleicht finde ich das Schwert des Reiters! Und wenn ja, dann marschiere ich gleich zum Hof weiter und frage Gregor, was er von der ganzen Geschichte hält.“ Antonius hoffte auf einen relativ entspannten Tag in der Klamm, der sich zudem prima um einen nicht ganz uneigennützigen Kurzaufenthalt auf dem Näherschen Hof ergänzen ließe. Natürlich spekulierte er auch darauf, bei dieser Gelegenheit einen kurzen Blick auf Elisabeth werfen zu können.
* * *
Immer wenn Antonius auf den Hof der Nähers kam, nutzte er auch gleich die Gelegenheit, sich mit dem Hauptknecht Gregor zu unterhalten. Beide verstanden einander gut. Stets nutzten sie die Zeit des Ab- und Beladens, was Gregor auf seine Arbeiter delegieren konnte, und unterhielten sich ausgiebig. Natürlich drehte es sich bei ihren Gesprächsthemen, wie von gestandenen Mannsbildern nicht anders zu erwarten, stets ums Weibsvolk. Genauer gesagt, ging es hierbei nicht um irgendwelche Frauen, sondern beide buhlten um zwei ganz bestimmte Exemplare.
„Hast du sie noch einmal gesehen?“, war Antonius’ Standardfrage, wenn er auf Gregor traf. „Wie geht es ihr? Sah sie hübsch aus?“ Allerdings war dieser so geschickt, dass er stets nur eine Frage beantwortete und erst weitere Informationen preisgab, wenn Antonius ihm von seiner eigenen, heimlichen Herzdame berichtet hatte. Aufgeregt, wie kleine Jungen beim Froschfangen, saßen sie dann beieinander und tauschten ihre Neuigkeiten aus. Sie tuschelten und bemühten sich ihr Geheimnis, so gut es ging, zu hüten.
„Ja, ich habe sie gesehen. Sie ist gestern über den Hof gegangen. Eigentlich, wenn ich mir das genauer überlege, dann ist sie vielmehr eines Engels gleich über den selbigen geschwebt!“ Gregor war um einiges älter als Antonius und liebte es, seinen jüngeren Freund aufzuziehen. Er wusste ganz genau, wie er diesen mit vagen oder fantasiereichen Andeutungen und Auskünften so herrlich auf die Folter spannen konnte. Hibbelig wie ein Welpe hielt es Antonius dann kaum auf der Mauer aus. Meist war er so aufgeregt, dass er aufstand, im Kreis ging und sich wieder setzte. Sah sie glücklich aus? Trug sie ihr weizenblondes Haar offen über ihren Schultern? Antonius überkam stets die Angst, er könnte eine seiner Fragen vergessen. „Oder hat sie es hochgesteckt, wie es diese vornehmen Damen tun?“ Gregor hob dann stets seine Schultern.
„Du weißt, mein Lieber, jeder immer nur eine Frage! Jetzt bin ich dran.“ Gregor wusste, der Wissensdurst des Jünglings schien unerschöpflich, doch auch ihn interessierte das Wohlbefinden seiner Herzdame. Somit hatte Antonius zunächst auch Gregors Frage zu beantworten, so trivial sie ihm auch erschien. So liefen ihre Begegnungen stets gleich ab.
Gregor, mit seinen 32 Jahren ein betagter Herr, schwärmte seit Jahren für Antonius’ Tante Marga. Vor ein paar Jahren hatte er Dagoberth Näher zu einem offiziellen Besuch zur Lexemühle begleitet und lernte dort Arthurs Schwester kennen. Sie schien ungefähr so alt zu sein wie er selbst und saß während des Mittagsmahls neben ihm. Zunächst hatte er sie nur scheu aus den Augenwinkeln angesehen und konnte kaum damit umgehen, dass Marga sogleich die Gelegenheit nutzte und den sympathischen Knecht der Nähers ungeniert ansprach. Schon bald lachten und flachsten sie wie junge Leute. Seit diesem Tag war es um Gregor geschehen und er hatte sein Herz an Marga verloren.
Antonius’ Augenmerk lag hingegen auf Elisabeth – der jüngsten Tochter von Dagoberth Näher. Zwar pendelte Antonius bereits seit gut und gerne drei Jahren durch die Holzbachschlucht zum Hof der Nähers, doch erst im letzten Sommer hatte er sie das erste Mal bewusst wahrgenommen: Kruzi und Fix waren beladen worden und fertig zum Abmarsch. Antonius, der wie immer mit Gregor auf der Mauer der kleinen Steinbrücke an der Ausfahrt vom Hof saß, wollte gerade seinen Plausch beenden, als es ihn plötzlich fast in den Holzbach geworfen hätte. Nur einem Reflex folgend, konnte er sich mit Mühe an Gregors Arm festhalten. Auch dieser erschrak und sah wie der Blick seines jungen Freundes auf dem kleinen Balkon des Haupthauses verharrte.
Das mächtige Herrenhaus des Nähers stand unmittelbar am Holzbach. Neben den Öffnungen der Küche im unteren Geschoss, befand sich an der oberen Etage dieses zweistöckigen Steinhauses ein Holzbalkon – dieser ragte über den Bach hinaus. Eigentlich war er dazu gedacht, dass man den großen Raum im zweiten Stock bei Feierlichkeiten, die der Hofherr regelmäßig für wohlhabende Kaufleute abhielt, mit warmem Essen versorgen konnte. Sobald die Reden geschwungen waren und Trinksprüche ausgerufen wurden, galt dies als Zeichen für die Küchenmamsell Bertha, die Platten mit dem Braten und Gemüse auf das große Tablett zu legen. An diesem waren vier Seile befestigt, die sich in einen einzigen Strick verwoben. Dieser wiederum wurde von einem der Knechte per Flaschenzug zügig nach oben gezogen. Auf dem Balkon stand dann stets ein weiterer Bediensteter, der die Speisen entgegennahm und in das mit feinen Holzbohlen vertäfelte und mit Jagdtrophäen übersäte Zimmer trug. Eines Tages sah Antonius dabei zu, wie ein ganzes Wildschwein nach oben gehievt wurde. Dieses war nachmittags im Wald erlegt, waidmännisch aufgebrochen und anschließend sofort auf der offenen Feuerstelle in der Hofküche gegrillt worden.
Doch an einem ganz normalen Tag, wie es damals im Sommer einer gewesen war, stand plötzlich einer Heiligen gleich – wenngleich Antonius nicht genau wusste, wie eine Heilige eigentlich auszusehen hatte – die Tochter des Hofherrn auf dem Balkon. Sie stand da und bürstete ihr langes rotblondes Haar mit einem Kamm aus Horn. Gregor, dem Antonius’ Erregung nicht unbemerkt geblieben war, musste damals grinsen. Er ahnte, dass für künftigen Gesprächsstoff gesorgt war. Und er sollte Recht behalten. Fortan war es um Antonius geschehen.
* * *
So war es kein Wunder, dass sein Vater flugs den zweiten Grund für das freiwillige Vorhaben seines Sohnes entlarvte. Sogleich machte er ihm einen Strich durch die Rechnung – zumindest was den entspannenden Aspekt seines Tages betraf.
„Nun, wenn du eh außerhalb der Reihe zum Hof aufbrichst, dann kannst du gleich ein paar Säcke mitnehmen. Außerdem trifft sich das gut, so kann ich dir noch etwas von unserem feinsten Mehl mitgeben, dass du vielleicht gegen ein wenig von dem besseren Speck eintauschen kannst – bei deinen hervorragenden Beziehungen dürfte das für dich ja kein Problem sein!“ Arthur grinste. Schon seit geraumer Zeit wusste er, dass sein Sohn ein Auge auf die Tochter des Hauses geworfen hatte. Antonius kniff die Augen zusammen und ahnte, dass sein Vater ihn durchschaute. „Es wäre nicht schlecht, wenn wir unserem Gast – nur für den Fall, dass er die nächsten Tage noch unter uns weilt und sich wirklich als Ehrenmann erweist, etwas Gescheites anbieten können!“
Arthur zwinkerte seinem jüngsten Sohn zu. Er gab ihm so zu erkennen, dass er dessen eigentlichen Beweggrund, freiwillig noch einmal zum Hof aufzubrechen, durchaus erkannt hatte, und dass er, als er von dessen guten Beziehungen sprach, diesmal nicht die Freundschaft mit Gregor meinte. Schamesröte breitete sich über Antonius’ Gesicht aus. Er fühlte sich ertappt.
* * *
„Schützt Ourida!“ Alle wurden wieder aus ihren Gedanken gerissen und sahen zu dem verletzen Reiter. „Pauperes commilitones! Ourida! Seht die Assassinen! Blut! Tod!“
„Er hat hohes Fieber. Wir müssen sehen, dass er etwas Wasser zu sich nimmt.“ Arthur sorgte sich um das Leben des Mannes, der dort hilflos und im Fieberwahn vor ihm im Stroh lag. „Jetzt, wo wir wissen, dass er kein Räuber oder gar der Teufel ist, können wir ihn nachher auch ins Haus holen. Zunächst müssen wir jedoch nach dem Grund seines Fiebers fahnden. Los, Jungs, hebt ihn an, wir ziehen ihm sein schweres Beinkleid aus – auch seinen Wams. Berthold, flitz zur Müllerin und lass dir eines meiner Nachtgewänder geben! Das werden wir ihm anschließend anziehen. Und sag dem Weibsvolk in der Küche, es soll uns ein wenig heißes Wasser bringen. Wir müssen den Körper reinigen!“ Arthur führte das Regiment. Er war der Müller und somit Herr im Haus. Antonius trug er auf, die Pferde zu beladen und sich auf den Weg zu machen.
Als sie den Fremden zur Seite drehten, um ihn völlig zu entkleiden, sahen sie den Verursacher des Fiebers – eine Fleischwunde. Diese war bereits von einem rot bis dunkelblau schimmernden Brand umgeben. Sie roch ekelhaft. Albert stellte fest, dass sie fast so penetrant stank wie die verendete und aufgedunsene Wildsau, die sie letztens im Holzbach gefunden hatten, nachdem diese wahrscheinlich einige Tage zuvor beim Saufen durch das Eis gekracht und dann jämmerlich ersoffen war.
Antonius musste würgen und drehte sich flugs um, während sein Vater und Albert die Wunde näher in Augenschein nahmen. „Na, Vater, da ist aber schon ordentlich Leben drin!“ Arthur nickte und runzelte die Stirn. Sie wussten, was sie normalerweise taten, wenn eines der Tiere sich verletzt hatte und sich die weißen Fliegenlarven schon nach wenigen Stunden an der Wunde zu schaffen gemacht hatten. Doch was sollten sie jetzt und hier tun? Konnten sie ihre altbewährte Methode anwenden?
„Was meinst du, Albert, sollen wir es riskieren? Wird er das überleben?“ Albert überlegte. Von seiner mentalen Natur war er sehr robust, ganz abgesehen von seiner kräftigen Statur, mit Oberarmen so dick wie ein Pferdebein. „Bei den Pferden haben wir bisher immer Erfolg gehabt, aber ob es auch bei einem Menschen funktioniert?“
„Assassinen! Rettet euch! Rettet die Ourida!“ Der Reiter schien völlig im Delirium und warf seinen Kopf hin und her. Der Schweiß bedeckte seinen ganzen Körper. Hier und da flossen kleine Sturzbäche über die nackte Haut. Sie wussten, sie mussten handeln, wenn sie sein Leben retten wollten. Hannah brachte den dampfenden Eimer. Während Albert hinausging, um seine Vorbereitungen zu treffen, wies Arthur zwei seiner Bediensteten an, den Bereich um die Wunde herum zu waschen. Er nahm Hannah an die Hand, die wie gebannt auf den sich windenden Körper starrte, und führte sie aus dem Stall. Antonius folgte ihnen mit den bereits von den Knechten beladenen Kruzi und Fix.
„Pass auf dich auf und sieh zu, dass du nicht allzu spät nach Hause kommst!“ Antonius versprach es. Er verabschiedete sich und küsste seine Mutter auf die Wange, die ihm ein wenig Proviant brachte. Dann drückte er der kleinen Klara, die auf der Treppe stehen blieb, einen Schmatzer auf die Stirn und machte sich auf den Weg in die Schlucht.
Derweil bereitete Albert seine Wunderwaffe in seiner kleinen Schmiede vor. Mit dieser wollte er die Wunde behandeln und vor allem den kleinen, sich in ihr labenden Viechern den Garaus machen. Arthur holte seinerseits das schärfste Messer aus seiner Werkstatt und gebot dem Rest seiner Bediensteten, die bisher nur stumm um sie herumstanden, sich an die Arbeit zu machen. „Hier gibt es nichts mehr für euch zu sehen! Seht zu, dass ihr den Mühlstein zum Laufen bringt. Antonius wird heute zusätzliche Arbeit mit nach Hause bringen. Außerdem will Ignazius nachher noch mit seinem Gespann kommen. Er sagte beim letzten Mal, dass er zig Zentner Weizen aus seinem Kornspeicher mahlen lassen muss. Also, somit habt ihr keine Zeit, hier Maulaffen feilzuhalten. Schafft was für euer täglich Brot!“ Arthur war ein strenger, aber gerechter Hofherr und seine Bediensteten wussten dies. Sofort waren alle verschwunden. Arthur ging in den Stall zurück, wo er seines schweren Amtes walten wollte. Albert folgte ihm und trug seinen rot glühenden Spieß bei sich. Sie knieten sich neben den regungslosen Körper. Vorsichtshalber kontrollierten sie, ob überhaupt noch eigenes Leben in ihm war. Dann legten sie los.
Arthur versuchte dem Fremden ein Knäuel Leinen in den Mund zu zwängen, auf das er beißen sollte, doch nachdem es ihm nicht gelang, ließ er es weg. Noch einmal tief einatmend sah er seinem Sohn fragend und entschlossen zugleich in die Augen. „Was die Medizin nicht heilt, heilt das Eisen.“ Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat! Ein Ausspruch, den einer der Gottesmänner aus dem Kloster einst sagte, als er einen verletzten Ochsen zu Albert brachte und ihn bat, die Wunde entsprechend zu behandeln.
Beherzt setzte Arthur die blanke Klinge seines Messers, das Albert ihm in diesem Winter aus einem guten Stück Eisen geschmiedet und unglaublich scharf geschliffen hatte, gute zwei Zentimeter außerhalb des Wundbrandrands an und stach hinein. Die Haut sprang auf wie die Pelle einer gekochten Wurst. Das rosafarbene Fleisch, das zum Vorschein kam, schien gesund. Blut quoll hervor und rann an der Leiste des Verwundeten hinab. Zögernd schaute er den Bewusstlosen an, doch dieser schien die Operationshandlung nicht zur Kenntnis zu nehmen. Arthur drückte die Klinge tiefer und zog sie kreisförmig um die Wunde herum. Im befallenen Fleisch wimmelte und wuselte es. Die wurmartigen Schmarotzer ahnten anscheinend, dass es ihnen an den Kragen gehen sollte. Langsam löste Arthur das kranke Fleisch heraus – es stank barbarisch. Gleichwohl wunderte er sich, dass seine Handlung sich nicht viel von der Behandlung eines seiner Tiere unterschied. Als er den letzten Rest des verseuchten Gewebes herausgetrennt hatte, stand er auf, trat einen Schritt zurück und überließ Albert das weitere Vorgehen. Dieser sah Arthur fragend an, erkannte aber dessen Zustimmung, unterstützt durch ein leichtes Kopfnicken. Albert kniete nieder und flüsterte: „Der Herr stehe dir bei!“ Was Eisen nicht heilt, heilt das Feuer.
Gezielt und durch den Einsatz beim Vieh geübt, setzte er das rot glühende Eisen an. Es zischte. Dampf stieg auf. Ein Schmorgeräusch war zu hören. Geruch von verbranntem Fleisch breitete sich aus. Albert drehte die Stange einmal komplett an den Wundrändern entlang, bevor er es zum Schluss kurz in der Mitte einsetzte. Er war gerade fertig, als ein markiger Schrei ihm durch die eigenen Knochen fuhr. Der zuvor leblos daliegende Körper wurde in Sekundenschnelle aufgewuchtet. Die Augen des soeben noch bewusstlos scheinenden Mannes waren so weit aufgerissen, dass sie den Mühlsteinen im Keller Konkurrenz machen konnten. Die Hand mit dem Siegelring schnellte nach vorne, packte zielsicher Alberts Hals und drückte zu. Alberts Augen weiteten sich und traten hervor. Ehe er sich’s versah, verlor er die Besinnung und sackte zusammen wie ein nasser Jutesack. „Mich häutet ihr nicht! Semper victrix!“, rief der Angreifer, bevor auch er mit verdrehten Augen in sich zusammenfiel. Albert hustete und kam langsam wieder zu sich. „Ist er tot, Vater?“ Arthur beugte sich vorsichtig, um nicht auch zum Opfer zu werden, über das Gesicht des Mannes und schüttelte den Kopf.
„Ich denke, er wird jetzt erst einmal schlafen! Los, wir ziehen ihm mein Schlafgewand an und dann sollen Berthold und Kerbel ihn in die Gästekammer bringen.“ Dieses Zimmer hatte den Vorteil, dass die steinerne Rückseite der Küchenfeuerstelle sich in ihr befand, wodurch diese Stube gerade im Winter eine angenehme Grundtemperatur hielt.
Die beiden Knechte packten den teilnahmslosen Patienten an seinen Armen und Beinen und trugen ihn ohne Mühe ins Haus. Gerade hatten sie ihn auf die Pritsche abgelegt und Emma hatte ein Schafsfell und Decken über ihn gebreitet, als draußen im Hof Pferdegetrappel zu hören war. Schnell zog sie die Tür der Kammer zu und schickte die kräftigen Knechte auf den Hof. Sie selbst blieb, wie sie es mit ihrem Mann vereinbart hatte, mit den Kindern und ihrer Schwägerin Marga im Haus. Schließlich wusste man nie, wer draußen auftauchte und es wäre töricht gewesen, wenn die Frauen des Hauses einfach auf den Hof eilten.
Arthur, der soeben den Stall aufgeräumt und das Pferd des Fremden abgerieben und gefüttert hatte, schloss ebenfalls sicherheitshalber die Tür hinter sich. Er wusste nicht, warum er so geheimnisvoll tat, aber seine innere Stimme riet ihm dazu.
„Seid gegrüßt, Müller Arthur! Der Herr sei mit dir und den deinen!“
„Der Herr sei auch mit Euch, Hochwürden!“ Arthur wusste, dass dies nicht die richtige Anrede war, aber immerhin hatte sich Ignazius, der Verwalter des Klosters Sankt Severus, noch nie über diese Bezeichnung beschwert. Ein- bis zweimal in der Woche kam er hinaus zur Mühle geritten, begleitet von einem von zwei mächtigen rabenschwarzen Ochsen gezogenen Wagen, auf dem stets zig prallgefüllte Säcke mit Getreide lagen. Mal Gerste, mal Hafer oder – wie heute – auch einmal Weizen.
* * *
Ignazius war ein äußerst groß gewachsener Mann. Sein Haar reichte ihm bis auf die Schultern; an warmen Tagen trug er es als Zopf zusammengebunden. Um seine Schlaksigkeit zu verbergen, hüllte er sich stets in schwarze Umhänge, die erst wenige Zentimeter vor dem Boden endeten. Unwillkürlich wirkte er somit noch größer, als er ohnehin schon war. Sein schmales langes Gesicht zierte eine markante Hakennase mit überdimensional großen Nasenlöchern, aus denen zahlreiche schwarze Haare herauswuchsen. Seine buschigen Augenbrauen stießen zusammen und verdeckten dabei die Zornesfalte am Ende des Nasenrückens, die immer dann erschien, wenn er seinen gefürchteten, grimmigen Blick aufsetzte.
Der Abt des Klosters Sankt Severus, Johannes war sein Name, hatte ihn vor einigen Jahren als Cellerar eingestellt, obgleich dieser ein Laie war. Geschuldet war dies einem tragischen Zufall: Ein junger, überdurchschnittlich groß gewachsener Mann wurde genau an dem Tag im Kloster vorstellig und pries seine Qualitäten in Sachen Verwaltung und Geldvermehrung an, als Bruder Gabriel, der Cellerar von Severus, von einem durchgehenden Gaul, der von einer Wespe gestochen worden war, niedergetrampelt wurde und noch am Unfallort verstarb.
Plötzlich stand Abt Johannes vor der Aufgabe, einen Nachfolger zu finden. In der am nächsten Tag einberufenen Kapitelversammlung aber, schaute der Abt in ratlose Gesichter. Keiner der Anwesenden, weder einer der Vikare oder Scholaster noch der Kustos, wollten das Amt freiwillig übernehmen. Niemand sah sich den vielfältigen Aufgaben des Cellerars gewachsen. Diese sahen vor, die Einnahmen und Ausgaben des Klosters, sei es pekuniär oder in Naturalien, zu verwalten. Dazu gehörte es auch, mit Helfern den Zehnten an der Ernte zu erheben, Vieh anzukaufen und zu verkaufen sowie Geldforderungen einzutreiben und Löhne auszuzahlen. Und die unangenehmste Seite des Amtes sah vor, diejenigen zu bestrafen, die sich nicht an die vorgegebenen Regeln hielten.
Eigentlich sah die Klosterordnung vor, dass das Amt durch Wahl besetzt werden sollte und dass ein gewählter Bruder dieses in Demut anzunehmen hatte. Doch Abt Johannes war realistisch genug zu erkennen, dass egal wen die Wahl treffen würde, der Konvent alsbald finanzielle Nachteile erleiden würde. Also besann er sich der Offerte des jungen Riesen, der am Tag zuvor bei ihm vorgesprochen hatte und über Nacht geblieben war. „Den hat uns der Himmel geschickt!“, sagte er zu seinen Brüdern und bat den Kerl zu sich. „Ich gewähre Euch das Amt auf Probe, immerhin seid Ihr ein Laie. Seid Euch gewiss, dass ich Euer Tun und Handeln genau beobachte. Sollte nur ein Hälbling oder gar ein ganzer Pfennig nicht da landen, wo er hingehört, dann werde ich Euch am Schlafittchen packen und dafür sorgen, dass Euch die Hand, die es getan hat, abgeschlagen wird!“, sagte er drohend. Ignazius war durchaus bewusst, dass dies die Strafe wäre, wenn er Kircheneigentum stehlen würde, doch nichts lag ihm ferner als dies. So nahm er die Anstellung mit stolz geschwellter Brust gerne an. „Ich werde Euch nicht enttäuschen!“ Und siehe da, anscheinend gab es für Johannes nie einen Grund, an der Loyalität seines Verwalters zu zweifeln, da er nunmehr seine Tätigkeit schon seit vielen Jahren ausübte. Und mit der Zeit übertrug dieser ihm sogar weitreichende Befugnisse, sodass sich Außenstehenden alsbald der Eindruck aufzwängen konnte, die Leitung des Klosters würde diesem langhaarigen Kerl obliegen. So lag es zum Beispiel in Ignazius’ Entscheidungsgewalt, wem die Abtei welchen Arbeits- oder Reparaturauftrag erteilte und wer außen vor bleiben sollte. Dies verlieh ihm eine große Macht und brachte ihm vor allem Respekt bei den Bewohnern in und um Severus ein. Nach seinem Gutdünken konnte er über Gedeih und Verderb sämtlicher Bauern- und Handwerkerfamilien entscheiden; und davon hatten sich mittlerweile zahlreiche innerhalb des Weidenzauns, der den Ort umgab, und um das mit einem Steinwall umzogene Gebäude der Stiftskirche niedergelassen. Doch selbst von Reisenden, wie zuletzt diesem aus Coelln stammenden Handwerker Grindel, verlangte er eine Gegenleistung für Kost und Logis ab.
Grindel war auf dem Weg nach Lintpurc an der Lahn, wo er am Bau eines Doms mitwirken wollte. Fatalerweise erzählte er Ignazius von seinen Fähigkeiten in der künstlerischen Malerei, die er zuletzt in einer kleinen Fuhrmannskirche – die in einer Ansiedlung namens Ungersiffen stand – unter Beweis gestellt habe. Somit wollte ihn der Cellerar nicht wieder von dannen ziehen lassen, bevor er auch in Severus eine Kostprobe seiner Kunst gegeben hatte. Und da der Maler es nicht wirklich eilig hatte, nahm er den zusätzlich in Aussicht gestellten Obolus dankbar entgegen und sah die Verlängerung seines Aufenthalts als gute Gelegenheit an, seine Technik zu verbessern. Den Menschen in diesem Waldgebiet würde es eh nicht auffallen, wenn sich hier und da perspektivische Fehler einschlichen. Eigentlich waren seine Kunstwerke, ob akkurat oder nicht, hier ohnehin wie Perlen vor die Säue geworfen. In Lintpurc, wo die Herren von Ysenburg die Aufträge für den Umbau der Sankt Georgskirche in einen Dom vergaben, da dürften ihm jedoch keine Fehler mehr unterlaufen. Dort musste es ihm gelingen, sich zu profilieren.
Alsbald ließ er sich vom Schreinermeister Wengen und seinen Gehilfen ein Gerüst bauen. Zur Einstimmung begann er damit, zwei Schmuckfriese, die sich als Abschluss unter der Decke entlang des Chors bis zur Vierung erstreckten, mit einem gradlinigen gelbgrünen Band aus Akanthusblättern zu verzieren – ähnlich dem Werk, das er bereits vor Jahren in der Sankt Lucinus Kirche in Essendia angebracht hatte. Als nächstes skizzierte er auf der fensterlosen Kopfseite der Chorwand ein überlebensgroßes Bildnis der Gestalt Jesu Christi. Dieser erhob seine Rechte und hielt in seiner linken Hand die Bibel. Ein güldener Heiligenschein umgab das Haupt. Die bärtige Mimik und Haardarstellung hatte er sich von einem Künstler aus Honovere abgeschaut, der sich seinerseits von byzantinischer Kunst beeinflussen ließ. Zum Abschluss seines Werkes setzte er den Gottessohn auf einen Thron und umzog das Bild mit einem ellipsenförmigen Heiligenschein aus sieben unterschiedlich farblich gestalteten Linien. „Jesus, der Herrscher der Welt!“, betitelte er seine Arbeit.
Ignazius war damals von den schmucken Bildern im Chorraum begeistert gewesen. Dieser war zwischenzeitlich zum Steinbruch am Schwindenden Berg aufgebrochen, der zwei Tagesreisen mit dem Ochsenkarren entfernt lag. Dort, im sogenannten Stöffelbruch, holte er Steinquader für den Austausch brüchig gewordener Bögen. Grindel, der Tage zuvor an dieser Abbaustelle vorbeigeritten war, hatte ihm erzählt, dass es dort die besten Steinmetze gäbe, die er je gesehen hätte. Und so ließ Ignazius ihm keine Ruhe, bis dieser zusagte, die Ausbesserung der maroden Säulen vorzunehmen. Flugs bestimmte Ignazius welcher Steinsetzer mit seinen Gehilfen die Maurerarbeiten zu erledigen, welcher Spengler oder Schmied die Maueranker herzustellen hatte; vor allem zu welchem Lohn. Und wo er gerade dabei war, legte er fest, dass der Schreinermeister Wengen auch noch ein neues Chorgestühl bauen durfte, die Rufus der Sattler, der auch das Zaumzeug der Ochsen und Pferde flickte, mit einem feinen Rindsleder bezog. Wieder einmal lagen somit das Wohl oder Weh mehrere Handwerkerfamilien in Ignazius‘ Hand, weshalb auch Grindel sehr schnell erkannte, dass der Cellerar einer der mächtigsten Männer in Severus zu sein schien.
* * *
Ignazius drehte sich mit einer ausladenden Bewegung zum Wagen. Sein Umhang wirbelte dabei Staub auf. Ziemlich ruppig packte er einen der vor Schweiß silbrig glänzenden Ochsen am Nasenring und zog heftig daran, worauf das Tier brüllte.
„Wir haben dir einiges an Arbeit mitgebracht, Müller! Ich hoffe, du bist mit dem, was wir dir vor einigen Tagen hier ließen, fertig. Mein Herr, der überaus großherzige und gütige Abt Johannes, ist sehr zufrieden mit dir und deiner Arbeit. Insbesondere das feine Mehl, das du ihm zum Pfeilerfest mitgebracht hast, hat es ihm angetan. Hervorragende Speisen lassen sich daraus zubereiten. Ich weiß, wovon ich rede!“ Seine Zunge glitt langsam über seine schmalen Lippen und befeuchtete sie, sodass diese mit dem leichten Feuchtigkeitsschimmer erst auffielen. „Also Müller, mein Herr meint, du solltest ihm diese Wagenladung hier in eine ebenso puderartige Konsistenz verwandeln. Natürlich wird er dich dafür in seinen Gebeten besonders bedenken!“
Arthur schluckte, denn auf dem Wagen lagen mindestens zwanzig pralle Säcke. Wusste der Abt überhaupt, welch einen Aufwand die Herstellung des feinen Mehls bedeutete? Mehrere Mahlvorgänge waren notwendig, um das Korn in weißes Gold zu verwandeln. Außerdem war ihm sogleich bewusst, dass der Abt erwartete, dass er diese zusätzlichen Prozeduren ohne Aufpreis ausführte. Nicht umsonst erwähnte Ignazius vorsichtshalber, vielleicht auch um erst gar keine Debatten aufkommen zu lassen, dass der Abt ihn mit ganz besonders wirksamen Segenswünschen bedenken würde. Jedes Aufbegehren war somit sogleich im Keim erstickt.
„Es ist mir eine Ehre!“, antwortete Arthur, wie man es von ihm erwartete, und beauftragte Berthold und Kerbel mit dem Entladen des Ochsenkarrens. Währenddessen nahm Ignazius in der guten Stube Platz und ließ sich – wie immer – von Emma und den Töchtern einen Vormittagsimbiss auftischen. Frisches Fladenbrot, dazu einen Schluck des selbstgebrauten Bieres. Dieses Müllerbier schmeckte ihm wesentlich besser als das von den Mönchen im Kloster zusammengepanschte Zeug. Ein wenig Bauchspeck und zwei von beiden Seiten kross gebratene Eier durften auch nicht fehlen – schließlich handelte es sich heute wieder einmal um einen großen Auftrag.
„Wo ist Antonius? Ist er im Stall?“
„Nein, er sucht …“, Hannah wollte ihm gerade verraten, auf welcher Mission sich ihr Bruder befand, als Emma ihr ins Wort fiel. „Antonius ist ausnahmsweise auch heute in der Schlucht und sucht den Näherhof auf. Die hatten gestern so viele Säcke parat stehen, dass Antonius diese nicht alle transportieren konnte. Deshalb ist er heute erneut losgezogen.“
„Schade. Ich unterhalte mich sehr gerne mit deinem Sohn. Ein aufgeweckter Jüngling. Wie alt ist er eigentlich?“ Emma schaute verwundert drein ob Ignazius’ Interesses.
„Er ist im fünfzehnten Jahr.“
„Ha, habe ich es mir doch fast gedacht. Na, dann ist er ja im richtigen Alter. Ich habe vor kurzem mit dem Abt über euren Sohn gesprochen. Ich sagte: ‚Die Müllersleute von der Lexemühle haben vier wunderschöne Kinder – vor allem aber zwei Söhne.‘ Da würden die sich bestimmt freuen, wenn der jüngere der beiden Buben in den Dienst der Kirche eintritt!“ Emma spürte plötzlich einen eisigen Klotz in ihren Eingeweiden, als sie Ignazius’ Absichten erkannte. Sie wusste, er war käuflich und gierig. Sicher hatte ihm der Abt einen guten Verdienst geboten, wenn er ihm frischen Nachwuchs fürs Kloster beschaffen würde. Sie baute sich vor ihm auf und sah ihn trotzig an. „Nie und nimmer wird unser Sohn ins Kloster gehen. Wir brauchen hier auf der Mühle jede Hand. Ihr seht doch, wie viel wir zu tun haben. Schlagt Euch diese Idee aus dem Kopf!“ Emma war selbst über ihre Reaktion erschrocken, auch darüber, dass sie dem Klosterverwalter so ohne weiteres widersprochen hatte. Doch sie wollte, dass Antonius zu einem ganz normalen jungen Mann heranwuchs. Längst hatte auch sie erkannt, dass ihr Jüngster erwachsen wurde und bereits seit geraumer Zeit seine Aufmerksamkeit diesem jungen Mädchen auf dem Hof der Nähers widmete.
„Nun, nicht so vorschnell, Weib! Es war ja zunächst nur ein Vorschlag. Bedenke, im Kloster braucht dein kleiner Junge keine schweren Säcke zu schleppen. Er muss nicht durch die steile und gefährliche Schlucht marschieren. Du bräuchtest dich nicht mehr zu sorgen, ob er überhaupt wieder heil nach Hause kommt. Vielleicht lernt er aber auch auf dem Hof der Nähers zweifelhafte Menschen kennen, die ihn überreden mitzugehen, ihr alle werdet ihn vielleicht nie wiedersehen! Du musst selbst zugeben, dass meine Argumente nicht ganz abwegig sind. Von der Waldkreuzung kommend, verschlägt es doch häufiger recht dubiose Individuen auf den Hof – sicher hat dein Sohn bereits von solchen erzählt, oder?“ Natürlich hatte er das und Emma wusste auch über Antonius’ Fernweh Bescheid.
„Wenn du Pech hast, dann ist er für immer und ewig verschwunden“, hakte Ignazius nach. „Bedenke dies, bevor du und dein Mann eurem Sohn eine gute Zukunft im Konvent verbauen wollt. Und auf die Gefahr hin, dass euch ohne Antonius die Arbeit zu viel sein sollte, dann haben wir dafür bestimmt eine einvernehmliche Lösung. Solltet ihr beide aber zu der äußerst abwegigen Ansicht kommen, meine Großzügigkeit kategorisch mit Füßen treten zu müssen,“ – zum Glück war die Zornesfalte von seinen Augenbrauen überwuchert, da sie ansonsten sicher deutlich hervorgetreten wäre – „dann gibt es bestimmt auch noch andere Vorschläge.“ Genüsslich biss er ein Stück Brot ab und spülte es mit einem Schluck Bier herunter. Wortlos hielt er Hannah den leeren Becher hin und bedeutete ihr mit einem vornehmen Kopfnicken, gefolgt von einem weniger feinen Rülpser, sie möge diesen wieder auffüllen. Mit zitternden Händen hielt Hannah den Krug in der Hand und vermied es, ihren Blick auf Ignazius zu richten.
„Übrigens“, setzte dieser selbstverliebt fort, „auf der anderen Seite des Kirchhölzchens wird in Kürze eine weitere Mühle gebaut. Der Steinmüller Hans, du weißt, der euch immer die Mühlsteine besorgt, ist müde von seinen wochenlangen Fahrten. Er würde sich gerne in Severus niederlassen. Ich habe schon mit ihm gesprochen und er meinte, dass er bereits in wenigen Monaten die ersten Säcke annehmen könnte. Außerdem würde er dann über die neuesten Mühlsteine vom Schwindenden Berg verfügen – und selbst ihr müsstet wissen, dass die Steinbrecher aus dem Stöffel über die beste Steinqualität verfügen. Eine Qualität, die ihr euch bisher noch nicht habt leisten können. Also, solltet ihr es euch doch noch überlegen und Antonius zu uns schicken, dann schwöre ich dir beim Herrn, dann werdet ihr in Kürze einen neuen Mühlstein bekommen und wir werden euch mit Arbeit versorgen, sodass ihr euch gut und gerne vier weitere Arbeiter besorgen könnt, um diese zu bewältigen. Wenn nicht, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich einen großen Teil meines Getreidespeichers dem Steinmüller zum Bearbeiten bringe. Es liegt an euch. Du solltest deinen Gatten von all diesem überzeugen, denn auch er stand meinem Vorschlag nicht besonders wohlwollend gegenüber!“ Ignazius biss erneut in eine Scheibe Brot und riss an dem Stück Rauchspeck wie ein Hund, der das Fleisch eines Knochens abnagt. Er kaute mit offenem Mund und schmatzte unappetitlich. Dann nahm er einen kräftigen Schluck Bier, rülpste erneut, ließ einen Furz erschallen und verschwand mit wehendem Umhang nach draußen. Der Wagen war mittlerweile ent- und wieder beladen. Artig dankte Arthur dem Verwalter für den neuen Auftrag.
Gerade wollte Ignazius auf sein Pferd steigen, als er das Wiehern eines Pferdes vernahm. „Ich dachte, Antonius sei mit euren Pferden zum Näherschen Hof? Habt ihr etwa noch ein drittes Pferd?“ Ignazius nahm seinen Fuß aus dem Steigbügel und machte sich auf zum Stall. Mit einem Tritt gegen die schwere Holztür öffnete er diese und trat ein. Arthur folgte ihm auf dem Fuße und war froh, dass er zuvor die Sachen des gestürzten Reiters weggesperrt hatte und nun lediglich das Pferd im Stall stand.
„Wessen Pferd ist das? Sprich, Müller! Das ist niemals ein Pferd, das du dir leisten könntest, geschweige, dass es dazu taugte, Lasten zu tragen oder auf dem Acker seinen Dienst zu verrichten. Dies hier ist das Pferd eines Edelmannes. Los sag’s, hast du es etwa gestohlen? Man wird dich am Galgenberg aufhängen! Aufhängen wird man euch! Los, sag’ was!“
Arthur verschlug es die Stimme. Eigentlich hätte er Ignazius ganz einfach erklären können, dass sie gerade einen kranken Mönchsritter – oder wer oder was auch immer er war – versorgten, doch irgendwie klangen ihm die Worte seines Sohnes Antonius in den Ohren, wonach die Kirche auf diese Männer nicht uneingeschränkt gut zu sprechen war. Wer wusste schon, vielleicht hatten sie sich allein deswegen schon schuldig gemacht, indem sie dem Kerl in der Kammer Unterschlupf gewährt hatten. Gerade wollte er ansetzen und mit irgendeiner Ausrede die Situation erklären, notfalls auch das Geheimnis um den Reiter preisgeben, als Albert den Stall betrat.
„Seid gegrüßt, Hochwürden! Ist das nicht ein tolles Pferd? Antonius hat es gestern mitgebracht!“ Arthur riss beide Augen auf und versuchte Albert zu signalisieren, dass er vielleicht besser noch nichts von dem Rittermönch erzählen sollte, doch Albert setzte unvermittelt fort. „Das Pferd gehört wirklich einem Edelmann. Es ist wohl gestürzt.“
„Und was ist mit dem Reiter passiert?“, hakte Ignazius nach. Albert schaute Arthur an, dieser zuckte fast kaum merklich mit den Schultern und bereitete sich seelisch und moralisch auf Ignazius’ Gefühlsausbruch vor – und diese emotionalen Feuerwerke oder eher Vulkanausbrüche konnten heftig krachen.
„Ja, der Reiter ist ein reicher Kaufmann. Zurzeit sitzt er auf dem Hof der Nähers fest. Dorthin ritt er, nachdem er nahe der großen Waldkreuzung gestürzt war. Die Hufe seines Pferdes waren aufgrund der langen Reise ungepflegt und zu glatt geworden. So fand es kaum noch Halt auf den feuchten Pfaden. Da der Reiter sich zudem leicht verletzte und der Sattel beschädigt wurde, war es ihm unmöglich weiterzureiten. Als Antonius die beiden gestern auf dem Hof ankommen sah, bot er sich sogleich an, das Pferd mit zu uns zu nehmen, wo ich ihm seine Hufe auf Vordermann bringen werde, während Kerbel, der ja auch unser Sattelzeug und Geschirr flickt, sich um den gerissenen Sattel kümmert. Derweil kann der Kaufmann die Gastfreundschaft von Dagoberth Näher genießen und sich ausruhen, bis wir ihm – morgen wahrscheinlich – sein Pferd wiederbringen. Deshalb ist Antonius auch heute erneut zu den Nähers, da er morgen nicht mit unseren beiden beladenen Rössern und diesem Temperamentsbündel durch die Schlucht gehen wollte. Stellt Euch vor, das gute Mehl, dass wir zu den Nähers transportieren, würde zu guter Letzt im Holzbach landen!“
„Oh nein!“ Ignazius hatte die Geschichte geschluckt und verzichtete – da Albert ihn anscheinend vollkommen überzeugt hatte – auf ein weiteres Nachfragen.
„Schönes Tier!“, murmelte er mehrmals vor sich hin, bestieg sein Pferd, ließ den Ochsenkarren wenden und zog mit seinen Helfern von dannen. Arthur indes klopfte seinem Sohn zufrieden auf die Schulter. „Bei Gott, Albert! Was kannst du Geschichten erzählen!“