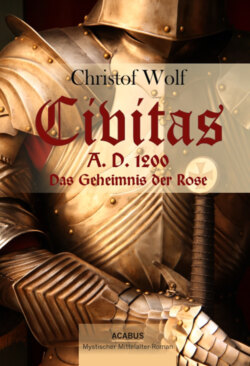Читать книгу Civitas A.D. 1200. Das Geheimnis der Rose - Christof Wolf - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KLOSTER SANKT PETERSTHAL IN HEISTERBACH (SIEBENGEBIRGE)
ОглавлениеZur selben Zeit öffnete der Mönch Caesarius die mächtige Tür aus Eichenholz, die immer einen kleinen Seufzer auszustoßen wusste, wenn man sie nur behäbig genug öffnete, und betrat die Bibliothek seines Konvents.
Irgendwie schien der Raum immer dieselbe Temperatur zu halten. Trat man im Sommer ein, ließ es einen frösteln. Zog man im Winter zügig die Tür hinter sich zu, verspürte man sofort einen angenehmen Temperaturanstieg im Vergleich zum kalten Flur. Tagsüber gehörte dieser Raum zu den hellsten. Durch die Nord-Südausrichtung des Gebäudes und die schmalen glaslosen Fensteröffnungen im Osten und Süden fielen bereits zur Zeit des Sonnenaufgangs die ersten Sonnenstrahlen hinein. Zudem konnte so von dieser Seite im Verlauf des Tags die warme Luft hineinströmen. Auf den gegenüberliegenden fensterlosen Seiten standen riesige Holzregale. Unzählige, oftmals in dickes Schweinsleder gebundene Werke waren dort einsortiert.
Damit die feuchtkalte Luft der Wintertage draußen blieb und dennoch die Sonne den Raum erhellen konnte, hatte man sich im letzten Jahr etwas einfallen lassen: Da der Konvent sich noch kein neumodisches, vor allem passgenaues Fensterglas leisten konnte, war Frater Timotheus auf die Idee gekommen, die Fensteröffnungen anderweitig zu verschließen. In den Jahren zuvor hatten sie im Herbst ein Geflecht aus biegsamen Weiden zwischen den Laibungen eingepasst, in das sie dann, wie es beim Hausbau üblich war, zunächst Stroh einflochten. Anschließend beschmierten sie das Ganze innen und außen mit einem Gemisch aus feuchtem Lehm und Dung. Zwar erzielten sie somit, dass die kalte Luft draußen blieb, doch war der Raum fortan dunkler als jeder Fuchsbau – und mit der Zeit roch er auch noch schlimmer.
Schließlich stellte im letzten Frühjahr der junge Frater während einer Kapitelversammlung eine neue Idee vor und beschrieb, wie er es sich vorstellen konnte, die Bibliotheks- und sogar einen großen Teil der riesigen Kirchenfenster im nächsten Winter zu verschließen. Abt Gervadus, ein ansonsten eher konservativer Geselle, ließ sich von den Vorstellungen seines jungen Mitbruders überzeugen, zumal dessen ehemaliger Novizenmeister Caesarius für ihn in die Bresche zu springen schien. So kauften sie noch im letzen kalten Monat des Winters, die Hauptschlachtzeit der Fleischhauer, mehr denn je in großem Stil – auch nicht ganz einwandfreie – Häute von Rindern, Kälbern und Ziegen auf. Diese bearbeiteten sie unter Anleitung des Pergamentarius Lukas in der klostereigenen Gerberei. Die gute Ware sortierten sie sogleich für die Herstellung von kostbarem Pergament aus; für den von Timotheus angedachten Zweck wäre sie viel zu teuer gewesen. Die Hautstücke jedoch, die mit Schlachtspuren in Form von Messerstichen und Beilhieben versehen waren oder von einer von einem Wolf gerissenen Ziege stammten, bekam der junge Frater für sein Projekt. Unterstützt von einer kleinen Gruppe Laienbrüder bearbeitete Timotheus die Schwarten unermüdlich. Er schabte mithilfe feiner Klingen die letzten Fleischreste ab und weichte die Fetzen in einer scharfen kalkhaltigen Lösung ein, damit sich auch die Haare lösten. Immer und immer wieder behandelten sie die Tierhäute, so lange, bis sie fast so dünn waren wie Pergament. Im Anschluss daran schnitten sie diese in gleichmäßige Streifen. Anhand von zuvor angefertigten Holzschablonen, die die Größe und vor allem die Rundungen der Fenster vorgaben, nähten sie die Bahnen in der benötigten Breite gleichmäßig zusammen. Die Ränder verstärkten sie mit grobem Leinenstoff, durch den sie wiederum kleine Löcher bohrten. Mit Holz- und Eisenstiften, die sie in die Steinfugen der Fensterlaibung keilten, spannten sie schließlich die Häute straff vor die Fensteröffnungen.
Und siehe da, Timotheus’ neuartige Konstruktion hielt fortan den kalten Wind draußen und ließ trotzdem ein wenig Licht in den Raum dringen. Dadurch sparten sie fast einen ganzen Monatsbedarf an Kerzen ein und vermieden es, dass die Räume hinter den dicken Wänden komplett auskühlten. Zudem wurde die Luft weniger feucht und fügte den literarischen Werken, die überwiegend aus Pergament und zum Teil sogar aus Papyrus bestanden, weniger Schaden zu.
Caesarius, der Bibliothekar, liebte diesen Raum, barg er doch das Wissen um die Geschichte der Christenheit. Wissen darüber, wie die Welt außerhalb des Valle Sancti Petri und von Heisterbach aussah. Wissen über die Geheimnisse des Glaubens. Wissen ob des Wegs zu einem erfüllten Leben. Sogar Wissen darüber, wie die Welt zu funktionieren schien. Alles war zu finden – wenngleich gerade diese Bücher auf Anweisung seines Abtes in einer ganz besonders dunklen Ecke aufzubewahren waren. In dessen Augen stellten sie eigentlich eine Art Teufelszeug dar und waren somit mehr oder weniger der Kategorie der Ketzerschriften zuzuordnen. Gleichwohl konnte auch Abt Gervadus sich nicht der Macht entziehen, die Neugier hieß. Wissenschaft nannten die Laien diese neuen Erkenntnisse, die immer neues Wissen schaffte. Deshalb ordnete Gervadus auch an, dass ihm, wann immer ein neues Werk den Weg in sein Kloster fand, dieses Buch zuallererst zur Sichtung und Begutachtung gebracht werden musste. Erst wenn er es für gut erachtete, durfte es in den Bibliotheksbestand aufgenommen werden. Lehnte er es als minderwertigen heidnischen Codex oder aus Gründen der Blasphemie ab, so war es im ‚Fegefeuer für mindergeistige Ergüsse‘ zu vernichten. Allerdings wurden nicht die Werke an sich verbrannt. Mit einem Seitenschaber wurden die Pergamentseiten von geistigem Unrat befreit und anschließend an die Schreiberlinge im Scriptorium, das neben dem Dormitorium die größte Halle innerhalb der Klostermauern einnahm, weitergeleitet.
Der Bibliotheksraum, der gerade in der dunklen Jahreszeit aufgrund der wenigen erlaubten Kerzen eine gewisse Mystik in sich barg, hatte Caesarius längst in seinen Bann gezogen. Vor allem aber war es die interessante Literatur, die seine Brüder oder die Kuriere, die regelmäßig zwischen den Klöstern pendelten, in den letzten Jahren zusammengetragen hatten. Er selbst hatte diese Aufgabe von Pater Urbanius, der diese Bibliothek aufgebaut hatte, übernommen. Caesarius selbst war zur selben Zeit gerade in den Kreis der Brüder aufgenommen worden und erhielt von Gervadus die Bewährungsaufgabe der Bibliotheksverwaltung übertragen. Ein Glücksfall für das Kloster wie sich später herausstellte.
Der neue Mönch stürzte sich sofort in seine neue Aufgabe. Selten bekam man ihn draußen bei Tageslicht zu Gesicht, weshalb seine Haut selbst fast aussah wie Pergament, was ihm alsbald den Spitznamen ‚Das Gespenst‘ einbrachte. Am Stehpult unter der geschwungenen Empore, auf der die besonders wertvollen und vor allem uralten Werke standen, konnte er stundenlang – manchmal bis zur Komplet – mit seinen langen knochigen Fingern in den Werken blättern, ohne eine Spur von Müdigkeit zu erfahren. Caesarius nahm seine Aufgabe, den Bestand zu verwalten, sehr ernst, wenngleich er noch lieber in eigener Sache recherchierte und seine eigenen Interessen verfolgte. Seine Forschungen spreizten sich über die verschiedensten Gebiete: Von der Heilkunde zur Mystik, von Sagen und Mythen hin zur Verifizierung christlicher Geschichten. Akribisch hielt er seine Erkenntnisse für die Nachwelt in dicken Schwarten aus zig Pergamentseiten fest.
Gleichwohl nahm der Bibliotheksverwalter auch die Position des Novizenmeisters des Heisterbacher Konvents wahr. Aufgrund der Vielseitigkeit seines Wissens, konnte Caesarius die meisten Vorträge selbst halten. Zudem liebte er es, mit den jungen Leuten zu debattieren und in unzähligen Dialogen ihren Horizont zu erweitern. Gleichwohl behielt er dabei seine eigenen Forschungen immer im Auge und versuchte sie so kontinuierlich wie möglich voranzutreiben. Deshalb zog es ihn auch heute in seine Bibliothek.
Bereits am Vormittag hatte er sich geeilt, um bis zur Sext, also bis zum Mittagessen, seine Pflicht als Novizenmeister zu erledigen. Diese bestand heute darin, die finalen Zeugnisse zu verfassen, in denen er zum Abschluss der Novizenausbildung die intellektuell und disziplinär erzielten Ergebnisse auflistete und seine eigenen Eindrücke ergänzte. Das abschließende Urteil müsste er dann am kommenden Sonntag in der Profess, an der alle seine Mitbrüder teilnehmen würden, vor Abt Gervadus verteidigen. Dieser würde ihn, den Meister aller Novizen, unnachgiebig zu seinen Erkenntnissen bezüglich seiner Schüler befragen. Anschließend kämen die Novizen dran und müssten sich behaupten; Caesarius hatte ab diesem Moment denn keinen Einfluss mehr. Die Entscheidung über die Aufnahme in den Konvent traf letztendlich die Kongregation der älteren Brüder. Also bangte er stets mit seinen Schützlingen, die ihm in den Jahren der Erprobung doch sehr ans Herz wuchsen.
Nachdem er jedes seiner Urteile kurz vor der Terz noch einmal validiert hatte, kam er zu der Auffassung, dass die von ihm vorgeschlagenen Kandidaten künftig ein Leben im Konvent führen würden. Erleichtert betrat er nun die Bibliothek und konnte sich den Rest des Tages ausschließlich seinen Forschungen widmen.
Er genoss es stets, sich einfach in die Stille des großen Raumes zurückzuziehen und dort in alten Handschriften zu studieren. Mittlerweile konnte die Klosterbibliothek auf einen umfassenden Bestand an Handabschriften und Übersetzungen aus zum Teil längst untergegangenen Klöstern blicken. Unzählige Stunden hatte er bereits aufgewendet, um sich durch vergilbte Pergamente mit uralten Handschriften zu arbeiten und deren Inhalte auf neueren Seiten festzuhalten. Vieles konnte er von den schriftlichen Erkenntnissen der Alten lernen, aber ebenso zahlreiche Dinge erschlossen sich ihm überhaupt nicht. Nicht selten ertappte er sich schließlich dabei, dass er diese, ihm unverständliche Passagen oder das, was er nicht hundertprozentig entschlüsseln konnte, als eigene Interpretation niederschrieb.
Caesarius war zufrieden mit seiner Arbeit, vor allem mit seinem Leben im Kloster in Heisterbach. Dieses lag im Valle di Sancti Petri, also im Tal des heiligen Petrus, am Fuß des Siebengebirges und wurde umrahmt von einem malerischen Heister – einem Wald mit hohen Buchen. Dadurch, dass es förmlich von der Welt abgeschiedenen war, verirrten sich nur selten Menschen an diesen Ort. Und diese gefühlte Einsamkeit erleichterte es ihm und seinen Mitbrüdern daran zu glauben, dass ihnen Gott umso näher war.
„War Moses nicht alleine auf den Berg Sinai gegangen, um in der Einsamkeit mit Gott zu reden?“, fragte Caesarius stets seine Schüler, wenn wieder einmal einer von ihnen infrage stellen wollte, ob tatsächlich ein Leben in der Abgeschiedenheit notwendig sei. „Warum hat Jesus vierzig Tage in der Wüste verbracht? War er dort seinem Vater nicht so nah wie noch nie gekommen?“ Caesarius wusste, wie er den Novizen klar machen konnte, dass sie mit ihrer Lebensweise keine Zeit für die Suche nach Gott verschwendeten. Insbesondere dann, wenn sie ihr monastisches Leben nach den Vorgaben des Heiligen Benedikts ausrichteten. „Ora et Labora“, mit erhobener Stimme zog er stets die Aufmerksamkeit von Neulingen auf sich, „muss euch zum Gesetz werden. Euer Alltag besteht künftig aus gemeinschaftlichen und mehr oder weniger privat meditativen Gebetsstunden – das Ora! Aus innerer Einkehr und Stille!“ Er wusste, ihnen würde es zunächst schwerfallen, sich diesem völlig neuen Leben zu stellen, zu dem es auch gehörte, dass sie ihre Mahlzeiten schweigend einzunehmen hatten. Doch alsbald würden sie erkennen, welch ein Genuss diese Kontemplation in sich barg. Auf der anderen Seite würde aber – neben dem geistigen und geistlichen Studium – auch Labora, also das Arbeiten im Schweiße des Angesichts, das Mönchsleben ergänzen.
Caesarius fühlte sich in seinem Konvent wohl und wusste, dass Heisterbach der Ort seiner Bestimmung war. Und dieser – sein Orden wie er es immer den neuen Kandidaten vortrug – gehörte zu der vor gut einhundert Jahren zuvor in Frankreich gegründeten Sacer Cisterciensis Glaubensgemeinschaft. Deshalb stand stets in dem ersten Vortrag, den ein Novize über sich ergehen lassen musste, die Gründungsgeschichte des Zisterzienserordens im Mittelpunkt. „Das erste Kloster wurde im französischen Cîteaux, das im Lateinischen Cistercium, unter dem drakonischen Regiment des Geistlichen Robert von Molesme gegründet.“ Er beschrieb es stets als das strengste Kloster der Welt, dem schon sehr bald durch die strikt gelebte Askese die Novizen ausgeblieben waren. Dann aber sei ein Junker namens Bernhard von Fontaine, gemeinsam mit dreißig weiteren Gefährten, darunter seine vier Brüder und zwei Neffen, eingetreten und hätten frischen Wind verbreitet. Und bereits wenige Jahre später sei dieser Bernhard zum Gründungsabt des Klosters von Clairvaux berufen worden, wo er die Regeln des Heiligen Benedikt neu ausgelegt hatte. „Sechs Stunden Gotteslob, auch des Nachts. Sechs Stunden Feld- oder Handarbeit, sechs Stunden Studium und weitere sechs Stunden Schlaf“, schloss Caesarius und beobachtete die Neulinge, ob er irgendwelche negative Reaktionen auf diesen Tagesablauf zeigte.
Die fortgeschrittenen Novizen unterrichtete Caesarius in einem seiner Lieblingsthemen, der Kunde des modernen Kirchenbaus. Meist nahm er mehrere seiner Schützlinge zusammen und ging mit ihnen in die Kirche des Konvents.
„Wir sind die Vorreiter der Baukunst!“, hob er stets theatralisch hervor, wenn er in sein Thema einleitete. „Zum Bau unserer Klöster werden wir uns künftig einer völlig neuartigen Architektur bedienen. Man nennt sie den Lichtstil! Baumeister aller Herren Länder versuchen sie anzuwenden, weshalb sie sich mittlerweile rasend schnell verbreitet – fast so flott wie eine Krankheit. Verzeiht mir diesen Vergleich!“
„Sagt uns, Caesarius, was ist so revolutionär an dieser neuen Bauart?“ Der Novizenmeister wusste, wie er seine Zuhörerschaft für das Thema interessieren konnte, und genoss, da die Frage nie ausblieb, stets eine schöpferische Gedankenpause.
„Nun, mein lieber wissbegieriger Mitbruder, einige spitze Zungen behaupten spöttisch, man wolle sich mit dem Durchbrechen der romanischen Bögen sinnbildlich von Rom trennen. Ich will dies nicht ernsthaft kommentieren. Künftig wird es uns gelingen wahrhaft lichtdurchflutete, gen Himmel stürmende Monumente zu schaffen, mit schmalen Säulen und hohen Fenstern.“ Die jungen Mönchsanwärter bewunderten Caesarius um die Vielfalt seines Wissens. Und dieser lief gerne zur Hochform auf. „Zurzeit errichten wir gerade in der Abtei Otterberg, ein Tochterkloster unserer Brüder in Eberbach, eine neue Basilika. Drei Schiffe mit einem erhöhten Mittelschiff werden dort entstehen. Die Länge des Langhauses wird monumentale 240 Ellen betragen!“ Ein Raunen ging durch den Raum. „In Otterberg wird versucht am Ende des Langhauses eine Querachse einzuschieben; dadurch entsteht was?“ Schweigen. „Stellt euch vor, ihr fliegt als Vogel über die Kirche. Was könntet ihr sehen?“ Erneut machte sich ein betretenes und ratloses Schweigen breit. Die Novizen standen am Anfang ihrer Ausbildung und waren es nicht gewohnt, abstrakt zu denken. Caesarius sonnte sich dann stets in einem Gefühl der Überlegenheit. Nur einmal, da riss ihn eine Antwort aus diesem erhabenen Moment.
„Wir könnten sehen, dass der Grundriss der Form eines Kreuzes entspricht!“, rief ein Novize mit dem Namen Malchus aus der zweiten Reihe. Caesarius war überrascht.
„Ach ja?“, hatte er damals, ein wenig aus dem Konzept geworfen, gesagt. „Dann weißt du auch bestimmt, wie man den Bereich nennt, wo Lang- und Querhaus sich kreuzen?“ Triumphierend kostete er die Stille aus, die sich ausbreitete. Die Dampfschwaden, die den Mund- und Nasenöffnungen der anderen Novizen bis zu diesem Moment entfuhren – schließlich standen sie in der kalten Kirche – verschwanden abrupt. Alle schienen den Atem anzuhalten – alle bis auf Malchus: „Dort entsteht eine sogenannte Vierung. Aber da wir Zisterzienser es eher turmlos lieben, sitzt bei uns dort nur ein leichter Dachreiter. Ein monströser Glockenturm würde viel zu pompös wirken und stünde im Widerspruch zu unserem Armutsprinzip.“
„In dem Reiter ist lediglich die Glocke untergebracht!“, fiel Caesarius seinem Schüler ins Wort, als er merkte, dass dieser durchaus noch hätte weiterreden können.
„Einmal abgesehen von der einen oder anderen Schleiereule, die sich da droben einnistet!“, schob Malchus nach. Stille im ganzen Raum. Nun schienen sogar die Herzen der Anderen ihre Schläge ausgesetzt zu haben. Dann begann Caesarius aus vollem Halse zu lachen – und nacheinander fielen die anderen Novizen in das Gelächter ein. Der Meister war damals beeindruckt gewesen und fortan hatte er einen neuen Lieblingsschüler.
Caesarius ging in seiner Lehrtätigkeit auf. Auch die Klosterleitung schätzte ihn sehr für seine Arbeit und befreite ihn – bis auf die Aushilfe im Kräutergarten, in dem sämtliche Gewächse gegen jegliches Zipperlein angesät wurden – fast von allen handwerklichen oder landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Dies gab ihm die Freiheit, dass er sich täglich ein paar Stündchen in die große Bibliothek zurückziehen und seinem Selbststudium oder seiner Forschung widmen konnte. Eines seiner Lieblingsthemen lag in der Erforschung des Lebens und der Wunder Jesu Christi. Stunden seines Lebens, von dem er selbst derzeit fast fünfunddreißig Jahre gelebt hatte, verbrachte Caesarius mit der Sichtung unzähliger Überlieferungen und Briefe der damaligen Zeit sowie heidnischer Codizes und anerkannter Evangelien. Stundenlang konnte er sich Apokryphen widmen: religiösen Texten, die nach der Übersetzung der Bibel aus dem Hebräischen ins Lateinische nicht in den Kanon der aktuellen Bibel aufgenommen und teilweise von der Kirchenführung auf den Index Librorum Prohibitorum, das Verzeichnis der verbotenen Bücher, gesetzt wurden. Solange er den Inhalt eines solchen Textes und dessen Aussagen nicht eruieren oder entschlüsseln konnte, so lange gab er keine Ruhe.
Auch heute führte er sich wieder eines dieser besonderen Stücke zu Gemüte. Vor einem halben Jahr hatte ihm ein Mönchsbruder aus einem befreundeten Konvent ein in Ziegenleder eingebundenes Livret mitgebracht. Es enthalte angeblich weithin unbekannte, aber nicht weniger fantastische Geschichten über die Wunder Jesu. Genaueres konnte der Mönch ihm jedoch nicht sagen; auch nicht, wer die Geschichten in dieser für ihn unbekannten Sprache festgehalten hatte. Natürlich war dies eine Herausforderung für Caesarius. Mittlerweile hatte er sich bereits etliche Fremdsprachen in Wort und Schrift angeeignet. Griechisch und Hebräisch gehörten zum Standard der Novizenausbildung, Latein sowieso. Aber selbst Aramäisch und sogar in gewissen Teilen die Sprache der Ungläubigen, wie Arabisch, konnte er mittlerweile lesen.
Bei dem Büchlein, das ihm nun vorlag, hatte er auf den ersten Blick erkannt, dass der Verfasser die Zeilen in Aramäisch geschrieben hatte. Natürlich ließ es ihm seitdem keine Ruhe; er musste den geheimnisvollen Codex entschlüsseln.
Wie immer stand der Novizenmeister an seinem Pult. Er hatte eine Kerze zum Ausleuchten seines Arbeitsplatzes angezündet und den Federkiel mit einer kleinen Klinge angespitzt. Nachdenklich rollte er die Feder zwischen Daumen und Zeigefinger hin und her. Ein jungfräuliches Stück Pergament von guter Qualität – darauf legte Caesarius stets großen Wert – lag auseinandergerollt vor ihm. Ein kleines Tintenfässchen auf der einen Seite und der steinerne Federhalter am anderen Ende verhinderten ein Zusammenrollen. Hohläugig starrte er das Blatt an. Es schien ihn anzuflehen, es endlich mit der Tinte seiner Unbeflecktheit zu berauben. Caesarius spürte stets ein gewisses Kribbeln in ihm aufsteigen. Er hatte die Macht, dem Bogen die Reinheit zu nehmen. Eine gewisse Begierde überkam ihn stets, wenn er kurz davor war, ihn mit seiner Schrift zu besudeln. Daher genoss er den Augenblick und überlegte immer recht lange, bis er den ersten Buchstaben schrieb. Danach lief es stets wie von selbst und die Zeichen reihten sich aneinander wie Soldaten zum morgendlichen Appell auf dem Burghof.
Das geheimnisvolle Livret lag auf dem hölzernen Manuskripthalter, den ihm ein handwerklich talentierter Schüler während der letzten Wintermonate angefertigt hatte und der ihm seitdem das Lesen und Abschreiben wesentlich erleichterte. Die vergilbten Seiten des Buches zeigten kaum noch einen Kontrast zur weich geschwungenen und in graublauer Tinte verfassten Schrift. Lediglich die sattroten Anfangsbuchstaben, mit denen der Verfasser die Kapitelanfänge deutlich hervorgehoben hatte, waren nahezu tropfenfrisch und ausgezeichnet zu erkennen. Caesarius wusste auch warum.
* * *
Die Farbe, die man für diese Darstellung benötigte, wurde aus dem Blut und den Panzern einer bestimmten Käferart gewonnen, die es allerdings nur in Frankreich gab. Seine Brüder im Kloster von Clairvaux sammelten sie im Frühjahr, wenn sie am saftigsten beziehungsweise ergiebigsten waren. Im Anschluss an das gesellige Einsammeln machten sie dem Krabbelvieh mit steinernen Mörsern den Garaus und erhielten einen ekligen, rotblauen Matsch. Diesen stellten sie anschließend ein paar Tage – unter regelmäßigem Umrühren – zum Trocknen in die Sonne. Die verbleibende, lehmartige Masse zerrieben sie dann so lange, bis auch die kleinen Chininpanzer und Beinchen zu feinstem Pulver vergangen waren. Zur Aufbewahrung füllten sie das Käfermehl in kleine, gut verschließbare Gefäße.
Vor dem Gebrauch musste die Käferessenz mit ein wenig Wasser, gemahlener Kreide und einigen Tropfen Walnussöl versetzt werden. Zu guter Letzt – und das war das Geheimrezept einer Qualitätstinte – rührten die Mönche ein wenig von dem teuren Pulver unter, das aus den vier bis fünf Staubblättern der Rubicanea gewonnen wurde, einem Krabbgewächs, zu deren Gattung auch die Kaffeepflanze gehörte. Hierdurch erhielten sie eine wunderbar sämige Substanz – vor allem aber eine ergiebige, kräftig purpurne Farbe.
„Seit geraumer Zeit haben auch die Färber in Italien und England erkannt, dass man mit dem Blütenstaub der Rubicanea wunderbar, da dauerhaft, Stoffe einfärben kann. Krabbeltier und Krabbgewächs, wenn das mal kein Zufall ist. Merkt euch das!“, schloss Caesarius stets seinen Vortrag zum Thema Schreibkunst und Schreibtechnik, zu der die Farbenlehre, vor allem aber das richtige Anrühren von Farben gehörten. Zuvor erzählte er seinen Schülern von der purpurnen Epoche: „In vielen alten Schriften aus der Zeit zu Beginn des Römischen Reiches schrieb man die Anfangsbuchstaben in Purpur. Diese Modefarbe erhielt ihre Popularität dadurch, dass sich die Kaiser samt ihrer Familien, später auch der ‚ordinäre‘ Adel, in Gewänder dieser Farbe hüllten.“ Das Besondere aber an diesem tyrischen Purpur sei gewesen, dass dieser ebenfalls aus Tieren hergestellt wurde: „… und zwar aus Schnecken!“ Großes Naserümpfen und Ekelbekundungen machten die Runde. Caesarius suhlte sich in ihren angeekelten Gesichtsausdrücken.
„Was hat es mit den Schnecken auf sich?“, lautete stets die Standardfrage seiner Schüler, wenn die Neugier den Ekel besiegte.
„Herkules und Brandhorn!“ Die Novizen runzelten fragend ihre Stirn. Die Worte ihres Meisters hörten sich an wie ein Zauberspruch. Manchmal, da waren sich alle Anwärter einig, umgab Caesarius durchaus etwas Unheimliches. Wie ein Miracolus sah er ob seiner knochigen Erscheinung ohnehin schon aus. Frühere Jahrgänge berichteten zudem von sonderbaren Experimenten ihres Lehrmeisters. Doch diesmal zerstreute er sehr schnell jeglichen Verdacht der Hexerei: „So heißen die bekanntesten Arten der Purpurschnecke! Das Besondere an diesen Tieren ist, dass sie einen Schleim aussondern, der so grün ist wie euer Auswurf am Morgen.“ Weitere Ekelbekundungen folgten. Caesarius lachte dann laut auf und erklärte die einzelnen Stufen der Farbgewinnung. „Besonders beliebt war das Pallium, das mit grünem Purpur gefärbt wurde. Mit der Zeit verfärbte sich der Stoff über Blau und Violett bis hin zu tiefem Rot. Allerdings wollten in dieser Epoche plötzlich immer mehr Leute diese Farbe tragen. Und damit greife ich nun fast der Wirtschaftskunde vor: Denn dort gilt, je gefragter ein Gut, in diesem Fall der Farbstoff, desto knapper und vor allem umso wertvoller ist es. Was denkt ihr, wie viele Schnecken brauchte man, um ein Gramm Farbstoff herzustellen?“ Ratlose Gesichter. „Bestimmt fast einhundert!“, traute sich schließlich einer. Caesarius nahm den Einwurf mit anerkennendem Kopfnicken entgegen. Mit gespreizten Daumen und Zeigefinger rieb er sich den Rand seiner Tonsur und baute die Spannung künstlich auf. „Ungefähr achttausend Schnecken mussten ihr Leben lassen, um ein Gramm Purpurfarbstoff herzustellen!“ Im ganzen Raum ging ein Raunen um. „Um etwa ein Kilo Wolle zu färben, benötigte man gut 200 Gramm Farbstoff. Ihr könnt euch vorstellen, dass somit der Preis in nie geahnte Dimensionen stieg. Zu guter Letzt waren die Tierchen, da fast ausgerottet, sprichwörtlich Gold wert!“ Mit diesem letzten Halbsatz löste er die Fantasiebarrikaden im Kopf von Malchus, Caesarius’ Lieblingsschüler. Gemeinsam mit drei weiteren Novizen überlegte er, wie man es anstellen konnte, künftig den Klosterunterhalt aus dem Verkauf von Farbstoff zu bestreiten. Und als im letzten Sommer dann zufälligerweise eine Invasion roter Nacktschnecken und ein Schwarm rostfarbener Käfer sich über die noch zarten Pflanzen im Klostergarten hermachten, sahen sie dies als Fügung.
Eifrig begannen sie damit, so viele dieser roten Kriecher und Krabbler einzusammeln, wie sie kriegen konnten. Schließlich war ihnen daran gelegen, möglichst viel Farbstoff zu erzeugen. Emsig warfen sie das Getier in Steinschalen und begannen damit – wie sie es von ihrem Meister erfahren hatten – ihm mit steinernen Mörsern den Garaus zu machen. Ein matschiger Brei entstand und einer der Farbproduzenten entledigte sich zwischendurch seines Mageninhaltes. Da sie möglichst schnell zum Erfolg kommen wollten, änderten sie kurzerhand die Prozeduren ein wenig ab, sodass sie alsbald einen übel riechenden Brei vorsichtig auf dunkle Schieferplatten auftragen konnten. Tagsüber legten sie ihre Exponate in die Sonne im Klostergarten und holten sie des Nachts hinein. Allerdings breitete sich schon nach wenigen Tagen im ganzen Kloster ein grausiger, für die Klosterbewohner nicht mehr zu ertragender Gestank aus. Den ambitionierten Klosterschülern blieb nichts anderes übrig, als zu konstatieren, dass ihr Projekt gescheitert war. Ihr Lehrer war jedoch glücklich und zufrieden mit ihnen, schließlich hatten Malchus und seine Mitbrüder Engagement gezeigt – was ihnen einen positiven Eintrag in seinen Aufzeichnungen einbrachte. Zudem konnte durch das Einsammeln der Schädlinge die Gemüseernte gerettet werden. Was Caesarius seinen Schülern fortan jedoch nicht mehr verschwieg, war, dass es sich bei der Purpurschnecke um ein Meerestier mit einem muschelartigen Haus handelte, die mit der ordinären Nacktschnecke im Garten nichts gemein hatte.
Deshalb musste Caesarius stets grinsen, wenn er einen Anfangsbuchstaben künstlerisch verschnörkelt und in Purpur auf das Pergament brachte. Er hatte soeben ein Kapitel gelesen, das von einer wundersamen Lepraheilung erzählte. In ähnlicher Weise hatte er zwar bereits von einer solchen Begebenheit gehört, doch der Verfasser dieses Berichts konnte seine Aufzeichnungen derart lebendig gestalten, dass es ihm vorkam, als spielte sich die Szene unmittelbar vor seinem geistigen Auge ab. Gerade wollte er damit anfangen, die Geschichte zu übersetzen, und tauchte den gespitzten Federkiel in das kleine Behältnis mit der besonderen Farbe, als es plötzlich an der Tür klopfte. Ganz benommen, da ihn dies aus seinen Gedanken riss, nahm er einen kräftigen Schluck aus seinem Holzbecher, in den er zuvor heißes Wasser mit Pfefferminzblättern aus dem Kräutergarten gefüllt hatte.
Es klopfte erneut und diesmal antworte Caesarius.
„Gegrüßet seid Ihr, Caesarius, mein Lehrer!“ Aufgrund des schummrigen Lichts konnte der Meister nicht gleich erkennen, wer den Raum betrat. Doch als die Person näher kam, erkannte er die schlaksige Gestalt, die Malchus hieß, und die mit forschem Schritt auf ihn zutrat. In seiner Hand trug er eine kleine Pergamentrolle, die mit einem Siegelband, samt rotem Wachssiegel, verschlossen war.
„Gegrüßet seiest du, Malchus, mein bester Schüler!“ Malchus lächelte und freute sich über das Kompliment, auch wenn er dieses häufiger von seinem Meister zu hören bekam. Er verbeugte sich. „Was gibt es, dass du mich hier in der Bibliothek aufsuchst?“
„Entschuldigt die Störung, doch man sagte mir, es sei ganz wichtig, dass Ihr diese Nachricht sofort erhaltet. Der Überbringer ist ein Kurier aus einem Bruderkloster. Ich habe ihn erst einmal in die Küche geschickt, damit er sich von Bruder Sebastian etwas zu essen geben lässt und sich von seiner langen Reise ein wenig erholt. Aber er sagte mir, er dürfe nicht allzu lange verweilen und müsse noch heute weiterreiten. Deshalb wolle er auf Eure Antwort warten. Ich habe sein Pferd in den Stall bringen und eines der unseren vorbereiten lassen, damit er, nachdem er sich ein wenig erfrischt hat und Eure Nachricht verfasst ist, wieder aufbrechen kann. Ihr wüsstet Bescheid, sobald Ihr die Depesche gelesen hättet, und müsstet ihm nur sagen, wohin er zu reiten hätte!“
Caesarius blickte erstaunt drein, von einer dringenden Botschaft oder dergleichen wusste er überhaupt nichts. Er kratzte sich am Haaransatz seiner Tonsur. Seine buschigen Augenbrauen bewegten sich auf und ab wie zwei Boote auf welligem Wasser. Ob die Nachricht wirklich für ihn bestimmt war? Gespannt nahm er die Rolle entgegen und bedankte sich bei Malchus. Dieser wäre gerne noch bei ihm geblieben, um einen Blick auf den mysteriösen Inhalt der Nachricht zu werfen, doch sein Lehrer dankte ihm erneut und ‚erlaubte‘ ihm, sich zurückzuziehen – was soviel bedeutete wie, dass er seinen Meister allein lassen sollte.
Die Rolle schien aus Pergament der besten Güte zu sein. Caesarius drehte und wendete sie. Dann besah er sich das Siegel genauer und konnte erkennen, womit er es zu tun hatte. Zum Glück war er heute allein in diesem großen Raum, sodass er sich keine große Mühe geben musste, die Öffnung und vor allem den Inhalt vor unbefugten Augen geheim zu halten. Vorsichtig löste er das dunkelrote Siegel, das ein Abbild eines markanten gleichschenkligen Kreuzes trug. Somit erkannte er zwar sofort, dass die Nachricht von einem Freund stammte, wusste aber nicht, wer der Verfasser war. Mittlerweile hatten sich einige Brüder des Ordens, denen die gleiche Funktion übertragen worden war wie Caesarius oder die sich, wie er, mit denselben – oftmals mystischen – Themen auseinandersetzten, zu einer Art Freundeskreis zusammengeschlossen. Und wann immer einer von ihnen eine besondere Geschichte zu erzählen oder eine erzählenswerte Entdeckung gemacht hatte, schickten sie einander Briefe. Diese verschlossen sie stets mit ihrem eigens kreierten Siegel, das ein kleines Kreuz als Erkennungssymbol trug.
Um die Nachricht besser lesen zu können, brachte er sie ganz nah an seine Kerze heran. Es dauerte ein wenig, bis seine Augen sich auf die dargestellte Schrift einstellten, schließlich hatte er sich nun schon seit gut drei Stunden mit dem aramäischen Livret beschäftigt. Nach wenigen Augenblicken wurde ihm klar, von wem die Depesche stammte und wovon er gerade zu lesen bekam; der Verfasser hatte ihm wenige Tage zuvor bereits eine Nachricht zukommen lassen, in der er von einer interessanten Begebenheit zu berichten vermochte. Doch nun die verschlüsselten Worte? Was hatten sie zu bedeuten? Ungläubig wie der Heilige Thomas, der seinen Herrn nicht erkannte, so betrachtete Caesarius das Pergament; es wollte sich ihm nicht gleich erschließen, was er da zu lesen bekam:
Lieber Bruder im Geiste, es ist mir eine Freude, dir Folgendes mitteilen zu können:
„SEHET EIN PFEIL DES PELIKANS. ER HAT DIE SEHNE DES BOGENS VERLASSEN UND FLIEGT SAMT TITULUS. LANDUNG NAHE SATIVIC. SUCHET DIE OURIDA BEI DER STEINERNEN STUBE!
INFORMIERE DEINE ENTSANDTEN IM WALD UND SCHICKE SIE ALS-BALD AUF DIE SUCHE! LASSE VORSICHT WALTEN! MEIN BOTE ACABUS IST DER DEINE. BSCE“
Immer und immer wieder las Caesarius die Worte. Er war ganz aufgeregt. Seine schweißnassen Finger hinterließen feuchte Spuren auf dem Pergament. Und dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen und er konnte es kaum glauben. „Ein schlauer Kerl, dieser Benedikt!“, brabbelte er vor sich hin. Anhand des Kürzels BSCE hatte er längst erkannt, von wem die Nachricht stammte: Benedikt Sacer Cisterciensis Eberbach.
* * *
Benedikt gehörte dem Kloster Eberbach an, das unweit der Stadt Magonta lag und, wenn man die neue Abtei Otterberg dazuzählte, zu den größeren Zisterzienserklöstern des Landes gehörte. Caesarius und Benedikt hatten sich vor einigen Jahren auf einer Synode in Clairvaux kennengelernt und waren sich auf Anhieb sympathisch gewesen. In den wenigen Tagen in Frankreich stellten sie sehr schnell fest, dass sie durchaus identische Interessen und auch dieselbe Einstellung zum Leben besaßen. So hielten sie seither Kontakt zueinander.
Auch Benedikt beschäftigte sich auch sehr viel mit dem Wirken und den Werken Christi. Während jedoch der Heisterbacher Mönch sein Augenmerk auf die zahlreichen Wunder legte, die Jesus im Heiligen Land vollbracht hatte, galt das Interesse seines Ordensbruders jeglicher Art von Reliquien und deren oftmals kunsthandwerklich gestalteten Behältnissen. In solchen Reliquiaren bewahrte die Christenheit seit Jahrhunderten bleiche und knöcherne Körperteile von Heiliggesprochenen auf. Oder es handelte sich um deren Kleider oder Gebrauchsgegenstände – wie der Petrusstab, der in einem prachtvollen Schrein im Petersdom in Rom aufbewahrt wurde.
Da es Benedikt bislang nicht vergönnt gewesen war, in die Heilige Stadt zu reisen, stürzte er sich stets auf die Geschichten und Erlebnisse, die ihm zurückkehrende Pilger von den heiligsten Stätten des christlichen Glaubens zu berichten hatten. Ganz besonders liebte er es, den Rittermönchen zu lauschen, da diese ganz besonders fantastische, wenngleich oftmals voller Blut triefende Geschichten aus dem Morgenland erzählen konnten. Wenngleich sie sich auch oftmals in den schrecklichsten Details zum Kampf gegen monsterartige Ungläubige verloren, konnten sie nicht selten äußerst wertvolle Souvenirs präsentieren. So gelang es Benedikt zahlreiche heilige Gegenstände zu Gesicht zu bekommen: Prunkvoll vergoldete Truhen. Eiserne Medaillons. Goldgefäße mit Edelsteinapplikationen versehen. Knochenreste von zahlreichen Heiligen. Stofffetzen vom letzten Gewand Christi. Einmal sogar eine Wimper des Messias. Als ihm allerdings jemand das einst von Petrus abgeschlagene Ohr des Malchus präsentieren wollte, lief das Fass des guten Glaubens über. Zwar hatte Petrus der Überlieferung nach im Garten Gethsemane dem Malchus, einem Knecht des Hohepriesters, tatsächlich mit einem Schwert ein Ohr abgetrennt, nachdem Jesus von Judas mit dem Kuss verraten worden war. Doch wurde das Ohr von Jesus aufgehoben und Malchus wieder angeheilt. Als Benedikt den Besitzer des verschrumpelten Organs, das in einer mit zahlreichen Edelsteinen und dickem Blattgold aufwändig verzierten kleinen Holzkiste lag, darauf hinwies, stutzte dieser. Anschließend nahm er es aus der Box heraus, betrachtete es stumm und warf es aus dem Fenster, wo es von einem der streunenden Hunde gierig verschlungen wurde. Dies bestätigte Benedikt wieder, dass er sich nicht von Prunk täuschen lassen sollte. Umso mehr beeindruckten ihn nun die Geschichte eines Heimkehrers und das unscheinbare Reliquiar, das er bei sich trug. Natürlich musste er seinem Freund Caesarius davon berichten.
* * *
Nun aber lag vor Caesarius erneut eine Nachricht von Benedikt vor. Die erste Depesche, allerdings unverschlüsselt, hatte er schon ein paar Tage zuvor per Kurierdienst erhalten. In dieser erzählte ihm sein Mitbruder von einer ganz besonderen Geschichte. Zunächst ähnelte sie einer von vielen. Sie handelte von einem dieser Heimkehrer aus dem Heiligen Land.
Zunächst habe sich Benedikt, wie es seiner Aufgabe entspräche, um diesen gekümmert. Doch das, was dieser mysteriöse Bruder berichtet habe, gehöre zu den ganz besonders schaurigen Geschichten. Vor allem die Beschreibung, wie er als einer von wenigen eine große Schlacht überlebte, die sein Heer gegen die Ungläubigen hatte, sei fürchterlich gewesen. Überflüssigerweise beschrieb Benedikt die vor Blut triefenden und nahezu unaussprechlichen Grausamkeiten bis ins Detail, sodass Caesarius den Brief zweimal beiseite legte. Doch als er zu dem Passus kam, dass der Fremde im Traum gesprochen und dabei von einem Geheimnis geplappert habe, wurde es für ihn wieder interessant. Allerdings endeten Benedikts Zeilen genau dort, wo es am spannendsten wurde.
* * *
Benedikt konnte selbst nicht genau entschlüsseln, was er des Nachts – die Matutin war noch nicht allzu lange vorbei gewesen – zufällig gehört hatte. Er war aus dem riesigen kreuzgewölbten Dormitorium geschlichen, um mit schnellen Schritten den Abort im Hof aufzusuchen. Als er an der Gastkammer des Fremden vorbeikam, hörte er diesen im Schlaf sprechen. Zunächst brabbelte der bärtige Kerl undeutliches Zeug vor sich hin, doch dann stieß er einen kurzen markigen Schrei aus. Benedikt hielt inne und bekam einige durchaus spannende Phrasen zu Gehör. Diese ließen ihn plötzlich hellwach werden. Ein Schauer lief seinen Rücken herab. Vorsichtshalber tat er ein paar Schritte zur nächsten Nische auf dem Flur, um sicherzugehen, dass sonst niemand lauschte, doch er war allein. Er öffnete die Tür zur Kammer einen Spalt. Interessante Dinge konnte er aufschnappen, wenngleich sich ihm der rechte Zusammenhang nicht sofort erschließen wollte. Er war sich aber bewusst, es handelte sich um eine Sache, ein Geheimnis, das mit Sicherheit ein solches bleiben sollte. Als er schließlich spürte, wie der Mann wieder in einen tiefen Schlaf fiel, was sich durch ein gleichmäßiges Schnaufen äußerte, eilte er hinaus auf den Hof, entleerte seine Blase und schlich zurück ins Dormitorium. Keiner seiner Mitbrüder schien seine längere Abwesenheit bemerkt zu haben. Leise legte er sich auf seinen Strohsack und versuchte einzuschlafen – was ihm allerdings bis zum Morgengebet nicht gelang.
Die nächtliche Lauschaktion ließ ihm keine Ruhe. Schon am nächsten Tag hielt er es nicht länger aus, er musste dem Geheimnis auf den Grund gehen. Nach dem gemeinsam schweigend eingenommenen Mittagessen vertraten der Ritter und er sich die Füße bei einem Rundgang durch den Kräutergarten. Als sie schließlich allein im Kreuzgang vor dem Kapitelsaal standen, kam Benedikt zur Sache. Während der noch immer von der Sonne des Südens gebräunte Fremde sich zunächst sträubte – wie sollte er sich sicher sein, inwieweit er diesem Mönch sein Vertrauen schenken konnte – schien Benedikts Zusicherung seiner Verschwiegenheit ihn letztendlich zu überzeugen. Seine Gesichtszüge, die sich hinter seinem spitzen Bart zu einer eisernen Maske formiert hatten, entspannten sich. Anscheinend kam er zu der Erkenntnis, dass es ihm durchaus gut tun könnte, sein Geheimnis mit jemandem zu teilen. Nach wenigen Sätzen riss der Mönch seine Augen soweit auf, dass sie größer waren als die Hostien, die sein Abt bei der Eucharistiefeier verwendete.
„Bruder, Ihr müsst schwören, dass Ihr keinem Menschen davon erzählt!“, bat ihn der Fremde inständig um Diskretion. „Das Wissen um diese Geschichte kann für alle, auch für nicht unmittelbar Beteiligte, äußerst gefährlich werden. Schwört!“ Benedikt schwor.
Die Geschichte war außergewöhnlich, und er wusste, dass es ihm schwerfallen würde, das Gehörte in einer seiner geistigen Schubladen abzulegen, von denen er schon so viele in sich trug und in denen es nur so wimmelte vor spannenden, wenngleich nicht selten wirren Rittergeschichten. Auch wenn seine Erzählung so unglaublich wirkte, schenkte Benedikt diesem weißbärtigen und sonnengegerbten Kerl Glauben. So nahm er sich vor, tatsächlich niemandem davon zu erzählen – zunächst.
Einige Tage später verabschiedete sich der Fremde und machte sich auf seinen Weg gen Norden. Benedikt bedauerte dies sehr, denn in der gemeinsamen Zeit, die ihnen verblieben war, hatten sie sich regelmäßig zu äußerst interessanten Gesprächen getroffen. Einmal erhielt Benedikt sogar die Gelegenheit, die geheimnisvollen Gegenstände anzusehen, von denen sie sprachen und die in schlichten Kästchen verbracht waren. Zunächst zweifelte er deren Echtheit an, zu unglaublich kam ihm die Geschichte vor. Doch je häufiger er sich mit dem mysteriösen Rittermönch traf, desto mehr verflüchtigten sich seine Zweifel wie Alkohol aus einem offen gelassenen Medizinfläschchen. Benedikt fiel der Gedanke schwer, sich nun wieder auf seinen Routinealltag einstellen zu müssen, der erst wieder unterbrochen werden sollte, sobald ein neuer Heimkehrer an der Pforte klopfte. Allerdings sollte die Routine sich nicht einstellen, denn noch am selben Tag ereignete sich etwas, dass ihn sehr schnell dazu veranlasste, seinen Schwur zu brechen und die Geschichte entgegen seinem Versprechen weiterzuerzählen.
Obwohl er sich im Klaren darüber war, dass er somit eine Sünde begang, fühlte er sich dazu verpflichtet, dem sympathischen Fremden Hilfe zukommen zu lassen. Nein, er konnte den Mann nicht ins offene Messer laufen lassen. Seines Erachtens musste er diesen Verstoß in Kauf nehmen, zumal es um Leben und Tod ging – später würde er dafür einige Vaterunser als Buße beten. Fest entschlossen, das Richtige zu tun, ließ er Caesarius eine Nachricht zukommen. Er wusste, dass der Reiter genau in die Region aufgebrochen war, in die das Heisterbacher Kloster einen Gründungskonvent, bestehend aus einem Abt und zwölf Mitbrüdern, entsandt hatte. Sie hatten den Auftrag erhalten, in diesem weitläufigen Waldgebiet den geeigneten Ort für ein neues Zisterzienser-Kloster zu finden.
Der Grund für den Bruch seines Schwurs ereignete sich bereits kurz nachdem der Fremde abgereist war. Benedikt sollte mit einem Mal etwas erkennen, was den Geschichten des Fremden deutliche Glaubwürdigkeit verlieh und zudem, dass sich der Mann in akuter Lebensgefahr befand. Denn kaum hatte der Bärtige mit seinem Pferd den Klosterhof verlassen, klopfte ein Trupp äußerst finster dreinschauender Personen an die Pforte. Benedikt wunderte sich im Nachhinein, dass diese Kerle den Mann nicht gleich dingfest gemacht hatten, denn eigentlich mussten sie ihm noch an der Klostermauer begegnet sein.
Die Gruppe bat um Einlass – oder besser, sie forderte diesen. Ihr Anführer verlangte, sofort den Abt zu sprechen. Dieser zuckte sichtlich zusammen, als ihm einer seiner Mönche berichtete, dass eine Reitergruppe aus Frankenvurd an der Pforte geläutet und sich sehr schnell Zutritt verschafft hatte. Es war nichts Neues und auch nicht selten, dass finstere Vasallen verschiedenster Herren oder im Auftrag des Vatikans in Eberbach aufkreuzten; schließlich gehörte der Konvent aufgrund seiner Nähe zu Frankenvurd und Magonta zu einem der einflussreicheren und ob der ihm zugesprochenen Ländereien auch wohlhabenderen Klöster.
Diesmal handelte es sich bei den Mannen um die Schergen der in Kirchenkreisen berühmt-berüchtigten Organisation Die Strengen Augen Gottes. Diese Vereinigung unterstand unmittelbar dem Vatikan, was sich unter anderem an dem ähnlich gestalteten Wappen erkennen ließ. Wie das Zeichen des Vatikans, so zeigte auch ihres zwei gekreuzte Schlüssel. Allerdings erhob sich über diesen, anders als im Vatikanwappen, ein goldenes Dreieck. Aus diesem stachen zwei streng dreinschauende weiße Augen mit purpurfarbenen Pupillen hervor.
Den Strengen Augen Gottes oblag die Aufgabe, den Strom der Rückkehrer aus dem Süden zu überwachen und insbesondere deren Mitbringsel zu sichten; bei Bedarf zu konfiszieren. Der Anführer der Organisation nannte sich Vinzenzo Santos. Selten hatte ihn jemand zu Gesicht bekommen und es wurde gemunkelt, dass er entgegen der Vermutung, er könnte ob des Namens Römer sein, dem Deutschen Reich entstammte.
Santos saß wie eine Spinne im Netz in Rom. Mittlerweile hatte er ein Netz gesponnen, das aus Dependancen in fast allen großen Städten des Reichs bestand. Die Leitung dieser Niederlassungen übertrug er handverlesenen und vor allem kaltschnäuzigen Despoten, die wiederum gerne skrupellose ehemalige Söldner um sich scharten. Aber oftmals gelang es ihnen auch hochmotivierte junge Adelssprosse, die eigentlich zum Kampf gegen die Ungläubigen aufbrechen wollten, davon zu überzeugen, dass es genauso wichtig sei, die christlichen Werte im eigenen Land zu verteidigen. So bestand die Aufgabe der Organisation zum einen darin, Informationen des Vatikans folgend, auffällige Heimkehrer unter die Lupe zu nehmen und dabei möglichst viele Reliquien sicherzustellen – wobei es ihnen ausdrücklich erlaubt war, bei auftretendem Widerstand, die Liquidierung des Heimkehrers in Kauf zu nehmen. Denn aus Sicht der Strengen Augen, und letztendlich der Führung in Rom, gab es zu viele Menschen, die sich am Eigentum der Kirche bereicherten und mit ihren haarsträubenden Geschichten deren Wohl schadeten.
Insbesondere die Ritter des Templerordens waren dem Vatikan ein Dorn im Auge. Einerseits war ihm der Orden mittlerweile viel zu mächtig geworden. Andererseits ärgerte man sich insbesondere über die Rückkehrer, die sich dem Dienst nur auf Zeit verschrieben hatten und sich nach Ablauf ihrer Zugehörigkeit zu den Templern niemandem mehr verpflichtet fühlten, schon gar nicht dem Vatikan. Und da die Templer ihren Sitz in Jerusalem, dem Zentrum des Glaubens, hatten, waren sie es, die meist einen heiligen Gegenstand in ihrem Gepäck mitführten, um ihn gegebenenfalls – zum eigenen Seelenheil – einem heimatnahen Konvent zu stiften. Und da sich der Vatikan das alleinige Eigentumsrecht an sämtlichen Reliquien vorbehielt, war jegliches Geschäft oder jedwede unerlaubte Weitergabe eines solchen Objekts strafbar – abhängig davon, ob die Echtheit bereits von offizieller Stelle verifiziert worden war oder nicht. Doch allein die Behauptung, in dem Gefäß würden sich die sterblichen Überreste eines Heiligen befinden, führte – sofern sich dieses noch im Privatbesitz befand – schon zum Straftatbestand. Und dieser wurde im günstigen Fall mit Freiheitsentzug in einem modrig kalten Kerker oder mit dem Abhacken einer Hand oder im schlimmsten Fall sogar mit dem Tod bestraft. Das Ermessen für das Strafmaß lag bei den von Vinzenzo Santos beauftragten Personen und deren Helfershelfern.
Die nun in Eberbach aufgetauchte Gruppe der Strengen Augen aus Frankenvurd wurde von einem düsteren Kerl namens Zacharias von Homburg angeführt. Dieser hatte vor einigen Tagen wieder einmal eine Botschaft aus Rom erhalten, die von einem suspekten Heimkehrer berichtete. Sein Auftrag: Gegenstände sichern und Person gegebenenfalls liquidieren. Von Homburg stellte umgehend eine Gruppe von fünf besonders Angst einflößenden Exemplaren zusammen und machte sich ob der Brisanz der außergewöhnlichen Gegenstände sofort mit ihnen auf den Weg.
Nachdem sie die Pforte passiert hatten, sprangen sie von ihren Pferden und schritten sogleich über den Hof zum Kapitelsaal. Es war nicht das erste Mal, dass dieser Zacharias das Kloster im Rheingau aufsuchte. Da die Zisterzienser – seit dem Aufruf ihres Anführers Bernhard von Clairvaux vor nahezu einem halben Jahrhundert – sehr eng mit den Kreuzzugsteilnehmern kollaborierten und den heimkehrenden Rittern gerne Unterschlupf boten, wurden die Trupps der Organisation des Öfteren deren Klöstern vorstellig.
Lautstark ließ Zacharias von Homburg sofort nach dem Abt rufen und machte es sich derweil auf dessen gepolstertem Stuhl gemütlich. Von Homburg war ein kleiner, untersetzter Kerl. Sein bleiches, fleischiges und fast kreisrundes Gesicht schien halslos auf seinem Rumpf zu sitzen. Obgleich er belustigend aussah, eilte ihm der Ruf voraus, ein knallharter und skrupelloser Reliquienjäger zu sein.
Arrogant und mit unverblümt schroffen Worten stellte er zunächst dem Abt seine Fragen, bevor er zusätzlich den Prior ins Kreuzverhör nahm. Sein Interesse galt einem mysteriösen Ritter. Dieser sei äußerst gefährlich und vor allem ein Dieb. Er führe etwas in seinem Besitz, das der Kirche gehöre. Sowohl der Klosterleiter als auch sein Stellvertreter konnten dem penetranten Nachfragen ihres Gegenübers, dessen Stimme einen quiekenden Unterton besaß, nur unzulänglich antworten. Natürlich missfiel dies Zacharias und er setzte sein finsterstes Gesicht auf. Getrieben von Panik kam dem Prior eine Idee: Pater Benedikt – hatte dieser sich nicht in den letzten Tagen um einen zerschlissen aussehenden Kerl gekümmert?
Als er vor die Versammlung trat, wurden Benedikts Knie butterweich – und das, obwohl er sich nie hatte etwas zu Schulden kommen lassen. Breit grinsend lehnte Zacharias von Homburg sich im Stuhl des Abtes zurück und fixierte, oder besser durchbohrte, sein Gegenüber mit einem Paar stahlblauer Wolfsaugen. Benedikt gefror fast das Blut in den Adern und er sank vorschriftsmäßig auf die Knie. Er schauderte. Die Szene ähnelte vielmehr einem Tribunal statt der routinemäßigen Anhörung, wie es der Prior angedeutet hatte.
Zum Glück hatte ihn einer seiner Mitbrüder bereits über die Vorgehensweise des fettleibigen Kerls gewarnt, weshalb er ihm nicht ins offene Messer lief. Einige von ihnen waren in der Vergangenheit bereits in die Verlegenheit geraten, von Homburg gegenübertreten zu müssen. Somit war dessen Taktik bestens bekannt: Zunächst würde er versuchen, ihn mit süßen Worten einzulullen und dann pfeilschnell seine eigentliche Frage platzieren. Konnte diese nicht oder nicht ausreichend beantwortet werden, würde er keinen Moment zögern, seinem Unmut Ausdruck zu verleihen. Sein finster dreinschauendes und in strenge Furchen gelegtes Gesicht deutete bereits an, was folgen sollte.
Benedikt harrte kniend vor ihm aus und ließ sich von dem Hohelied Zacharias’, das er auf die Wichtigkeit der Rückkehrerbetreuung von sich gab, nicht ablenken. Für einen kurzen Augenblick glitt sein Blick über Zacharias’ Schultern hinaus. Hinter ihm reihten sich seine finster dreinblickenden fünf Protektoren auf. Wie aufgemischte Kettenhunde standen sie da und schienen nur darauf zu warten, dass man ihnen einen Happen zum Zerreißen zuwarf. Er war sich sicher, diese Männer würden keine Sekunde zögern, sofern seine Antworten nur ordentlich genug danebenlägen, ihn ohne jegliche Gefühlsregung und im Auftrag von Zacharias auf direktem Weg ins Himmelreich zu befördern. Seine Zunge trocknete von jetzt auf gleich, als sei ein Wüstensturm durch seinen Mund gezogen.
Gerade hüstelte er verlegen, als Zacharias zu dem Punkt kam, auf dem sein eigentliches Augenmerk lag, zu dem mysteriösen Fremden. Benedikt berichtete sachlich, wie er den recht ausgemergelten Mann vor ein paar Tagen, wie es der carta caritatis entsprach, aufgenommen und aufgepäppelt hatte. Allerdings reichte dem Reliquienjäger diese knappe Antwort nicht aus. Bis in alle Einzelheiten ließ er sich von dem Mönch die Zeit sezieren, die der Fremde in Eberbach verbrachte hatte.
„Und sonst hat er Euch nichts erzählt? Er kam doch aus dem Heiligen Land! Keine blutrünstigen Geschichten? Irgendwelche Mitbringsel?“ Benedikt äußerte sich vage und lief damit Gefahr, Zacharias’ Geduld zu verlieren und vor allem seine Gunst zu verspielen. Allerdings hinderte ihn irgendetwas daran, mit der vollen Wahrheit herauszurücken.
Zacharias erhob sich vom Abtstuhl und trat auf den knienden Mönch zu. Sein Blick glich einem glühenden Pfeil, der sich tief in Benedikts Augen bohrte. „Und er hat nicht gesagt, wohin er wollte?“ Benedikt ereilte das Gefühl zu schwanken. Im Geiste wog er ab, was er ihm als Antworthappen zuwerfen konnte, ohne damit den Fremden in die Bredouille zu bringen. Ihm war bewusst, dass er von Homburg etwas liefern musste, sonst liefe er Gefahr, zu guter Letzt diese Anhörung selbst nicht heil zu überstehen. Somit beschloss er, eine Kleinigkeit preiszugeben: „Also, soviel ich von dem Fremden erfahren habe“, erzählte Benedikt, „reitet er gen Norden – in das Waldgebiet westlich der Herborer Mark!“ Von Homburg grinste ihn schief an – er hatte die Information, die er haben wollte.
* * *
Caesarius besah sich die Nachricht seines Freundes erneut und las sie Wort für Wort. Was um alles in der Welt wollte er damit sagen?
„Landung in Sativic. Steinerne Stube! Informiere deine Entsandten im Wald! Vorsicht!“ Er wurde nicht schlau daraus.
„Sativic?“, murmelte er leise vor sich hin. Er hatte keine Ahnung, was oder wen Benedikt damit meinen konnte.
„Steinerne Stube?“ Er senkte den Zettel und schloss die Augen. Dann ging er in der Bibliothek auf und ab. „Keine Ahnung!“
„Informiere deine Entsandten?“, brabbelte er unentwegt und fast resigniert.
„Entsandte!“ Plötzlich fiel ihm ein, worauf Benedikts Worte abzielen könnten.
Vor wenigen Wochen hatte er ihm in einem Brief erzählt, dass sein guter Freund Hermann und zwölf weitere Brüder des Heisterbacher Konvents zu einer Reise aufgebrochen waren. Ziel ihrer Mission war eine entlegene Region, der sogenannte Westerwald – ein Waldstück, das sich westlich des ehemals vom fränkischen König geführten Hofs, nun Herboremarca genannt, über ein riesiges Areal erstreckte. Markant an diesem Gebiet war, dass seit Jahren pulsierende Handelsstraßen genau dort hindurch verliefen, weshalb man dem Landstrich eine prosperierende Zukunft voraussagte. Zudem ließ der Kaiser zurzeit in dieser Region zahlreiche Burgen bauen. Natürlich blieb diese Entwicklung auch den Zisterziensern nicht verborgen. So sprach sich die Versammlung der Äbte auf der letzten Synode in Clairvaux dafür aus, in dieser Gegend einen neuen Konvent zu gründen.
Caesarius wusste nun, was er zu tun hatte. Sofort nahm er ein sauber geschabtes Stück Pergament aus seiner Schatulle neben dem Stehpult, die stets von Malchus mit Nachschub versorgt wurde. Er griff nach seiner Feder und verfasste eine Nachricht, die die verschlüsselten Angaben seines Mitbruders aus Eberbach enthielt.
Hermann wird meine Worte schon verstehen – oder?