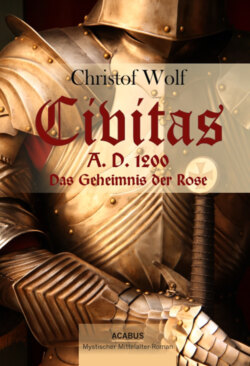Читать книгу Civitas A.D. 1200. Das Geheimnis der Rose - Christof Wolf - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
HOLZBACHSCHLUCHT
ОглавлениеDie Morgenluft war frisch. Hier und da zeigten die Wiesen sich von Raureif weiß gepudert. Antonius freute sich stets auf den Gang durch die Schlucht; zum einen konnte er dadurch dem in seinen Augen eintönigen Mühlenalltag entfliehen und zum anderen auf dem Näherschen Hof – sofern sich dort weitgereiste Menschen einfanden – ein wenig Weltluft schnuppern. Wie gerne würde er einmal mit Gregor gemeinsam nach Seckaha zur großen Waldkreuzung fahren, denn dort gab es, wollte er dessen Aussagen Glauben schenken, so viele interessante Sachen zu sehen. Und damit hatte der Knecht völlig Recht.
* * *
Wenn auch weit ab von den weltlichen und geistlichen Machtzentren der Welt, so konnte die kleine Siedlung Seckaha, aufgrund ihrer markttechnisch günstigen Lage im Deutschen Reich, einen gewissen Wohlstand erlangen. Wie eine Hauptschlagader so pulsierte der Handel auf der Straße von Sigena nach Magonta, die in einer Nord-Südachse an Seckaha vorbeilief und quasi fast vor Ort auf die in Ost-Westrichtung verlaufende Heerstraße traf. So profitierte die kleine Siedlung seit Jahren von der sich stetig erhöhenden Handelsfrequenz und ein Ende schien nicht abzusehen.
Fast täglich nahm die Zahl der Händler und Reisenden zu. Auch die Zahl der Einwohner Seckahas stieg und die ersten fremden Handwerker ließen sich nieder. Unter ihnen ein Wagner aus Franken, der sich eigentlich auf der Durchreise befand. Als er sah, welch ein Fuhrwerksaufkommen in dem kleinen Nest an der Waldkreuzung herrschte, kam er nicht mehr umher, dort seine eigene Werkstatt zu gründen. Noble Kutschen, deren Radlager Schaden genommen hatten, schwer beladene Loren und Ochsenwagen mit Achsenbruch; es gab stets etwas zu reparieren und vor allem zu verdienen. Als nächster erkannte dies ein Sattlermeister aus dem nicht allzu fernen Herbore. Mit dem Angebot seiner Sattlerei, die mit ausgezeichneten Lederriemen und bestem Sattelzeug so manchem Reiter aus der Patsche helfen konnte, schaffte er sich und seiner fünfköpfigen Familie eine sattelfeste Existenz. Der nächste war ein Weber, gefolgt von einer Gerberfamilie und einem einäugigen Färber. Angelockt von den günstigen Bedingungen, wozu nicht zuletzt die nahe Lage zum Holzbach gehörte, witterten auch sie die Chance, vom steigenden Handelsaufkommen zu profitieren.
Und selbst ein kleiner Frauenkonvent, der von einer strengen Nonne namens Agathe gegründet wurde, konnte sich mittlerweile am Waldesrand etablieren. Seligenstatt nannte sie ihre Gottesherberge, wenngleich Agathes striktes Regiment das Kloster nicht gerade zu einer Stätte der Glücksseligkeit werden ließ. Gleichwohl wurde sie in Kirchenkreisen dafür bewundert, da es ihr gelungen war, in dieser unwirtlichen Gegend ein Frauenkloster aufzubauen, in dem Adelige aus der ganzen Region eine willkommene Möglichkeit sahen, ihre ‚überzähligen‘ Töchter ausbilden, versorgen oder gar verwahren zu lassen. So bot Seligenstatt eine elegante und vor allem günstigere Alternative zu der Notwendigkeit, eine weitere Hochzeitsmitgift zu zahlen. Während dies für die Erstgeborene obligatorisch war, hielten viele Familien eine weitere Zahlung für die später zur Welt gebrachten Töchter für so notwendig wie verschüttetes Wasser. Der Gang des Mädchens ins Kloster und die damit einhergehende Vermählung mit Jesus Christus war somit wesentlich günstiger. Deshalb trug auch Schwester Agathe, die vom Volksmund als die „Eiserne Jungfrau“ bezeichnet wurde, zum Wohle Seckahas bei, indem wohlhabende Adelige ihre Töchter nach Seligenstatt brachten und vor Ort ihre Heller, Pfennige und Hälblinge ausgaben.
* * *
An manchen Tagen – insbesondere vor den großen Markttagen in den größeren Städten wie Herbore oder Lintpurc – herrschte an der Kreuzung ein reges Treiben. Schon früh am Morgen brachen dann auch einige Anwohner aus Severus dorthin auf, um ihre Erzeugnisse in Form von geschnitzten Löffeln, Heugabeln, ausgelassenem Schmalz, Fetttöpfen und Rauchfleisch feilzubieten. In den Wintermonaten verkauften sie zudem aufgeklaubtes Brennholz aus dem Kirchhölzchen.
„Es gibt nichts, was dort nicht auf dem Handelsweg von Nord nach Süd und umgekehrt transportiert wird. Du würdest Augen machen, Toni!“ Gregor weckte damit Antonius’ Neugier. „Manchmal werden feine bunte Stoffe, die nicht selten sogar aus italienischen Tuchhäusern stammen, angeboten. Oder ausgezeichnete Lederriemen, aus denen sich nicht nur Pferdegeschirre, sondern stattliche Gürtel fertigen lassen!“ Einige Dinge würden jedoch unerschwinglich bleiben. Salzblöcke zum Beispiel, an denen die Händler mit scharfen Messern kratzen und dessen Staub sie dann für unglaublich hohe Preise verkauften. „Salz ist wie weißes Gold!“, wusste Gregor zu berichten. Aber auch exotische Gewürze aus fernen Ländern würden dargeboten, mit Namen, von denen er, wie die meisten Leute in dieser Gegend, noch nie etwas gehört hätte. Und Gregor wusste, wovon er sprach, schließlich durfte er Dagoberth Näher stets zur Kreuzung begleiten und konnte Antonius im Anschluss immer äußerst spannende und manchmal unglaubwürdig anmutende Geschichten erzählen.
Gerade letzte Woche habe er seinen Herrn wieder einmal mit dem Ochsengespann zur Kreuzung gefahren, da dieser unter anderem ein paar günstige, wohlgemerkt aus Oberitalien stammende, gefärbte Stoffe für den Geburtstag seiner Frau einkaufen wollte. Plötzlich habe ihn fast der Schlag getroffen, als eine Gruppe fremdländischer Händler vorbeigekommen sei. Es habe sich um dunkle Gestalten gehandelt, deren Gesichter so schwarz wie eine frische Ackerscholle gewesen seien. Ihre Umhänge hingegen hätten alle Farben des Regenbogens aufgewiesen. Fein gewobene Tücher seien wie Schlangenleiber um ihre Köpfe gewickelt gewesen, sodass fast nur noch ihre Augen zu sehen gewesen seien. Die Augäpfel hätten wiederum so weiß hervorgestochen wie das Weiß eines hart gekochten Eis. Vor allem aber hätten sie tatsächlich zwei merkwürdig geformte, riesige Tiere mit Höckern auf dem Rücken bei sich geführt. Im ersten Moment habe er glaubt, man hätte den armen Geschöpfen Getreidesäcke unter die Rückenfelle gepflanzt. Gregor sei vor Schreck fast in Ohnmacht gefallen, da er solche komischen Gäule noch nie gesehen hatte. Sie seien mindestens zweimal so groß gewesen wie das größte Ross auf dem Näherschen Hof.
„Schreckliche Kreaturen! Richtig unheimlich! Große, breite und vor allem gelbe Zähne hatten die Biester. Die Unterlippen hingen wie beim alten, zahnlosen Jupp nach unten. Auch beim Kauen standen sie dem alten Knecht in nichts nach. Auch sie schieben ihren Unterkiefer unermüdlich von rechts nach links. Und dann diese riesigen Nüstern. Denen entfuhr ein unerträglicher Gestank. Wenn eines der Biester nieste, schoss die Rotze hervor und man musste in Deckung gehen!“ Gregor schüttelte sich, als er dem jungen Müllersohn davon erzählte. Er konnte sich richtig in Rage reden, wenn er von dieser Begegnung erzählte. Antonius hatte zwar noch nie eines dieser Ungetüme gesehen, konnte sie sich aber dennoch ziemlich genau vorstellen.
In seinen religiösen Geschichten, die Ignazius ab und zu erzählte, hatte er das sonderbare Tier schon sehr häufig und ausführlich beschrieben. „Drei weise Könige waren es, die das Jesuskind besuchten und ihm Geschenke brachten! Einer von ihnen war rabenschwarz und ritt auf einem zotteligen Kamel …“ Und da die Mühlenkinder sich nicht vorstellen konnten, was das für ein Geschöpf sein sollte, kritzelte er die Umrisse dieses geheimnisvollen Tiers mit einem Stück Holzkohle auf den hölzernen Tisch. Zwar hatte er selbst noch kein Kamel in Natura gesehen, doch hing im Empfangsraum des Abts ein Bildnis, das die Ankunft der drei Heiligen Könige vor dem Stall in Bethlehem zeigte. Somit deckte sich Ignazius’ Skizze mit Gregors Beschreibung.
Und gerade diese Geschichten und die zahlreichen Erzählungen, die auch die Händler und Reisenden stets von ihren Erlebnissen zu berichten wussten, waren es, die in Antonius ein fast schmerzendes Gefühl von Fernweh und Abenteuerlust erzeugten. Doch anstatt selbst Abenteuer zu bestreiten oder ferne Länder zu bereisen, hatte er es in den fünfzehn Sommern, die er nun bereits auf der Erde weilte, gerade einmal bis auf den westlichen Ziegenberg geschafft oder nach Norden in den zweiten und größeren klostereigenen Wald – der deshalb auch Pfaffenwald genannt wurde.
Gut, vor einigen Jahren durfte er seinen Vater zur Tongrube begleiten, die am südlichen Ende des Tals lag. Unterstützt durch die schier unermüdliche Kraft von Kruzi und Fix mussten sie eine ordentliche Wagenladung Tonmasse zum Kloster schaffen. Die Mönche, die in ihrer Kreativität, was den Kirchenbau betraf, stets eine Vorreiterrolle spielten, planten daraus eine besondere Form von Ziegelstein brennen zu lassen. Diese wollten sie für die Umleibung eines neuen Fensters im seitlichen Kirchenschiff verwenden.
Sein Vater nahm ihn damals mit und gemeinsam marschierten sie über einen uralten, vor allem aber mystischen Pfad, der sich durch das Kirchhölzchen bis hin zum sagenumwobenen Steinköppel schlängelte. Dieser Hügel bestand aus einem Basaltkegel auf dessen Rücken sich in grauer Vorzeit einige, in Antonius’ Augen gespenstische, Gesteinsformationen gebildet hatten.
* * *
„Hör zu, mein Sohn“, begann Arthur fast im Flüsterton, um die Spannung für seinen Sohn, damals noch ein Knabe, ein wenig aufzubauen, „was du da siehst, das sind versteinerte Geschöpfe aus der Zeit unserer Ahnen!“ Antonius riss seine Augen auf und trat einen Schritt näher zu seinem Vater. „Keine Angst, mein Kleiner, die standen schon hier, als ich so alt war wie du. Bereits mein Vater erzählte mir – und sein Vater ihm – die Geschichte dieser Steinriesen: Er sagte, es handele sich bei den Felsen um eine Jägerfamilie, die auf Wanderschaft gewesen sei. Sie sei auf der Suche nach einem günstig gelegenen Platz für eine Ansiedlung gewesen, als sie plötzlich hier oben von einem großen Feuer- und Steinregen überrascht wurden. Noch ehe sie es sich versahen, prasselte heißer Schuttregen auf sie ein und ließ sie zu Stein erstarren: den Vater und die Mutter sowie zwei ihrer großen Kinder!“ Theatralisch zeigte Arthur auf die vier Felssäulen. „Allerdings blieben ihre beiden Kleinsten verschont. Der Junge und das Mädchen hatten sich heimlich von der Familie entfernt, da sie von einer steilen Hügelkante einen Blick ins Tal werfen und die letzten wärmenden Sonnenstrahlen aus dem Westen erhaschen wollten. Als der steinerne Regen einsetzte, kauerten sie sich unter einen mächtigen Baumstamm zusammen, den der Wind zuvor quer über den Hang gelegt hatte. Als der Niederschlag nachgelassen hatte und sie sich schließlich aus ihrem Unterschlupf heraustrauten, liefen sie an den Ort zurück, wo sie die anderen vermuteten. Doch sie fanden sie nicht. Sie warteten und warteten, da sie nicht erkannten, dass die grausame Himmelsflut die Familie über und über mit brennendem Gestein und Staub bedeckt hatte. Ja, sie war ganz langsam zu Stein geworden. Die Sonne verschwand hinter dem Berg, den wir heute unseren Ziegenberg nennen. Ängstlich liefen sie zum Sonnenplateau zurück, da dort das Licht am längsten währte. Sie fürchteten sich vor der Dunkelheit und umarmten einander. Tränen flossen wie Sturzbäche, so herzerweichend begannen sie zu weinen. Der Abendhimmel klärte sich langsam auf und ein leuchtendes Rot löste die dunkelgrauen Wolken ab. Majestätisch zog ein riesiger Bussard seine Kreise in der Luft. Angelockt von den kindlichen und verzweifelt klingenden Tönen flog er zu ihnen hinab. Vorsichtig und doch gezielt ergriff er die beiden mit seinen Krallen. Das Tier hatte alle Mühe die Kinder ins Tal zu bringen, wo es die beiden an einer sicheren Stelle absetzte und schließlich davonflog.“
Antonius lauschte gebannt den Worten seines Vaters und traute sich nicht, auch nur einen Laut von sich zu geben. „Doch die Kleinen wurden nun nicht ihrem Schicksal überlassen, sondern es passierte so etwas wie ein Wunder! Denn fortan kam der Riesenvogel jeden Tag zu ihnen geflogen und versorgte sie aus der Luft. Mal brachte er ihnen ein erlegtes Kaninchen und manchmal ließ er einen Fisch zu ihnen hinabfallen, den er im Holzbach erbeutet hatte. Er baute sich tatsächlich ein Nest auf dem Sonnenplateau, von wo er die Kinder im Blick behalten und vor Unheil beschützen konnte.“
„Und seitdem heißt der Aussichtspunkt da vorne die Sonnenkanzel?“, warf Antonius ein und war ganz Ohr ob der Antwort seines Vaters. Er konnte es gar nicht erwarten, dass dieser ihm noch mehr von der spannenden Geschichte erzählte. Mittlerweile waren sie am Rand eines lang gezogenen Hügelrückens vorbeigegangen, der deshalb auch der Ellenberg genannt wurde, und erreichten alsbald eine weit geschwungene Lichtung. Aufgrund des guten Spähblicks auf Severus und einer natürlichen Waldlücke, durch die die Heerstraße ums Tal herumführte, nannte man den Hügel auch den Lückersspiegel, wobei das lateinische Wort specular für Spähhügel von den Einwohnern einfach in Spiegel umgeformt wurde.
Zum Schutz des Klosters und der Ansiedlung vor Übergriffen waren dort auf der gegenüberliegenden Seite des Hügels bereits vor vielen Jahren – von Abt Amos persönlich angeordnet – permanent besetzte Wachtürme errichtet worden, schließlich bot genau diese Baumlücke die einzige Öffnung in das hufeisenförmige Tal. Seit dieser Zeit erklang stets dann, wenn eine größere Menschenmenge oder gar ein Heer in der Ferne erspäht wurde, das eindringliche Signal eines hohlen Ochsenhorns. Den Mönchen und Bewohnern Severus’ blieb somit ausreichend Zeit, sich in Sicherheit zu bringen.
Allerdings musste Amos damals das Zugeständnis machen, damit die Männer des Ortes für den Wachdienst bereit waren, dass sämtliche Frauen und Mädchen hinter dem ringförmigen Steinwall, der die Klostergemäuer umgab, Schutz finden konnten. Severus selbst wurde durch einen Weidenflechtzaun geschützt, der eine doppelte Mannshöhe aufwies. Von Außen verstärkten sie diesen mit stichigen Dornbüschen. Den Zugang erhielt man lediglich durch zwei wuchtige Eichentore, die des Nachts geschlossen wurden und im Notfall zusätzlich mit zwei querliegenden Riegeln aus Baumstämmen verbarrikadiert werden konnten. Sobald das Horn erklang, brachten sie Kinder und Weibsvolk in Sicherheit. Anschließend versammelte sich die mehr oder weniger kampferprobte Männerschar hinter den Toren. Hochmotiviert und zu allem entschlossen warteten sie dort, bewaffnet mit dreizackigen Heugabeln und hölzernen Hacken sowie geschmiedeten Eisenhämmern und blank geschliffenen Äxten auf den Feind. Ja, bis zum heutigen Tag zeigten sich die Bewohner am Fuß der sagenumwobenen Sonnenkanzel stets wehrbereit – wenngleich sie ihr Können und ihren Mut glücklicherweise nie unter Beweis stellen mussten.
„Nun gut, der Begriff Sonnenkanzel wurde erst vor einigen Jahrzehnten geprägt. Unsere Vorfahren erzählten natürlich die Legende vom Riesenvogel und dem Geschwisterpaar von Generation zu Generation weiter – so, wie ich sie dir jetzt weitergebe. Also verehren wir bis heute die Mär unserer Ahnen. Aus dieser Verehrung heraus wundert es einen nicht, dass – wenngleich Hunderte von Jahren später – genau dort das Sankt Severus Kloster gebaut wurde, wo der Bussard die Kinder nach der Rettung abgesetzt haben soll.“
„Ja, und was hat es jetzt mit dem Namen ‚Sonnenkanzel‘ auf sich?“
„Nicht so ungeduldig, mein Sohn. Damals, also noch vor der Verkündung der Heilslehre Christi, hat man sich jedes Jahr zur Sommersonnenwende – du weißt, an dem Tag im Jahr mit der größten Zahl an Sonnenstunden und der kürzesten Nacht – am Steinköppel eingefunden und dort Opfer gebracht. Damals, so sagt man, sei es sogar zu Menschenopfern gekommen!“ Antonius riss seine Augen erneut weit auf und konnte nicht glauben, was sein Vater da erzählte. „Richtige Rituale haben dort stattgefunden, zu Ehren der versteinerten Menschen und in Gedenken an das gerettete Geschwisterpaar. Später seien es dann lediglich Tieropfer gewesen. Nun, und heutzutage, nutzt unser Abt diesen Tag für sich und beordert uns alle zum Sonnenplateau, wo wir uns seine Ansprache, das Hohelied auf die Kirche, von der Kanzel anhören – deshalb heißt sie also Sonnenkanzel!“
Diese und noch mehr Geschichten, die sein Vater, aber auch Gregor erzählten, kamen Antonius stets in den Sinn. Fortwährend fragte er sich, wie die Welt wohl hinter den Gemarkungsgrenzen von Severus aussehen könnte. Wie weit hätte er wohl zu gehen, um ans Ende der Welt zu gelangen – dorthin, wo plötzlich alles aufhörte? Er stellte sich vor, dass dort ein riesiger Graben sein musste, so tief, dass man auch am helllichten Tag den Grund der Schlucht nicht sehen konnte. Die Holzbachschlucht wäre dagegen noch nicht mal ein kleines Lachfältchen in der Haut von Mutter Erde.
Würde man es früh genug sehen? Oder würde man einfach in die Tiefe stürzen? War überhaupt ein Mensch, der ans Weltende gelangt war, jemals wieder von dort zurückgekehrt? Er war sich nicht sicher. Außerdem hatte ihnen einer der Händler erzählt, dass nach dem Festland erst einmal eine unendlich große Wasserfläche folgen würde. „Das Ende der Welt muss dann wohl dahinter liegen!“ Doch weder der Knecht, und erst recht nicht Antonius, konnten sich vorstellen, woher all das Wasser kommen sollte. „Fließt es dann nicht am Weltende von der Kante, wie bei einem überlaufenden Bottich?“ Für Antonius war es faszinierend aus erster Hand bestätigt zu bekommen, dass die Welt da draußen, also hinter den Grenzen von Severus, hinter dem steil ansteigenden Ziegenberg, hinter der grünen Aue des Lückersspiegels sowie hinter dem Pfaffenwald und der Holzbachklamm noch ein ganz schön großes Stück weiterzugehen schien. Käme doch der riesige Bussard noch einmal vorbei und würde mich mit seinen Krallen ergreifen und über die Grenzen von Severus hinwegtragen!, dachte er so manches Mal, wenn er mit Kruzi und Fix durch die Schlucht marschierte; so wie heute.
* * *
Antonius erreichte den Eingang der Schlucht und packte die Zügel der Pferde ein wenig fester. Bereits im ersten Abschnitt mussten sie einen schmalen Waldpfad passieren. Dieser erhielt seine Schwierigkeit dadurch, dass zahlreiche Wurzeln der dicht gewachsenen Kiefer- und Fichtenbäume wie hölzerne Schlangen wirr über den Weg krochen und heimtückisch Stolperfallen für Mensch und Tier boten. Vor einigen Jahren war sein Vater mit dem Erzeuger von Kruzi und Fix genau hier ins Stolpern geraten. Zum Glück gelang es Arthur damals, sich an einem vom letzten Herbststurm abgeknickten, aber noch am Baum hängenden Ast festzuhalten. Das vollbepackte Tier jedoch verlor das Gleichgewicht. Die zentnerschwere Last auf seinem Rücken riss es zur Seite. Der Gaul trat mit weit aufgerissenen Augen neben den festgetrampelten Wegstreifen, fand keinen Halt mehr und stürzte samt Ladung den Abhang hinab. Noch am selben Nachmittag gelang es Arthur mit einem Ersatzpferd, der damals mit den Zwillingsfohlen trächtigen Ronda, die Getreidesäcke zu bergen. Allerdings blieb ihm nichts anderes übrig, als dem verletzten Tier in der Schlucht mit einem scharfen Messer die Kehle durchzuschneiden und den Kadaver anschließend Stück für Stück nach Hause zu tragen. Seit dieser Aktion, verbunden mit dem Gedanken an den von seiner Mutter in den Tagen darauf aufgestellten Speiseplan, brachte Antonius keinen Bissen Pferdefleisch mehr herunter. Auch dann nicht, wenn sie das Fleisch – wohlgemerkt von fremden Pferden – in ein wenig Branntweinessig einlegte, was früher zu seinen Leibspeisen gehört und seiner Ansicht nach immer viel zu selten auf dem Tisch gestanden hatte.
Doch heute Morgen funktionierte alles reibungslos. Der erste, aufgrund des engen Nadelbaumbewuchses düstere Abschnitt der Schlucht lag hinter ihnen. Zügigen Schrittes kam er mit seinen beiden Pferden voran. Im nächsten Teil stieg der Pfad deutlich an. Allerdings ließ es sich besser marschieren, da er nun ein wenig breiter wurde und vom steilen Abgrund wegführte. Obgleich dieses Stück anstrengender war, mochte Antonius es am liebsten. Er liebte den leichten Anstieg, der nun durch einen hellen Eichenwald führte. Oben angekommen, gönnte er sich und den Tieren stets eine kurze Verschnaufpause. Euphorisch zog er kräftig den Sauerstoff in seine Lungen. Er genoss den wunderschönen Ausblick in die vor ihm liegende Schlucht, in die sich der wildromantisch mäandernde Holzbach in den letzten Jahrhunderten tief hineingegraben hatte.
Gerade in den frühen Morgenstunden dieser an und für sich noch recht kalten Jahreszeit, bot der Blick ins Tal stets eine besondere Szenerie. Während die Sonne den Himmel mit einem violetten Morgenlicht aufhellte, verirrten sich gleichzeitig einige ihrer Strahlen in die noch blattlosen Baumkronen. Wie die leuchtenden Finger Gottes griffen sie hinab in die Schlucht und sorgten dafür, dass feuchte Luft in kleinen Schwaden aus Dunst aus den Niederungen aufstieg. Antonius ließ seinen Blick ausgiebig schweifen. Eigentlich fiel es ihm schwer sich vorzustellen, dass es irgendwo auf der Welt schöner, friedlicher oder gar romantischer sein könnte als in dieser – seiner – Schlucht. Dennoch wühlte ein Gefühl von Fernweh ganz tief in seinen Eingeweiden.
Kruzi und Fix schienen die kurze Pause ebenfalls zu genießen. Erst als sie voller Übermut damit begannen, einander zu necken und zu beißen, erkannte Antonius, dass es Zeit wurde, langsam weiterzugehen.
Nun schlängelte sich der Pfad an einigen mächtigen Eichenbäumen vorbei. Er wurde wieder schmaler und führte stetig bergab. Jetzt galt es erneut, auf die Pferde Acht zu geben. Das am Boden liegende Laub zeigte sich am frühen Morgen recht feucht und glitschig, was nicht ganz ungefährlich für die beiden schwerbeladenen Gäule war.
Langsam und vorsichtig trottete die kleine Karawane ins Tal hinab und näherte sich dem Bachbett. Das Rauschen des Wassers wurde mit jedem Schritt lauter. Das im Norden geschmolzene Schneewasser hatte den ansonsten so gemütlich dahinplätschernden Bach ordentlich angefüllt, sodass man ihn schon fast als reißend beschreiben konnte.
Erleichtert, dass sie den Abstieg so gut geschafft hatten, stoppte Antonius, wie gewohnt, an der seichten Stelle, an der seit dem letzten Hochwasser ein Baumstamm quer zum Bach lag. Ein kräftig geschwungener Ast bot ihm die Möglichkeit die Pferde festzubinden. Während die beiden Tiere sich an dem frischen Wasser labten, setzte er sich auf das Ende des Baumes, das schon langsam ein wenig samtweiches Moos angesetzt hatte, und ließ die Beine baumeln. Er überlegte noch einmal ganz genau, wo er den Reiter gefunden hatte.
„Es war ganz in der Nähe des Steinbruchs“, hörte er sich im Stillen sagen, als er versucht hatte, seinem Vater den Fundort zu erklären. Dabei handelte es sich nicht wirklich um einen richtigen Steinbruch. Vielmehr hatten Arthur und seine Söhne diesen felsigen Abschnitt so getauft, nachdem sie im letzten Jahr dort zahlreiche Bruchsteine für die Brücke und den Scheunensockel auf eine Karre geladen und unter größter Mühe – und Dank der Kraft ihrer beiden Rösser – heil nach Hause transportiert hatten.
Warum wird dieser Reiter wohl gestürzt sein? Ob sein edles Pferd nicht mit dem Boden zurechtkam und ausrutschte? Wenngleich es tausendmal edler aussieht, doch in punkto Trittsicherheit und Kraft hätte es keine Chance gegen Kruzi und Fix! Antonius griff in seinen Leinensack, den er an Fix’ Geschirr befestigt hatte, und nahm den fellbesetzten Trinkbeutel heraus, den ihm seine Mutter im letzten Winter aus dem Leder einer Ziegenhaut gefertigt hatte. Er nahm einen kräftigen Schluck Apfelmost. Anschließend griff er nach einem Stück Fladenbrot. Dieses war dunkel und kross gebacken. Es handelte sich um den Teil, der zur Rückseite des Steinofens gelegen hatte und somit in der Regel leicht ankohlte. Emma wusste, dass ihrem Sohn – nachdem er die kohleartige Oberfläche abgekratzt hatte – dieser Ranken immer ganz besonders gut schmeckte, insbesondere in Verbindung mit dem kleinen Stückchen Speck, das sie ihm stets dazulegte. Antonius biss kräftig zu und lauschte dem aufgeregten Gesang der Vögel, die anscheinend das langsam nahende Ende des Winters spürten. Ein Buntspecht hämmerte unablässig und wie von Sinnen gegen einen der Bäume. Antonius fragte sich, ob er zu dieser Jahreszeit schon irgendein Getier unter der Baumrinde finden würde. Zwei silberfarbene Bachstelzen tanzten am anderen Ende des liegenden Baumes und störten sich keineswegs an ihm und den Rössern, obwohl sie ihnen in ihren Augen wie riesige, bedrohliche Wesen vorkommen mussten. Sie hüpften auf und ab und liefen aufgeregt flatternd hin und her. Unbeeindruckt schienen sie sich zu amüsieren. Zwischendurch landeten sie auf den Rücken der Pferde, tschilpten frech und erfreuten sich an der aufsteigenden Morgensonne. Nach geraumer Zeit sprang Antonius vom Baum, klopfte sich den Allerwertesten ab und ermunterte Kruzi und Fix zum Aufbruch. Gemütlich trotteten die drei weiter. Der Pfad schlängelte sich nun ein Stück am Bach entlang. Ein feucht modriger Geruch, der vom Waldboden aufstieg, lag in der Luft.
Es kann nicht mehr weit bis zu der Stelle sein, wo ich den Reiter rücklings im Wasser liegend fand, dachte Antonius. Mit größter Aufmerksamkeit blickte er nach unten sowie nach links und rechts. Langsam näherte er sich der steil gen Himmel aufragenden Steinkante, von deren Rückseite sie im letzten Jahr die Steine für die Scheune geschlagen hatten. Fix scheute auf, als Antonius die beiden Pferde erneut an einem Baum anband und zum Bach hinabtrat.
Antonius’ Blick folgte dem Wasserlauf. Er suchte das Ufer nach Auffälligkeiten ab. Gerade wollte er sein Augenmerk wieder zum Steinbruch hinauf richten, als er ein kleines Etwas erspähte. Dieses pendelte kurz über dem Wasser, da es sich an einem über den Bach herabhängenden Ast, verfangen hatte. Als er nähertrat, konnte er erkennen, dass es sich um einen Beutel handelte, der von einer Kordel verschlossen wurde. Vorsichtig versuchte er sich dem Ding zu nähern, ohne mit seinen Fellstiefeln ins kalte Wasser treten zu müssen. Bedächtig beugte er sich nach vorne und streckte seinen Arm so weit aus, wie es ging – doch er bekam das Säckchen nicht zu packen. Erst als er seinen linken Fuß auf einen der wackeligen Ufersteine setzte, seinen Körper auspendelte und sich erneut vorlehnte, gelang es ihm, die Schnur zu ergreifen. Allerdings setzte sich das besitzergreifende Geäst zur Wehr und hielt seinem Angriff vehement stand; es schien, als dachte es überhaupt nicht daran, seinen Fang preiszugeben. Erst nach einem energischen Ruck musste der knorrige Ast, gefolgt von einem kräftigen Knacken, kapitulieren.
Der Lederbeutel war triefend nass und durchgeweicht. Antonius trug ihn zu den Pferden und setzte sich auf einen der flacheren Basaltsteine. Wie einen geheimen Schatz, den er soeben aus der Erde geborgen hatte, betrachtete er das Säckchen genauer. Er betastete es und versuchte zu erahnen, was sich darin befand. Im Stillen hoffte er, wenigstens ein paar Silberlinge oder sonstige wertvolle Münzen darin zu finden. Vielleicht handelt es sich ja sogar um einen Almosenbeutel! Gregor hatte ihn über den Sinn und Zweck der kleinen Säckchen, die wohlhabende Leute an ihren Gürteln trugen, aufgeklärt. Vielleicht habe ich ja Glück, dachte Antonius, und ich finde tatsächlich ein paar Geldstücke darin?
Doch seine aufkeimende Euphorie wurde jäh gedämpft. Weder ein ruckartiges Schütteln noch ein äußeres Befühlen des Inhalts mit seinen kalten Fingerspitzen ließ darauf schließen, dass sich Münzen in dem Beutel befanden. Eigentlich erschloss es sich ihm überhaupt nicht, was darin sein könnte. Dass sich etwas Festes im Inneren befand, das war sicher – das konnte er ertasten. Doch was war es? Auf jeden Fall war es etwas Schwereres, und dieses Etwas hatte viele Kanten. Antonius versuchte sich daran, den Knoten zu öffnen, der den Beutel eng verschlossen hielt. Dadurch, dass dieser schon einige Stunden im Wasser verbracht und die Lederschnur sich im verknoteten Zustand vollgesogen hatte, fiel es ihm schwer, eine der Schlingen zu lösen – zudem waren seine blau angelaufen Fingerkuppen vom eisigkalten Wasser fast taub. Er hauchte sie mit seinem Atem an, doch die Schwaden, die er erzeugte, reichten nicht aus, sie wiederzubeleben. Ihm kam eine Idee. Flugs ging er hinüber zu Kruzi und steckte beide Hände unter die raue Pferdedecke. Das Winterfell der Pferde, das sich aufgrund des nahenden Frühjahrs langsam zu lösen begann, war wuschelig weich und vor allem feuchtwarm. So dauerte es nicht lange und das Leben kehrte in seine Finger zurück.
Er konnte es kaum abwarten, endlich zu sehen, was er im Wasser gefunden hatte. Wenngleich ihm klar war, dass es – was immer es auch war – höchstwahrscheinlich dem Fremden gehörte, der zu Hause auf der Mühle um sein Leben kämpfte. Doch was wäre, und fast schämte er sich für diesen Gedanken, wenn er am Abend zurückkäme und seine Leute hätten den Leichnam bereits dem Acker übergeben? Niemand müsste erfahren, was er in der Schlucht gefunden hatte. Alle wussten nur, dass er auf der Suche nach diesem Schwert gewesen war. Dass er dabei auf weitere Gegenstände gestoßen sein könnte, die vielleicht sogar noch wertvoller wären, auf die Idee käme bestimmt niemand. Wahrscheinlich würden sie sich nach der Waffe erkundigen. Wenn er sie aber nicht vorweisen konnte, weil er sie nicht gefunden hatte, dann würden sie sich damit zufrieden geben. Außerdem könnte sein Bruder Albert mit Sicherheit eine ähnliche Waffe in gleicher Güte schmieden. Wer weiß, vielleicht kann er sich somit sogar noch ein paar Silberlinge verdienen? Er wandte sich wieder seinem Fund zu. Was, wenn der Inhalt des Beutels doch wertvoll ist? Gut, ich müsste ihn erst einmal irgendwo schätzen lassen. Ich sollte versuchen, mit einem der fremden Händler auf dem Näherschen Hof ins Geschäft zu kommen. Oder vielleicht gelingt es mir sogar, ihn auf dem Markt in Westerborg zu verkaufen? Vater hat mir doch in die Hand versprochen, dass ich ihn beim nächsten Mal begleiten darf! Hoffentlich ist es bald soweit und hoffentlich nimmt er mich auch wirklich mit!
Im Geiste malte Antonius sich bereits aus, wie er seinen neuen Reichtum verwenden wollte. Einen gewissen Anteil an seinem Erlös würde er kurz vor seinem Aufbruch in die große weite Welt seinen Eltern hinterlassen. Bis dahin würde er sein Geld nicht anrühren. Nein, wie sein Vater es mit seinem bescheidenen Münzbestand immer tat, so würde auch er es auf die hohe Kante legen – also dorthin, wo die oberen Holzbalken, die das Bett umgaben, eine Ecke bildeten, und an die seine Mutter Leinentücher gebunden hatte, die im Winter vor der Kälte und in den Sommermonaten vor Mücken schützen sollten. Und wenn dann die Zeit gekommen und er alt genug wäre, dann würde er seine Zukunft in die eigene Hand nehmen und hinaus in die große weite Welt treten. Aber, was ist mit Elisabeth?
Eines stünde fest, wenn er seinen Fund erst in Hälblinge und Pfennige umgemünzt hätte, dann könnte er sich als einen gemachten Mann bezeichnen. Das wiederum gäbe ihm die Möglichkeit, bei Dagoberth Näher um die Hand seiner Tochter anzuhalten. Was, wenn der alte Näher einer Hochzeit nicht zustimmt? Antonius erinnerte sich, dass der Hofherr erst im letzten Sommer tief in die Tasche greifen musste, um die Hochzeit seiner ältesten Tochter Verona zu finanzieren – abgesehen von der Mitgift, die er traditionsgemäß zusätzlich an die Familie des Bräutigams zu blechen hatte. Somit wäre er bestimmt nicht wild darauf, ein weiteres Mal zu zahlen. Antonius sah seine Felle davon schwimmen. Ein Gefühl der Resignation breitete sich in ihm aus, das schließlich von schierer Panik abgelöst wurde: Was, wenn sie mich überhaupt nicht heiraten will? Fest entschlossen schwor er sich hier und heute: Würde Elisabeth ihn, obwohl er durch seinen Fund zu einem Ihresgleichen avancierte, verschmähen und nicht zum Mann haben wollen, oder sollte Dagoberth der Verbindung nicht zustimmen, dann würde er noch am nächsten Tag aufbrechen. Von der großen Waldkreuzung aus würde er den vorbeikommenden Kaufleuten, Reisehandwerkern, Gauklern oder Quacksalbern oder gar den zahlreichen Rittern und Söldnern seinen Dienst anbieten. Ja, mit irgendeinem von ihnen würde er in die Welt hinausreiten, in eine Welt, die er überhaupt nicht kannte. Selbst dann, wenn es auf einem dieser zweihöckrigen Ungeheuer sein müsste!
Antonius nahm den Beutel erneut zur Hand. Seine Fingerkuppen versuchten sich am Knoten. Diesmal unterstützte er sein Handeln mit der Klinge seines kleinen Dolchs – und siehe da, es gelang ihm, das Gebinde zu öffnen. Schnell zog er die gelockerte Schlinge auf, löste den Lederriemen und riss die zusammengeraffte Beutelöffnung auseinander. Aufgeregt, und nicht nur der Kälte wegen zitternd, griff seine Hand in das dunkle Innere. Seine nicht mehr ganz versteiften Finger ertasteten, wie schon zuvor, ein mehrkantiges Etwas. Vorsichtig packte er zu und zog langsam seinen feuchten Fang heraus. Der Lederbeutel glitt zu Boden. Ungläubig hielt er seinen Fund in den Händen. Was ist das denn?
Zur Sicherheit hob Antonius erneut das Säckchen auf und schaute hinein. Er schüttelte es und wollte ganz sicher gehen, dass er nicht etwas Wertvolles übersehen hatte. Doch der Beutel war und blieb leer. Ein wenig enttäuscht betrachtete er den Gegenstand in seinen Händen. Dieser glich in seiner Art der hölzernen Schatulle seiner Mutter, die sein Vater ihr vor einigen Monaten vom Herbstmarkt in Westerborg mitgebracht hatte. Jeden Abend, nach dem Bürsten ihrer langen, dunkelbraunen Haare, die mittlerweile einige Grausträhnen zierten, legte sie ihren Kamm aus Horn dort hinein und schloss ihn ein wie einen Schatz.
Schade!, dachte Antonius resignierend. Seine Euphorie wich einer herben Enttäuschung. Die Versuchung stieg in ihm auf, die Schachtel mit Wucht dem Holzbach zurückzugeben. Doch zur Sicherheit betrachtete er seinen Fund erneut. Das zylindrische Behältnis maß etwas mehr als eine halbe Elle. Er drehte und besah es sich von allen Seiten. Tatsächlich wies der Zylinder acht Ecken auf. Aufgrund seines Gewichtes schloss er zunächst darauf, dass er aus massivem Holz bestand – aus einem tief dunklen, fast schwarzen Holz. Es trug weder filigrane Schnitzereien noch aufwändige Verzierungen aus Eisen. Sogleich verflüchtigte sich seine Hoffnung, soeben einen wertvollen Schatz geborgen zu haben. Selbst Mutters Kammschatulle sieht schmuckvoller aus! So könnte er noch nicht einmal ihr eine Freude damit machen. Enttäuscht nahm er das Ding in die rechte Hand und schüttelte es. Ein kräftiges Klackern war zu vernehmen. Anscheinend schien es irgendetwas in seinem Inneren zu verbergen. Erneut keimte Hoffnung in ihm auf.
Er besah sich den oktaedrischen Holzstab von allen Seiten und rieb ihn an dem Ärmel seiner Wolljacke trocken. Und siehe da, plötzlich erspähte er etwas, das zuvor nicht zu sehen gewesen war. Auf einer Kopfseite kam etwas zum Vorschein, was darauf schließen ließ, dass es sich um einen Deckel handeln könnte. Vielleicht kann ich das Kästchen hier öffnen? Noch einmal rieb er den vermeintlichen Verschluss am Ärmel. Jetzt konnte er erkennen, was ihm dort aufgefallen war. Sogleich wurde ihm bewusst, dass dieser Beutel, samt seinem Inhalt, dem geheimnisvollen Mönch gehören musste: Die Deckelverzierung zeigte ein von einem Kreis umrandetes gleichschenkeliges Kruzifix. Allerdings zielte seine erste gedankliche Verbindung, die er mit dem Symbol verband, weniger auf eine christliche Richtung ab. Vielmehr dachte er bei der Draufsicht sogleich an das Mühlrad, das sich in der Mühle seines Vaters unermüdlich drehte.
Vor zwei Jahren hatten sie das Rad erneuert, nachdem das alte ob des strengen Winters seinen Geist aufgegeben hatte. Die permanente Feuchtigkeit hatte ihm über die Jahrzehnte stark zugesetzt. Nach und nach waren die Wasserschaufeln abgefault und ausgefallen. Schließlich entschied Arthur, dass eine Reparatur sich nicht mehr lohnte. Die Entscheidung fiel schweren Herzens, immerhin konnte er sich noch daran erinnern, wie sein Vater und er das Mühlrad vor gut zwei Jahrzehnten mühsam zusammengebaut und in Betrieb genommen hatten.
Diesmal war es wesentlich schneller und einfacher gegangen. Unterstützt von Alberts präzise funktionierenden Sägewerkzeugen schnitten sie einen mächtigen Eichenstamm in gleichmäßige Bohlen. Diese zimmerten Arthur, Berthold und Kerbel geschickt zusammen. Um dem neuen Rad mehr Halt zu geben, verstärkten sie die Seitenkonstruktion mit einem mächtigen Lattenkreuz und zahlreichen Eisenkrampen. Zudem schmiedete Albert eine massive eiserne Achse, die er wiederum haargenau in die Radnabe einpasste. Dadurch erhielt das Mühlrad einen wunderbar gleichmäßigen Lauf und die Holzhämmer, die im Inneren der Mühle die Zahnräder steuerten, schlugen fortan einen rhythmischen Takt.
Antonius betrachtete das gleichschenklige Kreuz erneut und erkannte an dessen Enden zwei kleine Kreise. Als er den Verschluss mit seinem Hemdzipfel nachpolierte, fiel ihm auf, dass dort nicht lediglich Kreise abgebildet waren, sondern acht kleine Rosen.
Nun fand Antonius die hölzerne Box doch interessant und versuchte, an den Inhalt zu gelangen. Aber dies, so musste er nach mehreren erfolglosen Versuchen konstatieren, schien ein unmögliches Unterfangen – die Schachtel blieb verschlossen. Seine Augen untersuchten erneut die Oberfläche, aber er konnte nirgends einen Hinweis auf ein Gewinde erkennen, und die Seite mit dem kleinen Kreuz darauf schien sich nicht bewegen zu lassen. Er drehte den Behälter, sodass seine stärkere Hand es auch einmal an der anderen Seite versuchen konnte – doch er blieb erfolglos. Noch einmal schüttelte er seinen Fund hin und her, als wollte er ganz sichergehen, dass der Inhalt sich nicht mittlerweile verflüchtigt hatte. Das Klacken war deutlich zu vernehmen. Wahrscheinlich müsste er zuhause unter Zuhilfenahme von Alberts scharfer Säge dem Ding näher auf den Leib rücken. Wieder kam ein Gedanke in ihm auf, für den er sich sogleich schämte: Was ist, wenn der Mönch nicht mehr am Leben ist? Dann gehört diese Holzschachtel doch mir, oder? Antonius gab auf und steckte das achteckige Ding zurück in den Ledersack. Enttäuscht zog er die Kordel zu, verzichtete aber darauf, einen Knoten zu machen. Da die Schnur noch immer nass war, würde sie beim Trocknen wahrscheinlich erneut zu einem schwer zu öffnenden Klumpen schrumpfen.
Er stand auf und setzte seine eigentliche Mission fort, schließlich hatte er sich aufgemacht, um nach dem Schwert suchen, dass er gestern am Gürtel des Reiters hatte herabhängen und aufblitzen sehen. Außerdem wollten auch die Säcke, die sich auf Kruzis und Fix’ Rücken befanden, abgeliefert werden. Er band die Tiere los und folgte dem kleinen schmalen Pfad, der hinauf zum Steinbruch führte.
Gerade war er losgegangen, als er an markanten und tiefen Trittspuren erkannte, die sich in den Rand des Wegs eingegraben hatten, dass dort irgendetwas oder irgendwer vom Weg abgekommen und schließlich gefallen zu sein schien. Ha, hier muss es sein, wo der Reiter gestürzt ist! Wahrscheinlich rutschte sein Pferd aus, worauf er aus dem Sattel flog und diesen kleinen Hang bis ins Wasser hinabrollte! Erneut band er die beiden Pferde an einen Baum.
Langsam glitt er, zunächst aufrecht, dann unbeabsichtigt auf dem Hosenboden rutschend, den Hang hinab. Das feuchte braune Laub der Eichen und Buchen, das sich über all die Jahre auf dem Boden gesammelt hatte, raschelte und bot einen perfekten Untergrund für seine Rutschpartie. Zwischendurch stoppte er an dem einen oder anderen herausragenden, zwar mit Moos begrünten, aber deshalb nicht weniger schmerzbereitenden Stein. Schließlich kam er ohne größere Blessur am Holzbach an und machte sich sofort auf die Suche. Antonius fluchte, denn der Bach hatte eine relativ starke Strömung. Im Hochsommer würden er und vor allem sein Vater sich wünschen, dass mehr Wasser die Schlucht hinabflösse. Nicht selten kam es vor, dass gerade im Hochsommer im Mühlgraben, in den sie das Wasser aus dem Holzbach umleiteten, dieses zu knapp war, um das Mühlrad und somit die Mühlsteine anzutreiben.
Allerdings hatten Arthur und sein ältester Sohn sich eine Hilfskonstruktion einfallen lassen, damit sie nicht auf dem Trockenen und somit auf der Arbeit sitzen blieben. Ihre Idee erlaubte es ihnen, die Mühlsteine auch ohne das Mühlrad anzutreiben. Allein die Muskelkraft der Pferde – oder damit diese nicht überstrapaziert wurden, auch ab und zu die von zweien ihrer vier Kühe – bewegte die Mahlwerke. Über Stricke, die außerhalb des Gebäudes über ein großes Holzrad geführt wurden, übertrug sich die Muskelkraft der Tiere auf die zahlreichen großen und kleinen Zahnräder, wodurch sie die Mühlsteine in Bewegung setzten und sie zum Pfeifen brachten. Dieses reibende Geräusch klang in den Ohren der Müllersleute wie Musik.
Langsam und mit seinem Blick das Ufer abtastend, forschte Antonius nach dem Schwert. Hier und da setzte er seinen Fuß vorsichtig auf einen der glitschigen Steine, um einen genaueren Blick auf den Grund werfen zu können. Auch wenn das Schwert ein gewisses Gewicht hat, so müsste es nach meiner Einschätzung eigentlich noch ein gutes Stück abwärts getrieben worden sein! Noch einmal nahm er die Stelle in Augenschein, an der er den Mann regungslos, und zu dessen Glück rücklings, im Wasser liegend gefunden hatte. Vorsichtig balancierte er über moosige Felsen und folgte ein wenig dem Bachlauf. Immer wieder schaute er zu seinen Pferden. Diese standen stoisch an ihrem Platz und rieben sich lediglich ab und zu an der schroffen Rinde einer Kiefer.
Noch ein wenig weiter und Antonius würde die beiden aus den Augen verlieren – er musste sich nun entscheiden, schließlich waren die Tiere mit bestem Mehl beladen, das ob seiner guten Qualität natürlich einen beträchtlichen Wert besaß. Sollte er nun riskieren, noch ein wenig mit der Strömung zu gehen, oder war es besser, zu den Pferden zurückzukehren und sich auf den Weg zum Näherschen Hof zu machen? Vielleicht könnte er seine Suche auch auf seinem Rückweg am Nachmittag fortsetzen?
Gerade hatte er entschieden, seine Suche abzubrechen, als sich etwas von der unruhigen Wasseroberfläche abhob und ihm ins Auge fiel. Wie zur Salzsäule erstarrt, blieb er stehen. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Seine Hände begannen zu zittern. Das Rauschen des Baches schien unvermittelt in seiner Lautstärke anzusteigen; ein inneres Brummen machte sich in seinen Ohren breit. Unfähig sich zu bewegen, begann er tief einzuatmen. Ein Amselmännchen setzte sich neben seinen Fuß, bewegte seinen kleinen Kopf aufgeregt nach rechts und links und pickte dann mit seinem gelben Schnäbelchen im Schlick nach Gewürm. Anscheinend nahm es Antonius gar nicht wahr, so regungslos stand dieser am Rande des Baches. Von Erfolg gekrönt, flog der Vogel an der Nase des Menschen vorbei, doch Antonius starrte weiterhin auf den Gegenstand, der ihn magisch anzuziehen schien. Schließlich setzte er sich langsam in Bewegung. Geschmeidig wie eine Katze stieg er von Stein zu Stein. Als er von einem abrutschte, spürte er kaum die nassen Füße, die er bekam. Vor dem Ziel angekommen, beugte er sich hinab. Er griff nach seiner Beute und zog das Schwert, das in einer Scheide steckte, aus dem Bach. Die lederne Halterung schien beim Sturz seines Trägers vom Gürtel gerissen, weshalb die Waffe samt Schwerthülle im Wasser verschwunden war. Nun aber lag sie in Antonius’ Hand und das Heft fühlte sich gut an.
Wackelig und weniger entschlossen als zuvor, kehrte er zum sicheren Ufer zurück. Zügigen Schrittes marschierte er zu seinen Pferden, die ihn mit einem gleichgültigen Blick bedachten. Fast synchron schlugen sie unbeeindruckt mit ihren Schweifen und leckten einander das Fell. Fast pikiert über die nur schwache Anteilnahme seiner Gäule, stellte Antonius sich neben sie und besah sich erneut den geborgenen Schatz, der nicht der Seine bliebe.
Behutsam stellte er das mit einer geschmiedeten und silbrig glänzenden Metallkappe verzierte Ende der Scheide, die ansonsten aus kräftigem Leder bestand, auf den Boden. Seine Linke umfasste sie ungefähr in der Mitte, während seine Rechte erneut das Heft packte. Mit einem kräftigen Ruck – und verwundert darüber, wie federleicht es sich aus dem Futteral bewegte – zog er das Schwert heraus. Fast wären seine Arme zu kurz gewesen, um die lange Klinge gänzlich herauszuziehen, doch es gelang ihm. Antonius war unerfahren, was Waffen und deren ausgeklügelten Gewichtsverteilung betraf. Daher stellte er sich zunächst ein wenig unbeholfen an und hatte alle Mühe, Balance zu finden. Als es ihm schließlich gelang, das mächtige Gerät über sein Handgelenk auszusteuern, richtete er es gen Himmel. Sein Blick folgte unwillkürlich der blitzblank glänzenden Klinge, die lediglich hier und da ein paar kleinere Makel und Einkerbungen aufwies; sicher waren diese Spuren auf den Gebrauch beim Kampf zurückzuführen. Antonius wollte sich nicht vorstellen, wie viele Menschen bereits durch dieses Instrument um ihr Leben gebracht worden waren. Im gleichen Moment fühlte er jedoch, wie ein unheimlich erhabenes Gefühl in ihm aufstieg. Er war zunächst nicht in der Lage es zu deuten, da es sich um eine ihm völlig unbekannte Emotion handelte – schließlich erkannte er das Gefühl: Macht!
Langsam senkte er die Klinge und besah sich den Griff genauer. Dieser war abwechselnd mit Goldstreifen und – zum besseren Halt in der Hand – mit Lederriemen belegt. Im Vergleich zum Rest erschien dieser noch vergleichsweise bescheiden. Der Klingenschutz, der sich rechts und links vom Griff abhob, war aufwändig in einer Form gestaltet, die irgendwie an eine Sanduhr erinnerte und glänzte, als handele es sich um ein Kreuz aus purem Gold. Das jeweilige Ende des Schutzes trug die Form eines Löwenkopfes. Im aufgerissenen Maul war eine taubeneigroße, smaragdfarbene glasähnliche Kugel eingefasst. Antonius war begeistert und hielt das Schwert erneut gen Himmel. Geschickt suchte er sich einen der ersten Sonnenstrahlen, die sich nun ob der nahenden Mittagszeit in die Schlucht verirrten, und ließ ihn die grünliche durchsichtige Kugel durchdringen. „Schock-schwer-Nut!“, ein typischer Ausspruch seines Vaters, entfuhr ihm, als er sah, dass sich das Sonnenlicht tausendfach brach. Dann hielt er die silberne Klinge direkt in den Strahl und es passierte etwas, das ihn erschrecken ließ: Plötzlich sah er im Schimmer des Sonnenlichts, wie auf der eigentlich glatten Oberfläche der Klinge eigentümliche Zeichen sichtbar wurden. Diese waren ihm zuvor nicht aufgefallen. Er nahm das Schwert hinab und betrachtete die Klinge erneut – doch nichts war zu sehen. Noch nicht einmal der Hauch eines zeichenähnlichen Kratzers. Sofort wiederholte er sein Experiment und suchte sich einen kräftigen Sonnenstrahl – und tatsächlich, die Zeichen erschienen erneut. Sie waren sehr klein und in einer Reihe dargestellt. Antonius erkannte einige davon. Des Öfteren hatte er von Ignazius – während dieser in der Küche seiner Mutter eine Familienportion des guten Bauchspecks verdrückte und seinen Gerstensaft schlürfte – Buchstaben und Zahlen beigebracht bekommen. So wurde ihm zwar bewusst, dass es sich um Wörter handelte, doch so sehr er sich auch bemühte, er konnte keines davon entschlüsseln. Fünf Zeichengruppen konnte er erkennen. Er versuchte es erneut, die Buchstaben in eine für ihn sinnige Reihenfolge zu bringen. „Pau…p…er…es!“, konnte er entziffern. Was sollte dies bedeuten? Er gab auf. Vielleicht hatte Gregor eine Ahnung, wenngleich er wusste, dass auch Gregor nicht des Lesens mächtig war.
Langsam ließ er das Schwert wieder in die Scheide gleiten und packte es noch einmal ganz fest am Griff. „Wie leicht es ist, das Schwert zu halten und es durch die Luft zu schwingen“, murmelte er vor sich hin. „Ein Wunder der Schmiedekunst. Albert wird seine wahre Freude daran haben, wenn er es auf seine Machart hin untersucht.“
Er kam nicht umhin, bevor er die beiden Pferde losband, noch einmal das Schwert zu zücken und durch die Lüfte zu schwingen. Dann stellte er sich auf einen der markanteren Felsen, reckte die Klinge kerzengerade gen Himmel und rief so laut er konnte und mit zuvor nicht gekanntem Selbstbewusstsein: „Ich bin der Herr der Furche! Das Butterstück ist mein!“ Sein plötzlicher Gefühlsausbruch ließ sich auf eine Geschichte zurückführen, die sich erst vor wenigen Tagen ereignet hatte:
Das Kloster und der Ort Severus gehörten zur Vogtei und Trutzburg Westerborg, mittlerweile ein aufstrebender Ort, auf den man stieß, wenn man über den Ziegenberg nach Norden marschierte. Sowohl die Vogtei als auch Westerborg gehörten seither zum königlichen Niederlahngau, das vom Gaugrafen zu Leiningen verwaltet wurde. Seit König Ludwig III., den man auch wegen seiner Augenblendung in einer Schlacht Ludwig den Blinden nannte, wurde die Verwaltung des Gebiets auf so genannte Gaugrafen übertragen, die wiederum regionale Edelfreie als Vögte mit der Durchführung – insbesondere der Überwachung der Jagd- und Wasserrechte – beauftragen konnten.
So ergab es sich, dass Siegfried III. von Runkel beschloss, nach seiner in Kürze anstehenden Vermählung mit Katharina, der Erbtochter des Leininger Gaugrafen, als Vogt von Westerborg die alleinige Herrschaft über diese Region zu übernehmen und als erste Maßnahme alte Privilegien abzuschaffen. Diese hatten sein Schwiegervater in spe, der alte Gaugraf Rainulf, und dessen Vorfahren vor vielen Jahren verdienten Untertanen gewährt. Neben den Eigentumsoder Ertragsrechten an Fischweihern und Wasserläufen betraf dies auch Grundstücke. Doch Siegfried wollte diesen Flickenteppich an Gütern und Besitztümern abschaffen. Sein Plan: Er kauft die fremdbestimmten Ländereien zu ‚großzügigen Preisen‘ zurück oder lässt sie seiner künftigen Gattin als Hochzeitsgeschenk übereignen. Es war ihm ein Dorn im Auge, dass dieser alte Tattergreis den begünstigten Familien zugestanden hatte, dass sie alleine über die Erträge ihres Landes verfügen konnten und somit von der Abführung eines Zehnts an den Stadt- und Burgvogt befreit blieben.
Nun sollte aber alles anders werden. Ein Junker Siegfrieds war zur Mühle gekommen und hatte dort in übertrieben hochnäsiger Stimmlage Arthur eine unerfreuliche Nachricht verlesen: „Hiermit erkläre ich, Siegfried III. von Runkel, künftiger Advocatus zu Westerborg, dass ich, zur Hochzeit eurer von Gottes Gnaden reich beschenkten und ehrenvollen Herrin Katharina von Leiningen, den legitimierten Anspruch auf das Eigentum und sämtliche Erträge der Ländereien in der Furche zwischen der Ansiedlung beim Stuhllindengericht Winnen und dem Klosterort Severus erhebe!“ Damit sollten alle Ansprüche, ob land- oder forstwirtschaftlicher Ertrag, Fisch- und Wassernutzungsrecht, auch eventuelle Pachten seitens anderer Untertanen an seine Braut übertragen werden. Als Zeichen seiner Großzügigkeit zahle er dem Müller Arthur eine Abfindung von einmalig dreißig Silberpfennigen. Arthur war außer sich gewesen und beschimpfte den Junker, an dessen Arroganz jedoch jeder Fluch einfach abzuprallen schien. So zahlte dieser den angekündigten Betrag und verschwand so schnell er gekommen war.
„Dreißig Pfennige! Das Land in der Furche ist fast acht Morgen groß. Es wurde von Generation zu Generation immer mit denselben Worten vererbt: Steckste ach em dickste Dreck, et nährt deich de Bure vom Bottersteck!“ Ja, das sogenannte Butterstück galt als eine Art Lebensversicherung. Man benötigte gut und gerne eher mehr als acht Vormittage, um es mit dem einscharigen Pferdepflug zu bearbeiten. Die dunklen Ruten, die sich beim Pflügen in den ertragreichen Boden auftaten, waren seit Jahrzehnten kerzengerade gezogen worden. So könnte tatsächlich der wahre Wert des Grundstücks einer notbedürftigen Familie aus dem Dreck helfen, wenn es einmal richtig ernst würde. Zum Glück war bisher keiner seiner Vorfahren jemals in die Not geraten und musste das Butterstück abgeben. Doch nun würde mit dieser Tradition gebrochen. Arthur wäre der erste, der keinem seiner Söhne das wertvolle Grundstück vermachen könnte. Dabei hatte Graf Rainulf bei jeder sich bietenden Gelegenheit versprochen, dass die Eigentums- oder Ertragsverhältnisse der Ländereien sich nicht ändern würden – doch was schien das Wort eines alten Grafen zu zählen, wenn die jungen Wilden nach Macht strebten.
Arthur machte damals eine Faust in der Tasche und verschwand zum Mühlrad, um dieses zu inspizieren. Antonius folgte ihm unaufgefordert, er wollte noch mehr über das Butterstück und die Furche erfahren. So erwischte er seinen Vater, wie dieser in Tränen aufgelöst neben dem riesigen Holzrad stand. Und nur das Klappern im Mühlenraum verhinderte, dass er auch das Schluchzen hören musste.
„Ich bin der Herr der Furche! Das Butterstück ist und bleibt mein!“ Entschlossen steckte Antonius das Schwert zurück, wischte sich schnell eine Träne weg und machte sich auf den Weg zum Näherschen Hof.