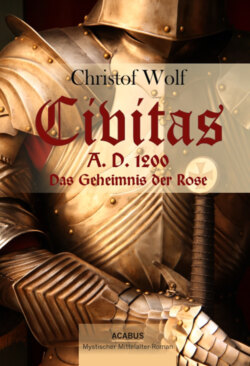Читать книгу Civitas A.D. 1200. Das Geheimnis der Rose - Christof Wolf - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KLOSTERHOF IM TAL DER KLEINEN NISTRIAM
ОглавлениеIm Tal der Kleinen Nistriam, einem Nebenarm des gleichnamigen großen Bachs, der durch ein dicht bewaldetes Gebiet floss und die Grenze zwischen den Erzbistümern Coelln und Treveris markierte, hatten sich vor wenigen Monaten, auf Geheiß des Mutterklosters Himmerod, zwölf Mönche aus dem Konvent von Heisterbach niedergelassen. Unter der Führung von Pater Hermann, der die Funktion des Gründungsabts übernehmen sollte, wollte der Orden der Zisterzienser auch in dieser noch weitgehend unerschlossenen, dicht bewaldeten Gegend einen neuen Konvent aufbauen.
Bereits vor Jahrzehnten waren die Ideen der Zisterzienser von Frankreich ins Deutsche Reich gelangt, nicht zuletzt durch die Reformbewegung, die von dem ehemaligen Adeligen und Abt Bernhard von Clairvaux ins Leben gerufen worden war. Seitdem versuchte der Orden, eine breitflächige Präsenz zu zeigen. Aktiv begannen sie in diesen Zeiten, auch dünn besiedeltes und selbst unwirtliches Waldgebiet ins Augenmerk zu nehmen. Über Schenkungen oder Erbschaften sammelten sie riesige Ländereien an und mehrten ihr Vermögen. Neben einer gewissen wirtschaftlichen Grundlage bildete dieser Reichtum natürlich gleichzeitig die Basis für eine gesellschaftliche und vor allem auch politische Autorität. Zudem half dieser stetig wachsende Wohlstand dabei, die Glaubensund Lebensweisen des Ordens weit zu verbreiten. So war es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis er den Weg ins Gebiet des Grafen von Sayn finden sollte.
Dieser war ihnen in seiner Funktion als Vogt von Heisterbach, wo der Orden schon seit geraumer Zeit eine Niederlassung führte, längst kein Unbekannter mehr. Regelmäßig war der Graf nebst Familie in ‚seinem Dorf‘ am Fuß des Siebengebirges eingekehrt und sah dort nach dem Rechten – was den Heisterbachern als Beweis für eine besondere Zuneigung der Sayner zu ihrem Ort galt. So war es nicht verwunderlich, dass man schon bald im Mutterkloster der Heisterbacher von den Bauplänen des Lehnsherrn erfuhr. Sehr schnell fiel daher in der Himmeroder Kongregation, die sich in der Eifel befand, der Beschluss, neben dem Tochterkloster ein weiteres in der Sayner Grafschaft zu gründen, inmitten des riesigen Waldgebietes, das als Westerwald bezeichnet wurde.
Mit der Auflösung der Gauverfassung durch Karl den Großen vor gut dreihundert Jahren wurden die bisher von Gaugrafen regierten Gauen in Bezirke umgewandelt. Als Neuerung durften die Bezirke fortan den Namen des Grafensitzes tragen. Somit entstand die Grafschaft Sayn an der Grenze zwischen dem ursprünglichen Oberlahngau und dem Auelgau, dessen Kerngebiet sich bis nahe Bonnburg erstreckte, wo der Graf von Sayn als Lehen der Pfalzgrafen das Grafenrecht besaß.
Gleichzeitig verlief entlang des Laufs der Großen Nistriam, der die Grenze der Grafschaft markierte, auch die Abgrenzung der beiden geistlichen Hoheitsgebiete der Coellner und Treveriser Erzbistümer. Allerdings fühlte der Sayner Herr sich weder dem Coellner noch dem Treveriser Erzbischof verpflichtet. Vielmehr sah er sich als Reichsgraf, wodurch er unmittelbar dem Deutschen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches unterstand, Kaiser Friedrich I., der wegen seines rot schimmernden Bartes von den Italienern Barbarossa genannt wurde.
Vor dessen Aufbruch zum dritten Kreuzzug der Geschichte, wo er in Jerusalem gegen den Führer der Ungläubigen, ad persona Saladin, zur Ehre Gottes kämpfen wollte, erließ er das Dekret, dass die Handelswege des Deutschen Reiches besser geschützt werden müssten. So trug er auch dem Sayner Grafen auf, in der Region des Westerwaldes für Sicherheit zu sorgen; konkret hieß sein Auftrag: Bau einer Schutzburg. Sein Geheiß kam nicht von ungefähr, denn dieses Gebiet durchkreuzten lukrative Fernhandelswege. Und diese Geldadern erkrankten seit Jahren regelmäßig an dreister Räuberei und gewalttätiger Plünderei – was immer wieder zum Ausfall von Wegezöllen und Steuern führte.
Deshalb begannen der Sayner Graf und dessen jüngerer Bruder Eberhard, den Auftrag auszuführen, und schmiedeten Pläne, wie sie eine Wegsicherung garantieren konnten. Gleichzeitig entwickelten sie die Idee, den Bau der Burg mit der Gründung einer neuen Stadt mit Marktrecht zu verbinden. Sie waren fest davon überzeugt, binnen kürzester Zeit in diesem wirtschaftlich und auch gesellschaftlich noch als unterentwickelt zu bezeichnenden Gebiet einen prosperierenden Marktflecken zu etablieren.
So kam es auch, dass der Sayner Vogt eines Tages, als er wieder einmal routinemäßig Heisterbach aufsuchte, bei einem gemeinsamen Mahl mit Abt Gervadus von Sankt Petersthal und dessen Vertrauten, Mönch Caesarius, von seinem Vorhaben berichtete, neben der Burg auf dem Hagenberg, Civitas zu errichten. „Ja, meine Herren, glaubt mir, die ganze Region wird in wenigen Jahren prosperieren und sich zu einem bedeutenden wirtschaftlichen und kulturellen Flecken auf der Landkarte meiner Grafschaft entwickeln“, verabschiedete sich der Sayner. Und schon bald nach dessen Besuch, legte Abt Gervadus seine neuen Erkenntnisse in einem Schreiben dar. Per Kurier ließ er es zum Mutterkloster nach Himmerod bringen. Und siehe da, Himmerod reichte seinen Vorschlag nach Frankreich weiter. Die Zustimmung aus Cîteaux ließ nicht lange auf sich warten. Sankt Petersthal wurde ermächtigt, ein Gründungsprojekt voranzutreiben. Gervadus war überglücklich über seinen Erfolg und beauftragte Caesarius, eine Mönchskongregation zusammenzustellen. Diese sollte den Auftrag erhalten, den geeigneten Platz für das neue Kloster – nahe der Stätte Civitas – zu finden.
Caesarius beorderte zunächst Hermann, den Mönch seines Vertrauens, zu sich und befragte ihn, ob er es sich zutrauen würde, diese große und wichtige Aufgabe zu übernehmen. Natürlich sagte Hermann nicht Nein und fühlte sich besonders wichtig. Das Angebot, sehr schnell zum Gründungsabt zu avancieren und die Leitung des neuen Konvents zu übernehmen, war verlockend. Gemeinsam mit Caesarius, der seine ehemaligen Schüler am besten kannte, wählten sie Hermanns Gefolgschaft aus. Bereits wenige Wochen, nachdem der erste Gedanke an die Neugründung eines Tochterklosters im Gebiet des westlichen Waldes erstmalig gedacht wurde, machten sich Hermann und seine zwölf Mitbrüder, die er stets als seine zwölf Apostel bezeichnete, auf den Weg. Ja, sie wollten den Ort der Orte finden.
Doch die Reise sollte nicht einfach werden, da die vorbestimmte Region einem Urwald zu gleichen schien. Bäume, Bäume, nichts als Bäume!, dachte Hermann, als sie nach tagelanger Wanderung kaum noch auf eine breite Lichtung getroffen waren. Sie hielten ihre Augen offen und versuchten Bachläufe zu finden, denen sie folgen konnten. Sie orientierten sich an sanften Bergrücken und herausragenden Hügeln. Nachdem sie kreuz und quer die Gegend durchwandert hatten, konnten sie endlich in der Ferne die Erhebung sehen, auf der sich die Baustelle für die neue Sayner Burg befand. Sie waren glücklich darüber, dass sie die richtige Richtung eingeschlagen und die Civitas gefunden hatten.
„Vielleicht sollten wir für den Platz unseres Klosters ebenfalls eine Kuppe aussuchen!“, schlug Thomasius, einer der Gefährten, vor, als sie Ungersiffen am Rotbach erreichten. Diese kleine Ansiedlung lag am Fuß des markanten Basaltbergs, auf dem die neue Burg und Stadt entstand. Sie bestand lediglich aus einer steinernen Fuhrmannskirche, einem Gasthaus und wenigen Hütten, in denen sich vor Jahren einige Siffer niedergelassen hatten. Diesen verdankte der Ort letztendlich auch seinen Namen. Siffer nannten sich die Männer, die seit geraumer Zeit damit begonnen hatten, in kleinen Stollen nach erzhaltigem Gestein zu graben. Ihre Ausbeute siebten sie anschließend im nahegelegenen Bach, worauf dieser aufgrund des Rostes, der sich mit der Zeit im Bachbett absetzte, eine rötliche Färbung und den Namen Rotbach erhielt.
Aber dem kleinen Dorf unten im Tal, was die umgangssprachliche Bedeutung für das Unger im Ortsnamen war, wurde ein ganz besonderer Platz auf der Karte des Deutschen Reichs zuteil. Denn genau hier traf eine vom Rhein hinauf nach Herbore und über Witlara nach Libzi führende Fernstraße auf die sogenannte Hohe Straße, die sich von Coelln über Lintpurc nach Frankenvurd zog. Ob dieser außergewöhnlichen Lage avancierte der ansonsten durchaus unscheinbare Fleck zu einem populären Umsteige- und Umschlagplatz, an dem mittlerweile regelmäßig Pferdefuhrwerke verkehrten. Allerdings war es stets fraglich und mit Risiko behaftet, ob man einen ordentlichen Kutscher erwischte, da es selbst in diesem Gewerbe durchaus schwarze Schafe gab. Nicht selten hörte man von Reisenden, die – wenn sie das Glück hatten und überlebten – kurz hinter der Ortsgrenze ohne ihr Hab und Gut aus dem Fahrzeug geworfen wurden.
Doch was blieb den Händlern und Reisenden, den Marktschreiern und Quacksalbern, den Wanderpredigern und Wunderheilern, dem einfachen Vagabunden und dem mehr oder weniger wohlhabenden Adeligen anderes übrig, als in Ungersiffen zu stoppen? Weit und breit bot sich keine Alternative – noch nicht! Also wurden in dem kleinen Ort große Geldsummen gelassen und der Graf verdiente ordentlich an den Pachten und Steuern mit. Und dieser wusste nun – unterstützt von Barbarossas Dekret – wie aus der prominenten Lage noch mehr herauszuholen war. Deshalb fiel bald der Entschluss, den weithin sichtbaren, allerdings mit reichlich Hagen – sprich Dornengestrüpp – bewachsenen Basaltkegel zu bebauen.
Langsam näherten sich Hermann und seine Gefährten dem Geschehen und konnten schon bald Marktschreier hören und Viehdung riechen. Tagein, tagaus wechselte unter großem Gebrüll der ambitionierten Verkäufer und einer stets zum Feilschen bereiten Kundschaft das Vieh den Eigentümer. Große Warenmengen wurden hier umgeschlagen – von körnigem Getreide bis madenhaltigem Mehl, von edlen Stoffen aus Italien bis zu Gewürzen aus fernen Ländern.
Zur Rast stand ein zwielichtiges Wirtshaus zur Verfügung, in dem es nicht selten drunter und drüber ging. Meist fand dort von Müdigkeit gequältes und im wahrsten Sinne gerädertes reisendes Volk für eine Nacht Unterschlupf.
Die Mönche jedoch entschieden sich, in der Fuhrmannskirche eine Verschnaufpause einzulegen. Sie waren beeindruckt von dem kleinen Gotteshaus, einer von massigen Pfeilern im romanischen Stil gestützten, dreischiffigen Basilika. Eigentlich stand sie mitten im Nirgendwo. Dennoch gelang es ihr, die Menschen, die in ihr Ruhe suchten, mit ihren künstlerischen Verzierungen zu beeindrucken. Im Laufe der Jahrzehnte wurden diese von immer wieder einkehrenden, wohlhabenden Reisenden und Fuhrleuten in Auftrag gegeben, da sie den ungewöhnlichen Ort der Stille als willkommene Abwechslung von der Reisestrapaze empfanden. Andere, vor allem wandernde Burg- und Kirchenbauer, wurden von Pater Matthäus, der seit Jahren diesem Hause vorstand, damit beauftragt, kleinere Reparaturen oder Verzierungen vorzunehmen – quasi als Entgelt für gewährte Kost und Logis. So zierten mittlerweile zahlreiche Gemälde mit Szenen aus dem Alten und Neuen Testament die Wände, Friese und Decke. Besonders stolz war Pater Matthäus auf das Bildnis in der Apsis. Ein reisender Kirchenbauer namens Grindel, der aus Coelln kam und sich auf dem Weg nach Lintpurc befand, hatte dieses vor kurzem – zur Aufbesserung seiner Reisekasse – gemalt.
Nach ihrer Rast marschierten die Zisterzienser den Hügel hinauf. Sie waren gespannt, wie weit sich die neue Stadt, die von einer dicken Stadtmauer umgeben war, entwickelt hatte. Es herrschte reges Treiben. Überall wurden hölzerne Hütten oder Häuser zusammengezimmert. Im Vergleich zu den letzten Wochen, in denen die absolute Stille lediglich vom Plätschern eines Baches oder von Vogelgezwitscher unterbrochen worden war, empfanden sie den Baulärm als ohrenbetäubend. Nur mit Mühe und Not gelang es ihnen, durch die Straßen zu marschieren, denn der nasse Lehm war durch die Räder der zahlreichen Fuhrwerke geradezu wie ein Brotteig durchgewalkt.
Um sie herum blökten Handwerker einander an und wiesen sich die Schuld für dies und jenes zu. Frauen reinigten schmutzige Kinderlumpen und schleuderten deren Inhalt auf die Straße. Dreckverschmierte Kinder spielten in den stinkenden Pfützen und ließen das brackige Wasser hochspritzen. Eine feine Dame fluchte über die Schmutzflecken, die sich dadurch auf ihrem langen Rock niederließen. Angewidert hielt sie sich vornehm ein mit Rosenöl beträufeltes Tüchlein unter der Nase.
Auf der höchsten Erhebung des Stadtkerns standen riesige Holzgerüste. Bauarbeiter flitzten geschickt auf den Brettern umher wie Eichhörnchen über die Äste einer Baumkrone. Andere nagelten mit rhythmischem Hämmern Bretter zur Stabilisierung des Gerüsts kreuzförmig zusammen. Mächtige Planken hingen an Seilzügen, die von den kräftigen Armen der Windendreher, die an einer große Holztrommel standen, hinaufgezogen wurden. Das Gerüst wuchs permanent in die Höhe und folgte dabei einer ebenso täglich wachsenden Burgmauer.
„So groß müssen die Gerüste gewesen sein, als Noah seine Arche gebaut hat!“, warf Dominikus, ein weiterer der Gefährten, ein, als sie ihren Weg über den Bergrücken einschlugen. Die neu entstehenden Steinwälle erschienen ihm übernatürlich groß.
„Mich erinnert es vielmehr an den Turmbau zu Babel“, brummelte Hermann in seine Kapuze, als sie Civitas durch das eingerüstete, riesige Osttor verließen. Sie folgten einem kleinen Weg, der sie zunächst in ein Waldstück führte, das wiederum in ein weitläufiges Tal mündete. In dessen Sohle floss der große Nistriambach. Sie überquerten ihn bei der Arfelder Brücke. Rechts von ihnen lag eine Mühle, deren Wasserrad sich gleichmäßig drehte. Aus dem Inneren war ein Sägegeräusch zu vernehmen.
Keuchend ob ihres Gepäcks nahmen sie den gegenüberliegenden Anstieg in Angriff. Dieser führte sie in ein kleines Dorf, das Arfelden hieß. In diesem hatten sich überwiegend Weidenflechter und Korbmacher angesiedelt. Erschöpft rasteten sie erneut und erkundigten sich nach einem Ort, der ihnen einen guten Blick ins Tal bescheren würden. Ein altes Weib, mit einer vom rauen Wetter runzlig gegerbten Haut und tausend Lebensfalten im Gesicht, wies ihnen den Weg zum Hügel hinauf. „Geht an der großen Rodung vorbei. Ihr erkennt das Stück, denn erst vor kurzem ham se dort Unmengen an Stangen gefällt. Mein Neffe macht aus denen schöne Gerüstbretter für den Burgbau in Civitas. Er besitzt die Schneydemühle – an der seid Ihr sicher vorbeigekommen.“ Herman nickte. „Nach der Rodung ist eine Lichtung mit Talblick entstanden, aber da haben sich bereits einige Holzfäller und Fuhrmänner niedergelassen. Ihr müsst also weiter hinaufgehen. Dann trefft Ihr auf ein kleines Plateau, da läuft die schwarze Mörle entlang. Ich denke mal, dass Ihr Wasser braucht, oder? Sollte der Bach Euch aber zu klein sein, dann geht Ihr einfach weiter. Es geht dann ins Tal und Ihr stoßt auf die Kleine Nistriam – die hat etwas mehr Wasser zu bieten!“ Hermann war froh über die Informationen und dankte der alten Frau für die Wegbeschreibung mit einem: „Der Herr sei mit dir!“, während seine Mitbrüder simultan „Amen!“ sagten und sich bekreuzigten.
Es dauerte nicht lange, sie gingen einfach querfeldein, da erreichten sie die Siedlung, die von den Holzfällern wegen der großen Rodung einfach Stangenrod genannt wurde. Die Sonne verschwand bereits langsam hinter dem gegenüberliegenden, voll bewaldeten Hügelrücken. Die letzten Sonnenstrahlen tauchten den Hang und seine verbliebenen Bäume in ein ganz besonderes, sanftes Licht. Die Mönche erkannten, dass es durchaus sinnvoll war, ihr Kloster weiter oben zu errichten. Wie sie sehen konnten, schien die Sonne dort noch ein wenig länger.
Also marschierten sie weiter hinauf, bis sie tatsächlich das kleine Plateau fanden, das die alte Korbflechterin ihnen beschrieben hatte, und das geradezu prädestiniert war, mit einer Kirche und Klostergebäuden bebaut zu werden. „Das ist doch ein schöner Kirchberg, oder? Was meint Ihr, Bruder Hermann?“, fragte einer der Mönche. Hermann blieb stumm und sah sich um. Gut, um eine uneingeschränkte Sicht aufs Tal zu erhalten und die Sonne so lange wie möglich genießen zu können, müssten noch ein paar Bäume weichen. Doch schon wenige Tage später, mussten sie erkennen, dass ihre Suche weitergehen musste. Zwar war die Aussicht von dem Plateau faszinierend gewesen, doch ein anderes Problem trat in den Vordergrund: Es fehlte an einer ausreichenden Wasserversorgung. Das kleine Bächlein Mörle reichte hinten und vorne nicht aus, um sie mit frischem Wasser zu versorgen – und das in der noch relativ nassen Jahreszeit. Im Sommer würde dieses Rinnsal weder dazu ausreichen, ihre Gärten und Felder zu bewässern, geschweige denn die Fließkraft aufbieten können, die für den Antrieb einer eigenen Mühle ausreichen würde; schließlich wollten sie ihr eigenes Getreide mahlen.
Hermann war es unangenehm, als er vor seinen Mitbrüdern zugeben musste, dass er sich beim Aussuchen des Platzes zu sehr von der schönen Aussicht hatte blenden lassen. Dennoch war es früh genug und die bereits geleisteten Anfangsarbeiten hielten sich in Grenzen. Also packten sie Sack und Pack. Wie das Hutzelweib aus Arfelden anscheinend schon geahnt hatte, machten sie sich erneut auf den Weg. Dieser führte sie an der kleinen Ansiedlung Mörlen vorbei, deren Namensgebung auf die Schwarze Mörle zurückzuführen war, hinab ins Tal der Kleinen Nistriam. Und tatsächlich fanden sie hier, was ihr Herz begehrte – abgesehen von einem schönen Blick ins Tal und der Tatsache, dass die Sonne schon sehr zeitig am Nachmittag das Weite suchte. Doch sie blieben.
Mittlerweile war der Aufbau ihres neuen Domizils gut vorangekommen. Sie sichteten Ländereien und begannen damit, sie zu bearbeiten. Sie rodeten größere Waldflächen, um genügend Baumaterial für ihre Behausungen und eine erste provisorische Kirche zu erhalten. Sie zogen einen dichten Weidenzaun um ihr Anwesen und errichteten Stallungen. Mit vereinten Kräften gruben sie kleine Kanäle, die das Wasser aus dem kleineren, aber ergiebigeren Nistriambach umleitete. Sie stauten es in kleinen Weihern und begannen damit, Forellen und Lachse zu halten.
Es dauerte nicht lange, da wurden auch die Menschen der Gegend auf die fleißigen und umtriebigen Mönche aufmerksam. Rasch sprach sich herum, dass die Gottesmänner des neuen Klosterhofs zum einen gerne die Unterstützung der Leute aus den naheliegenden Ansiedlungen Mörlen und Stangenrod in Anspruch nahmen und deren Arbeit gut entlohnten, indem sie die erbrachten Leistungen mit Mitteln aus dem eigenen Anbau von Obst und Gemüse abgalten. Andererseits waren die Mönche dankbare Abnehmer für Waren, wie die geflochtenen Körbe und Behältnisse der Leute aus Arfelden.
Sehr bald hatte sich der Kirchenplatz im Tal der Kleinen Nistriam etabliert, wenngleich die Eigentumsübertragung durch den eigentlichen Grundherrn noch lange strittig blieb. Denn entgegen ihrer Annahme, das Areal gehöre ‚ihrem‘ Heisterbacher Vogt, von dem sie sicher ganz unproblematisch sämtliche Rechte erhalten hätten, gehörte das Land einem kinderlosen Ehepaar; dem aus der Eifel stammenden Coellner Burggrafen Eberhard von Aremberg und seiner Gemahlin Adelheid von Molsberg. Während der Graf von Aremberg seinerseits sehr schnell eine Schenkung in Aussicht stellte – schließlich war ihm dieser Rodungsbezirk durch die Hochzeit mit Adelheid zugebracht worden, weshalb seinerseits kein wahres Herzblut an diesem Land hing – verhinderte die angeheiratete Verwandtschaft vehement die reibungslose Umsetzung. Aufgrund der Kinderlosigkeit des Paares hatten die Molsberger sich längst ihrer Erbansprüche sicher gefühlt und sahen es überhaupt nicht ein, weshalb sie auch nur einen Quadratmeter des riesigen Waldgebiets an diese Pfaffen, die sich dort im Tal niedergelassen hatten, abzutreten; abgesehen davon, dass dadurch das Gebiet künftig dem geistlichen Protektorat des Erzbistums Coelln unterstehen würde. Schließlich gehörten die Molsberger Ländereien und das dazugehörige Kirchenspiel schon immer zum Einflussbereich des Treveriser Erzbischofs. Und mit diesem und seinen Vertretern wollte man es sich auf keinen Fall verscherzen. Außerdem hatte die Molsberger Linie längst erfasst, dass die Gegend prosperierte und künftig einiges an Profit in Form von Steuer- und Wegezolleinnahmen abwerfen würde. Also hielten sie sich mit offenen Drohungen und aktiven Feindseligkeiten weder gegenüber der eigenen Verwandtschaft noch gegenüber den Mönchen des neuen Klosters zurück.
So war es nicht verwunderlich, dass es Hermann schwerfiel, sich mit dem von ihm und seinen ‚Aposteln‘ ausgewählten Ort anzufreunden. Er spürte, dass er sich dort nie richtig heimisch fühlen würde. Zwar hielt er seine Mitbrüder an, den Kirchenplatz so gut es ging auszubauen, aber die Grundsteinlegung für ein steinernes Fundament zum Neubau eines repräsentativen Gotteshauses zögerte er so lange wie möglich hinaus. Zudem fehlte ihm an diesem Ort die rechte Spiritualität. Diese hatte er indes im Tal des heiligen Petrus in Heisterbach stets gespürt. Immer und immer wieder verwarf er die Pläne für den Neubau oder mäkelte an ihnen herum. Niemand konnte es ihm recht machen. Irgendwie hoffte Hermann immer noch auf ein Wunder. Täglich betete er um ein Zeichen, das ihm die Legitimation geben sollte, diesen Ort ohne Gesichtsverlust und das Gefühl des Versagens, wieder verlassen zu können. Bisher wartete er vergebens. Doch eines Tages sollte sich alles ändern.
* * *
Vor wenigen Tagen war Acabus, der Bote Benedikts von Eberbach, wieder aufgebrochen. Diesmal hatte er eine Nachricht des Novizenmeisters Caesarius von Heisterbach in seiner Satteltasche. Dieser hatte ihm aufgetragen, die Depesche so schnell wie möglich zu dem neuen Konvent im Westerwald zu bringen.
Wie aus heiterem Himmel stand nun dieser Reiter vor dem Klostertor. Stephanus, der gerade den Hof fegte und lose Federn der herumstreunenden Hühner aufsammelte, sah ihn zuerst. Schnell lief er hinüber zum provisorischen Refektorium, in dem Hermann und Thomasius, sein Prior, die Speisen der nächsten Tage besprachen. Gemeinsam traten sie auf den Hof hinaus und marschierten zum Tor. Drei weitere Brüder, die im Refektorium für Ordnung gesorgt hatten, folgten ihnen.
Das Klostergelände hatten sie – unterstützt von Männern aus Arfelden, die in diesem Metier ausreichend Erfahrung aufweisen konnten – mit einem Weidengeflecht umzäunt, das an manchen Ecken bis zu fünf Ellen maß. Dadurch versuchten sie zum einen, das Weglaufen der eigenen Tiere zu verhindern, und erschwerten zum anderen den herumstreunenden wilden Tieren, diese innerhalb des Klosters zu erbeuten. Erst letzte Woche war ein Marder in den Hühnerstall eingedrungen und hatte zehn Hennen den Hals durchgebissen und deren Blut ausgesaugt. Doch auch Geschichten von Wölfen oder wolfsähnlichen Geschöpfen, die auf zwei Beinen laufen konnten und Menschen anfielen, machten zunehmend die Runde. Geschürt wurden diese Mären vor allem von geschwätzigen Handelsreisenden, in deren Sortiment und Satteltasche sich natürlich sogleich ein wirksamer Schutz in Form eines abwehrenden Duftstoffes befand oder ein Allheilmittel, ein Zauberkraut oder ähnlich Nützliches.
„Der Herr sei mit Euch!“, rief Hermann und eilte dem Reiter vor dem Tor entgegen.
„So mit Euch!“, antwortete dieser. Die übrigen Brüder schoben ein „Amen!“ nach.
„Was führt Euch in diese Gegend?“, fragte Hermann sogleich nach.
„Seid Ihr Hermann von Sankt Petersthal und der Abt dieses“, – hier stoppte der Bote und schaute sich zunächst skeptisch um, bis er die vagen Umrisse eines noch ziemlich unscheinbaren Gotteshauses erkannte – „… nun, äh, Abt dieses neuen Konvents?“
„Der bin ich. Wer seid Ihr?“
„Ich bin Acabus, ein Bote des Klosters in Eberbach. Allerdings komme ich nun im Auftrag Eures Mitbruders Caesarius von Heisterbach. Nachdem ich ihm eine Depesche meines Herrn überbracht habe, bat er mich, meinen Rückweg so zu wählen, dass ich Euch ebenfalls eine Nachricht übermitteln kann. Allerdings war es schwerer, Euch zu finden, als das Kloster zu Heisterbach. Doch hier bin ich nun!“
„Ich bitte Euch, steigt ab und tretet ein. Unser bescheidenes Haus soll Eure Herberge sein.“ Acabus stieg von seinem Pferd, dessen Maul noch immer weiß schäumte. Stephanus bot sich sofort an, das Ross zu versorgen und ihm den klebrigen Schweiß abzustriegeln.
Hermann und Thomasius führten den Reiter, der sich noch schnell seine Satteltasche schnappte, in der sich die Nachrichten befanden, ins Refektorium. Sogleich boten sie ihm einen großen Krug frischen Gerstensafts an. Acabus leerte ihn nahezu in einem Zug. Thomasius schenkte großzügig nach. Die Fastenzeit hatte noch nicht begonnen, weshalb sie noch nicht allzu viel des Gebräus verzehrten. Während des Fastens sah dies schon anders aus. Außer Wasser und Brot, vielleicht auch einmal einen Fisch, war es ihnen nicht gestattet, sich etwas Besonderes, wie Speck, Fleisch oder Butter, einzuverleiben. Deshalb hatte die Erfahrung der letzten Jahrhunderte gezeigt, dass flüssiges Brot sehr gut dabei half, die Fastenwochen zu überstehen. Außerdem hatte ein jeder vom Novizenmeister Caesarius gelernt: „Bier bricht das Fasten nicht!“
Nachdem Acabus erneut einen randvollen Krug, dazu fast ein halbes Dutzend Schmalzbrote und einige Speckstreifen zur Stärkung seines vom Ritt geschundenen Körpers nachgeschoben hatte, signalisierte ein kräftiger Rülpser, dass er gesättigt war. Stöhnend lehnte er sich an die Wand zurück und schaute die beiden Mönche schweigend an, die ihm während der gesamten Prozedur nur stumm zugesehen hatten. Er hob die Augenbrauen, als wollte er fragen: „Was gibt’s?“ Doch dann fiel ihm ein, dass er seinen Auftrag bisher nicht erledigt hatte und die Nachricht aus Heisterbach noch immer in seiner Satteltasche steckte. Behäbig richtete er sich wieder auf und beugte sich nach vorne zu seinen Satteltaschen. „Hier ist sie!“ Zum Glück hatte er seine Finger zuvor am Wams abgerieben, sonst wäre er Gefahr gelaufen, dass sich das Fett auf dem saugenden Pergament ausgebreitet und die Tinte zum Verlaufen gebracht hätte.
Sogleich erkannte Hermann das Siegel von Caesarius und freute sich, von diesem zu lesen. Zunächst dachte er, dass dieser ihm lediglich einen Bericht aus seinem Heimatkloster senden würde, in dem stand, was sich in der letzten Zeit alles ereignet hatte. Doch dann lief ihm ein Schauer über den Rücken und die Befürchtung stieg in ihm auf, es könne doch etwas Schlimmeres passiert sein.
Schließlich hatte Caesarius einen richtigen Boten mit der Überbringung betraut. Ansonsten war es üblich, Nachrichten einem reisenden Bruder mitzugeben, der diese dann soweit in die gewünschte Richtung mitnahm und dann einem anderen weiterreichte, dessen Weg den Bestimmungsort noch näher streifte. So dauerte es manchmal Monate, bis Briefe ihren Empfänger erreichten, und oftmals kamen sie überhaupt nicht an. Caesarius aber hatte bewusst diesen Menschen hier ausgewählt, dessen einzige Aufgabe darin bestand, als Kurier seine ihm anvertrauten Botschaften möglichst schnell und diskret von Kloster A nach Kloster B zu bringen. Und da Acabus seine Aufgabe als erledigt ansah, wollte er sich zurückziehen, um sich zeitig hinzulegen und mit Sonnenaufgang seinen Ritt gen Süden fortzusetzen. „Spätestens am Abend muss ich in einem Kloster namens Sankt Severus sein und die nächste Nachricht abliefern“, sagte er und verabschiedete sich.
„Soll ich Euch alleine lassen?“, fragte Thomasius, als er sah, dass Hermann stumm dasaß und das ungebrochene rote Siegel ansah. Vor seinem geistigen Auge konnte er Caesarius sehen: wie dieser das Pergament zur Hand nahm und sich dabei mehrfach am Rand seiner Tonsur kratzte. Mit seinen knochigen Fingern nahm er die Feder, deren Kiel er mit einer kleinen Klinge anspitzte. Vorsichtig zeichnete er seine Buchstaben, als handelte es sich um kleine Kunstgemälde. Nachdem sein Werk vollbracht war, las er es erneut. Sicher fühlte er sich genötigt, hier und da ein paar Änderungen vorzunehmen. Allerdings führte dies wiederum dazu, dass sein zuvor einwandfreies Schriftbild mit unansehnlichen Makeln versehen wurde, weshalb er den Zettel in das Behältnis für sauber zu schabende Pergamente packte und einen neuen Bogen beschrieb. Diesen faltete er mit seinen langen, sich fast spinnenbeinartig bewegenden Fingern geschickt zusammen und verschnürte ihn mit einer Leinenkordel. Dann nahm er einen Wachsstab, hielt ihn über eine Kerzenflamme, tröpfelte das flüssige Wachs auf die gewünschte Stelle, löste seinen Siegelring vom Finger und drückte diesen zielsicher in die heiße Masse. Nach dem Erstarren prangte dort ein Kreuz, an dessen Längsseiten links ein C und rechts ein H stand: Caesarius von Heisterbach.
„Soll ich den Brief für Euch öffnen, Bruder?“, bot Thomasius an, als er spürte, dass der Abt in einer gewissen Lethargie verharrte. Hermann reichte ihm stumm den Zettel. Thomasius brach das Siegel und löste die Schnur. Er entfaltete den Brief und reichte ihn Hermann. Zögernd, als traue er sich nicht zu lesen, was Caesarius geschrieben hatte, nahm dieser die Nachricht entgegen. Stumm schaute er Thomasius an, der ihm aufmunternd zunickte. Also fasste der Abt sich ein Herz, hob das Blatt ins Licht und begann zu lesen. An der Mimik und dem Runzeln der Stirn erkannte Thomasius, dass Hermann dort nicht irgendetwas Banales las. Wären es Klosterberichte oder gar Anekdoten aus der Heimat, hätte er mit Sicherheit anders reagiert.
„Bruder, sagt, was ist? Ist etwas in Heisterbach geschehen? Etwas Schlimmes? Ist jemand verstorben?“ Hermann sah auf und schüttelte langsam den Kopf. Dann reichte er seinem Mitbruder den Brief und sagte: „Da lest, vielleicht könnt Ihr mir helfen, den Inhalt zu interpretieren. Ich werde aus Bruder Caesarius’ Worten nicht schlau. Doch ich weiß, wenn er eine Nachricht verschlüsselt weitergibt, dann tragen seine Worte eine schwere Last.“ Thomasius nahm den Zettel und kaum, dass er den Inhalt erfasst hatte, zog auch er seine Stirn kraus. Er schaute Hermann an und wiederholte leise die letzten – und wahrscheinlich wichtigsten – Zeilen: „SEHET EIN PFEIL DES PELIKANS. ER HAT DIE SEHNE DES BOGENS VERLASSEN UND FLIEGT SAMT TITULUS. LANDUNG NAHE SATIVIC. SUCHET DIE OURIDA BEI DER STEINERNEN STUBE! GEHET KURZ NACH JAHRESBEGINN LOS. IN FREUDIGER ERWARTUNG EINER GUTEN NACHRICHT EUER CSCH.“
Nein, auf Anhieb konnte auch Thomasius des Rätsels Lösung nicht ergründen und legte das Blatt ratlos auf den Holztisch.
„Kurz nach Jahresbeginn, das bedeutet schon sehr bald!“, sagte er zu Hermann. Heute war der 22. März und in drei Tagen würde das Jahr 1200 beginnen, denn nach der aktuellen Zeitrechnung, dem sogenannten Annuntiationsstil, beziehungsweise im Stil Mariä Verkündigung, begann das Jahr stets Ende März. Enttäuscht ob der Unfähigkeit, die Worte Caesarius’ auf Anhieb vollends zu entschlüsseln, nahm Hermann den Zettel an sich und zog sich ins Dormitorium zurück. Dort legte er sich auf seine Pritsche und rezitierte jedes einzelne Wort vorwärts wie rückwärts. Plötzlich erkannte er kleine Bausteine in der Nachricht.