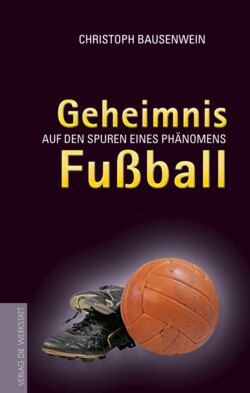Читать книгу Geheimnis Fussball - Christoph Bausenwein - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеFÜSSE
Im Gegensatz zu anderen Sportarten, die ebenfalls „Football“ genannt werden, basiert der Ablauf des Spiels beim Fußball tatsächlich auf dem Gebrauch des Fußes. Während beim Fußball lediglich die Sonderposition des Torwarts und der beidhändig auszuführende Einwurf die Ausnahmen des Handspiels bilden, ist beim Rugby und American Football das Fußspiel so selten, dass man beide eher als Handballspiele bezeichnen müsste. Weil er das einzige Spiel ist, in dem konsequent auf den Gebrauch der Hände verzichtet wird, sind Fußballspieler wohl auch die einzigen Sportler, die ihr Spielgerät wie einen „beseelten“ Gegenstand behandeln. Fangende Hände erkennen den Ball nicht als Mitspieler an; sie um-fangen ihn, und dadurch kontrollieren und disziplinieren sie ihn. Nie entkommt der hin- und hergeworfene Ball dem Kommando der Hände, kaum weggeschleudert, wird jede gerade entstandene Eigendynamik schon wieder im groben Griff abgewürgt. Der Ball, der nur im Flug für kurze Zeit dem Gefangen-Sein entkommt, bleibt wie tot, spielt nicht mit. Ganz anders verhält es sich im Fußball. Weil der Ball mit dem Fuß nicht in Besitz genommen werden kann, bleibt er immer frei. Weil die Hand aus dem Spiel ist, kann der Ball selbst ins Spiel kommen und seinerseits mit den Menschen spielen.
Aus der Idee, den Menschen im Spiel seiner natürlichen Greifwerkzeuge zu berauben, ließe sich eine komplette Fußphilosophie entwickeln. In Anlehnung an Martin Heideggers Studie „Sein und Zeit“ könnte man zum Beispiel sagen, dass der Ball, solange er nur mit der Hand gespielt wird, „zuhandenes Zeug“ bleibt. Das heißt, er wird behandelt wie ein Werkzeug, das – wie der Hammer zum Hämmern – nur interessiert, sofern es zu etwas verwendbar und tauglich ist. Hand-Bälle müssen handlich sein für den scharfen Wurf aufs Tor oder handhabbar für den langen Pass des Quarterback. Sie bleiben vordergründigen Spielzwecken in ähnlicher Weise unterworfen wie bestimmte Geräte zur Erledigung spezifischer Arbeitsvorgänge. Wird der Ball aber mit dem Fuß gespielt, so muss der Spieler nicht nur „unnütze“, aufwändige und komplexe Bewegungsabläufe erlernen, sondern er lässt mit den Händen auch die gewohnte Bewegungskoordination des Alltags aus dem Spiel. Ausgehend von der freiwilligen und zweckfreien Fußbewegung ist der Körper im Fußball schon vom Ansatz her wie nirgendwo sonst als ein spielender zur Geltung gebracht.
Ist das durch Arbeit zu besorgende Dasein durch die Notwendigkeit des Greifens und Be-greifens der Dinge gekennzeichnet, so können sich erst im Spiel die Möglichkeiten einer freien Begegnung und Bewegung mit den Dingen entfalten, die nicht von Zwecken diktiert ist. Im Fußballspiel, das sich wie kein anderes gegen alle Begriffe und Berechnungen sträubt, kommt daher das Spiel in seiner reinsten Weise zum Ausdruck; hier ist, wie alle wissen, „alles möglich“. Fußball wird damit sogar zu einer Metapher für das menschliche Leben schlechthin. Man kann, um das zu verstehen, Heidegger lesen – „Dasein ist nicht ein Vorhandenes, das als Zugabe noch besitzt, etwas zu können, sondern es ist primär Möglichsein“ – oder aber, was mental weniger anstrengend ist, einfach mal ein Fußballspiel anschauen. Für diese Lösung entschied sich gegen Ende seines Lebens auch Heidegger selbst, als er immer häufiger bei seinem Nachbarn auftauchte, um sich dort die Fußballübertragungen im Fernsehen anzuschauen. Des philosophischen Brütens über mögliches Dasein in seiner Seinshütte offensichtlich etwas müde geworden, erregte er sich lieber, dabei auch schon mal eine Tasse umwerfend, über das Da-Sein von Möglichkeiten, die stümperhaft vergeben wurden.
Damit das Erkennen des „Stümperhaften“ überhaupt möglich wurde, musste sich allerdings erst einmal eine Vorstellung von der fußballerischen Könnerschaft entwickeln. Im Fußball geht es im Prinzip nur darum, im richtigen Moment in geeigneter Weise mit dem Fuß vor den Ball zu treten. Das klingt zwar einfach, ist es aber keineswegs. Bis man diese „geeigneten Weisen“ gefunden und erprobt hatte, waren jahrzehntelange „Tests“ nötig. Da in der Frühzeit des Fußballs der Stoß mit der Fußspitze als die einfachste und natürlichste Technik des Spiels galt, kickte man in schweren Schuhen, die vorne mit harten Kappen verstärkt waren. Die Kritik des Spitzenstoßes setzte erst ein, als man allmählich erkannte, dass die Anatomie des Fußes vielfältigere und zuverlässigere Schusstechniken ermöglicht. Im Jahr 1898 bemerkte beispielsweise der deutsche Fußballpionier Philipp Heineken in seinen Anweisungen zum kunstgerechten Torschuss, dass sich bei weiterer Entfernung „ein kräftiger starker Stoß mit den Zehen“ empfehle, schränkte aber gleichzeitig ein: „Im großen Ganzen empfehlen wir aber das Stoßen mit den Zehen wegen seiner Unsicherheit nicht, das Beste ist und bleibt ein Stoß mit der Innenseite des Fußes.“ Wie sehr Heineken damals mit dieser Empfehlung seiner Zeit voraus war, erweist ein Blick in das im Jahre 1900 von Gustav Schnell herausgegebene „Handbuch der Ballspiele“. Im selben Jahr, als sich in Leipzig der deutsche Fußballbund konstituierte, schienen dem Verfasser nur „kräftige Schnürstiefel“ für den Fußball geeignet, die „vorn nicht modisch spitz, sondern, damit der Ball beim Stoßen um so sicherer zu treffen ist, breit sein müssen“.
In Afrika, Asien und Südamerika machen junge Kicker, aus Mangel geboren, bis heute ohne Schuhwerk ihre ersten Kick-Erfahrungen. Der brasilianische Jungstar Robinho eignete sich seine brillante Ballbehandlung in den Straßen der Stadt Sao Vicente an: „Wir spielten immer barfuß, erzählte er der Zeitschrift „FIFA-Magazine“, „manchmal mit einer Zitrone, manchmal gar mit Steinen.“ Ersten Anschauungsunterricht, dass man auch ohne schweres Fußgerät kicken kann, erteilte der Brasilianer Leonidas den grobbeschuhten Europäern während der WM 1938. Als während der zweiten Halbzeit im Spiel gegen Polen der Regen herniederprasselte, zog er einfach die Fußballschuhe aus, um von den durch die Nässe schwer gewordenen Ledergewichten nicht behindert zu werden. Ein FIFA-Beauftragter nötigte ihn schnellstens dazu, sie wieder anzuziehen, so dass das Experiment folgenlos blieb. Folgenlos blieben auch die Tourneen einiger nigerianischer Barfuß-Spieler im England der 1940er Jahre. Und die Inder verzichteten freiwillig-unfreiwillig auf die Teilnahme an der WM 1950, als sie hörten, dass das Tragen von Fußballschuhen Pflicht sei. Solche klobigen Dinger wollten sich die lediglich mit Bandagen ausgestatteten Ballstreichler aus dem Land der Fakire nicht antun.
Es war aber dann dennoch ein Kulturaustausch, der die Europäer vom grobschlächtigen Kappenschuh abkommen ließ. Ende der 1940er Jahren staunte der spätere Meistertrainer Max Merkel, damals Verteidiger in Diensten von Rapid Wien, während einer Tournee in Südamerika über die dort verwendeten leichten „Mokassins“, die ersichtlich eine bessere Balltechnik ermöglichten. 1950 beobachtete die englische Fußball-Legende Stanley Matthews bei der Weltmeisterschaft in Rio de Janeiro die Brasilianer, und auch ihm fiel, neben der virtuosen Kunst der Spieler, das Schuhwerk auf. Die Schuhe waren leicht, aus dünnem Leder gefertigt, stromlinienförmig geschnitten und boten, da der Knöchel frei blieb, viel mehr Bewegungsfreiheit als die schweren und klobigen englischen Stiefel. Matthews war begeistert, kaufte ein Exemplar und spielte fortan, nachdem er sein Mitbringsel „verbraucht“ hatte, nur noch in „Mokassins“, die er sich von einem Schuhmacher nach dem brasilianischen Vorbild fertigen ließ.
Matthews’ Schuhe waren im England der 1950er Jahre eine Revolution, allein schon wegen ihres geringen Gewichts. Die ersten gegen Ende des 19. Jahrhunderts konstruierten speziellen Fußballstiefel, die wegen des damals noch üblichen Stoßes mit der „Pike“ an der Spitze durch eine Stahlkappe verstärkt waren, wogen rund 600 Gramm. Nach der Gewichtsreduzierung durch ein im Jahr 1914 herausgebrachtes Modell auf 545 Gramm hatte sich nicht mehr viel getan. Die nächste Revolution auf dem Sportartikel-Markt erfolgte erst 1954 durch Adolf Dassler, als er mit seinem berühmten Schraubstollen-Modell einen entscheidenden Beitrag lieferte zum legendären 3:2-Sieg Deutschlands über Ungarn auf dem glitschigen Geläuf des Berner Wankdorfstadions. Doch nicht nur die Stollen waren entscheidend: Dasslers Schuhe wogen mit 380 Gramm über ein Drittel weniger als die damals in England üblichen „Hotspur“-Schuhe. Adidas wurde bald zur internationalen Top-Marke. 1966 gewannen die Engländer gegen Deutschland in den – nun auch mit elastischen Sohlen ausgerüsteten – Wundertretern aus dem fränkischen Herzogenaurach. Aber auch diese Schuhe waren immer noch ungefähr doppelt so schwer wie die heutigen. Im dritten Jahrtausend wird mit luftigen Schühchen gekickt, die gerade mal noch 150 Gramm – und damit nur noch ein Viertel der Ungetüme von einst – auf die Waage bringen.
Sepp Herberger hat davon geträumt, einmal einen Schuh unter 300 Gramm zu bekommen. Er konnte sich ausrechnen, wie wichtig das Gewicht ist. Denn ist ein Fußballschuh nur um 100 Gramm leichter, so bedeutet dies bei einem Paar schon 200 Gramm. Geht man nur von rund 10.000 Schritten aus, die in 90 Minuten bewältigt werden, so kommt man bereits auf zwei Tonnen, die ein Spieler pro Spiel weniger bewegen muss! Allein schon die Reduzierung des Gewichts führt also zu einer größeren Leichtfüßigkeit. Noch wichtiger ist aber sicherlich die größere Beweglichkeit im Fuß, die ein leichter, wie eine zweite Haut angepasster Schuh gewährt.
Stanley Matthews hatte als Erster erkannt, dass sich nur mit entsprechenden Schuhen die ganzen Möglichkeiten fußballerischer Techniken entfalten lassen. Als leichtere Schuhe allgemein zur Verfügung standen, entwickelten immer mehr Fußballer ein besonderes Verhältnis zu ihrem Schuhwerk. Sie konnten gar nicht bequem und zugleich eng genug sein. Solange die Schuhe noch aus recht grobem Leder gefertigt waren, war es üblich, in die neuen Treter hineinzupinkeln und sie dann feucht einzulaufen, um ihnen eine perfekte Passform zu verleihen. Einer wie Stuttgarts „Buffy“ Ettmayr schwor in den 1970er Jahren sogar auf im wahrsten Sinne des Wortes „eingelaufene“ Schuhe. Er trug seine „Arbeitskleidung“ grundsätzlich zwei Nummern kleiner. „Ich wollte immer ein Kondom an den Füßen haben, sonst hast du ja doch kein Gefühl“, begründete er seine Marotte. Und hatte sich ein Spieler mal an ein Paar gewöhnt, behielt er sie so lange am Fuß, wie es nur ging. Als Bobby Breuer zum Puma-Verein Bayern Hof wechselte, wollte er weiterhin in den gewohnten Adidas-Schuhen kicken. Betreuer Andres Högen musste die Streifen abmachen und das Puma-Logo aufnähen. Irgendwann probierte er die Raubtier-Schlappen aus Känguru-Leder dann doch einmal aus, und da waren sie ihm so angenehm, dass er sie 1972 bei seinem Wechsel nach Innsbruck unbedingt mitnehmen wollte. In Puma-Schuhen spielte auch Lothar Matthäus. Nur in der Nationalmannschaft musste er, weil der DFB einen Ausrüster-Vertrag mit der Konkurrenz hatte, mit Adidas-Schuhen spielen. Seit der WM 1986 trug er in Länderspielen immer dasselbe Paar. Bis zum Endspiel 1990. Da brach an seinem altgedienten und lange bewährten rechten Schuh ein Stollen ab. Das hatte ungeahnte Konsequenzen: Weil er sich in dem rasch herbeigeschafften Ersatz noch völlig gefühllos wähnte, verweigerte er, obwohl als Schütze vorgesehen, die Ausführung des entscheidenden Elfmeter-Stoßes. Andreas Brehme, offensichtlich mit alten und vertrauten Tretern ausgerüstet, übernahm die Aufgabe und traf.
Selbst die vertrautesten und besten Schuhe verhelfen ihrem Träger natürlich nicht automatisch zu perfekter Balltechnik. Der Ball bleibt ein eigenwilliges Objekt, das sich nicht jedem fügt. Jeder, der einmal Fußball gespielt hat, weiß, wie schwer bereits das kleine Einmaleins des Spieles – das Stoppen und Kontrollieren des Balles – zu erlernen ist. Weil der Fußballspieler den Ball nicht fangen darf, hat er ihn nie vollständig unter Kontrolle und kann also nur versuchen, ihn unter Aufbietung aller körperlichen Geschicklichkeit zu bändigen. Statt den Ball zu greifen, muss er seine Eigengesetzlichkeit be-greifen. Er muss sich in den Ball gleichsam „hineinversetzen“ und sich seiner Bewegung anschmiegen. Bei der Ballannahme darf der Spieler die Eigenbewegung des Balles nicht brechen, sondern er muss sie wahrnehmen, antizipieren, aufnehmen und umleiten. Der Fuß muss dem hoch oder flach einfallenden Ball entgegengeführt und noch vor dem Moment des Auftreffens im richtigen Tempo zurückgenommen werden, so dass ihm die Wucht genommen wird. Nur dann, wenn der Spieler auf diese Weise der Bewegung des Balles entgegenkommt und sie gleichsam verlängert, kann das „runde Leder“ für einen Augenblick so gezähmt werden, dass es spielbereit vor den Füßen liegen bleibt.
Erkennt ein Spieler den Ball nicht als einen Spielpartner an, der viel Gefühl verlangt, so verweigert der sich im spröden Zurückprallen. Schlechten Spielern springt er immer wieder vom Fuß, guten Spielern hingegen gelingt es sogar, den Ball mit der sanft mitschwingenden Oberseite des Fußes wie in einem Daunenkissen aufzufangen. So lässt sich bereits bei der Ballannahme erkennen, wer mit dem Ball umgehen kann und wer mit ihm auf Kriegsfuß steht. Während Spieler wie Maradona und Pelé den Ball annehmen und führen können, als ob sie Magneten an den Füßen hätten, gibt es andere, „bei denen man weinen möchte“, so der Meistertrainer Max Merkel, weil sie „sich den Ball mit ‚Uhu‘ an die Füße kleben müssten, um ihn nicht zu verlieren.“ Doch selbst den Allergrößten unterlaufen immer wieder scheinbar anfänger-hafte Fehler – was nur beweist, dass die Fußbeherrschung von Natur aus weit schwieriger ist als das Fangen und Werfen mit der Hand.
Wenn ein argentinischer Journalist in eigenartiger Ausdrucksweise von Maradona behauptete, dass er „Hände an den Füßen“ habe, so traf er das Wesentliche nicht. Denn beim Fußball geht es nicht darum, aus dem Fuß eine Hand zu machen, sondern die speziellen Möglichkeiten des Fußes gegenüber der Hand voll zu entfalten. Der Fuß ist ein recht kompliziertes, aber außerordentlich bewegliches und elastisches Gebilde, das man zu weit mehr als nur zur Fortbewegung nutzen kann.
Während die spezifischen Fähigkeiten der Hand durch die Finger und nicht durch die Handwurzel gegeben sind, liegen die Verhältnisse beim Fuß genau umgekehrt. Die Zehen können zwar auch gestreckt und gebeugt werden, doch die Beweglichkeit des Fußes ist vor allem durch die in der Fußwurzel liegenden Sprunggelenke gewährleistet. Das obere Sprunggelenk verbindet das über dem Fersenbein liegende Sprungbein mit den beiden Unterschenkelknochen. Die unteren Teile von Schien-und Wadenbein, die durch eine feste Bandverbindung zusammengefügte Knöchelgabel, umklammert zangenartig die Gelenkflächen des Sprungbeins. Diese Art der Zusammenführung und die kräftig ausgebildeten Seitenbänder bedingen, dass im oberen Sprunggelenk nur Beuge- und Streckbewegungen um eine querverlaufende Achse vorgenommen werden können (Heben und Senken der Fußspitze). Sprungbein, Fersenbein und Kahnbein begrenzen mit ihren Gelenkflächen das untere Sprunggelenk. Dort erfolgen die Bewegungen des Fußes um eine schräg verlaufende Achse (Heben und Senken der inneren und äußeren Fußkante). Auf der Kombination dieser beiden Bewegungsmöglichkeiten beruhen alle Kunstfertigkeiten beim Fußballspiel.
Die Hand ist vor allem zum Greifen gemacht, und deswegen wird der Ball bei dem Spiel, das nach ihr benannt ist, vor allem gefangen und, aus dem festen Griff heraus, geworfen. Natürlich kann man den Ball mit der Hand auch noch auf andere Weise traktieren – etwa fausten, oder, wie beim Volleyball, mit der Handkante schmettern, mit den Fingerspitzen servieren oder mit der Handinnenfläche retournieren –, dennoch hat der hochspezialisierte Fuß, was die Möglichkeiten der Ballbehandlung anbelangt, eine noch größere Variationsbreite: Der Ball kann mit allen vier Seiten (Innen, Außen, Spitze, Ferse) sowie mit der Oberseite und der Sohle des Fußes gespielt werden. Die wichtigsten Stoßtechniken des Fußballs beruhen dabei auf der erstaunlichen Vielseitigkeit der Oberseite. Sie ist keine einfache, glatte Fläche, sondern eine dreigeteilte „Abschussrampe“, die das Wunder des gezielten und scharfen Stoßens erst ermöglicht: Die Stöße mit dem Vollspann, dem Außenspann (Außenrist) und dem Innenspann (Innenrist) zählen zu den Fertigkeiten, die jeder Fußwerker beherrschen muss. Zieht man von diesen Möglichkeiten die technisch falschen Stöße ab (mit der Fußspitze und der schmalen Außenkante), so stehen dem Fußballer neben zwei Spezialtechniken (Fersenkick und Sohlenzieher) allein vier Varianten zur Verfügung, um den Ball zu stoßen. Diese Vielseitigkeit des Fußes ermöglicht es, den Ball sanft zu schieben, wie am Lineal gezogen geradeaus zu schießen, ihn „in die Luft zu schaufeln“, so dass er die Kurve einer Bogenlampe beschreibt, ihn mit Effet nach außen zu zirkeln, oder ihn so nach innen anzuschneiden, dass er eine elliptische Flugbahn in die Luft zeichnet.
Die durch die Anatomie des Fußes ermöglichten verschiedenen Techniken der Ballbehandlung erfordern ein feines Körpergefühl und sind selbst für Begabte nur in langjähriger Übung zu erlernen. Sehr wenige Spieler erlangen in der Ballbeherrschung eine derartige Sicherheit, dass sie ihn mit traumwandlerischer Sicherheit an die gewünschte Position adressieren können. Die einfachste Übung, die auf Anhieb gelingt, ist es, den Ball „irgendwie“ mit dem Fuß zu kicken. Schwieriger ist es schon, in einem runden Bewegungsablauf einen zielsicheren Stoß mit der Innenseite auszuführen. Die Aufgabe, einen scharfen und gezielten Vollspannstoß auszuführen, stellt schon manche Profis vor erhöhte Probleme – was kein Wunder ist: Denn das Ansinnen, das Zentrum des Balles bei nach unten gedrücktem Fuß genau und wuchtig zu treffen, ohne dabei ein Loch in den Rasen zu schlagen, ist wahrlich nicht einfach in die Tat umzusetzen. Nur wenigen gelingt es, in dieser Kunst zu promovieren wie der Frankfurter Bernd Nickel, dem in den 1970er Jahren von den Bewunderern seines Schusses der fußballerische Grad eines „Dr. Hammer“ verliehen wurde. Heute gilt der Brasilianer Roberto Carlos, der Mann mit den dicksten Oberschenkeln im modernen Fußball, als der Mann mit dem härtesten Schuss. Wie schnell der ist, steht nicht ganz sicher fest; gemessen wurden angeblich bis zu 170 km/h. Der als „Bomber“ besungene Gerd Müller hingegen glänzte weniger durch einen harten Schuss denn durch seine Fähigkeit, sich im Strafraum durchzuwühlen und dort herrenlos umhertrudelnde Bälle per „Abstauber“ aus kurzer Distanz zu verwerten.
Auch für die anderen Stoßarten entwickelten sich Spezialisten: die „Bananenflanken“, Resultat der Fähigkeit, den Ball bei leicht nach oben gezogener Fußspitze mit dem Innenspann gezielt außerhalb seines Zentrums zu treffen, waren das Markenzeichen von Manfred Kaltz und wurden später von Könnern wie dem Portugiesen Figo und Englands Superstar David Beckham kopiert; der Brasilianer Didi war berühmt für seinen Kunstschuss „fohla seca“ (welkes Blatt), der auf einer „S“-Linie durch die Luft fliegt und kaum zu berechnen ist; der gefühlvolle Schlenzer mit dem Außenspann, der sich in weitem Bogen um den Gegner herumdreht, war ein „Schmankerl“ im Repertoire von Franz Beckenbauer.
Vor allem bei den so genannten Standardsituationen waren und sind solche Spezialisten des „Anschneidens“ gefragt. Einer der ersten war der Uruguayer Hector Scarone, der bei den Olympischen Spielen 1924 gleich zweimal vom Eckpunkt aus ins Tor traf. Da die Treffer nicht zählten, stellte Uruguay einen Antrag auf Regeländerung, dem am 1. Oktober prompt stattgegeben wurde. Die Quittung: Am Tag darauf verlor Uruguay in einem Länderspiel gegen Argentinien mit 1:2; der Argentinier Cesare Onzari verwandelte dabei in der 10. Minute einen Eckstoß direkt. In Südamerika heißt daher ein direkt verwandelter Eckball bis heute „Olympisches Tor“.
Mario Basler hat später keinen eigenen Begriff geprägt, ist aber in derselben Sparte zu Ruhm gelangt, da es ihm in frappierender Häufigkeit gelang, Eckstöße mit seinem starken rechten Fuß direkt im Tor zu versenken. Als einer wissen wollte, wie er das denn mache, gab er die frappierend einfache Antwort: „Das Ventil des Balles muss immer oben liegen und die Markierung des Herstellers rechts – und da haue ich drauf, fertig.“ Von der Grundsituation her etwas komplexer sind die Freistöße, da es hier darum geht, denn Ball möglichst um die vor dem Tor postierte lebendige Mauer aus Spielerleibern „herumzudrehen“. Heute gibt es zahlreiche Spezialisten in dieser Sparte. Als Meister des ruhenden Balls gilt David Beckham. Glaubt man einem Werbespot, so schafft er es sogar, über eine Straßenbreite hinweg auf gezirkelter Linie in einen Abfalleimer hineinzutreffen.
Gelingen solche Schüsse, die manchmal einer kaum glaublichen Flugbahn folgen, sind ihnen Abwehr und Torhüter beinahe hilflos ausgeliefert. Englands Gordon Banks musste einst in einem Spiel gegen Brasilien diese Erfahrung machen, als der geniale Freistoßschütze Pelé den Ball perfekt über die Mauer zirkelte: „Pelé nahm tänzelnd Anlauf und schlug den Ball ungeheuer kraftvoll mit dem Außenrist seines linken Fußes. Ich sah, wie er in einer Linkskurve über die Mauer flog, aber als ich mich bewegte, um die linke Ecke abzudecken, drehte der Ball plötzlich auf einen vollkommen anderen Kurs, und ich musste hilflos zusehen, wie er hoch oben im rechten Toreck einschlug. Ich konnte es überhaupt nicht fassen. Ich wäre jede Wette eingegangen, dass niemand in der Lage ist, dem Ball in der Luft einen solchen Drall zu geben, und genauso, dass kein Torhüter auf der Welt so einen Ball hätte stoppen können. … Nach diesem Freistoß hatte das Torwartspiel für mich keinen Sinn mehr.“
Eine ähnlich leidvolle Erfahrung blieb auch dem Torwart von Epa Larnax (Zypern) in einem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach nicht erspart. In scheinbar weiser Voraussicht, dass der gefürchtete Kunstschütze Günter Netzer den Ball in weitem Bogen um die Mauer schnippeln würde, hatte er diese auf den zu erwarteten Radius und damit neben den Torpfosten dirigiert. Nur in Anbetracht dieser ungewöhnlichen Situation brachte es Netzer dann über sich, den Ball ausnahmsweise einmal entlang des weit offen stehenden direkten Weges schnurgerade ins Tor zu schießen.
Vollends in den Rang einer Kunst erhoben wird das Fußballspiel bei den verschiedenen Kunststößen. Zum Repertoire aller technisch versierten Profis gehören der Dropkick, bei dem der Ball kurz nach dem Bodenkontakt mit dem Voll- oder Außenspann zu treffen ist. Die Kunst des Hüftdrehstoßes, bei dem der Ball in Hüfthöhe volley geschlagen wird, ist nur wenigen gegeben. Im Champions League Finale 2002 (Real Madrid gegen Bayer Leverkusen) versenkte der unvergleichliche Zinedine Zidane nach einem unpräzisen Zuspiel von Roberto Carlos auf diese ungewöhnliche Weise den Ball im Tor. Scherenschläge, für deren Ausführung es erforderlich ist, dass der Spieler vor dem Ballkontakt abspringt, um ihn dann, für Augenblicke schräg in der Luft hängend, mit einer Scherenbewegung der Beine zu treffen, zählen zu den nur geschmeidigen Könnern vorbehaltenen Spezialitäten. Für solche Kunststücke erhielt der Brasilianer Leonidas, Torschützenkönig der Weltmeisterschaften von 1934 und 1938, wohl nicht zu Unrecht den Ehrentitel „The Rubber Man“.
Recht selten zu sehen ist auch der Fallrückzieher, der hierzulande eigentlich „Fischer-Zieher“ heißen müsste, da der Nationalspieler dieses Namens der einzige Deutsche war, bei dem der Versuch, den Ball auf dem Rücken „schwebend“ über den Kopf zu ziehen und anschließend ins Tor zu treffen, in bemerkenswerter Häufigkeit gelang. Der aller-schönste der Fischer-Treffer, 1977 erzielt, wurde in Deutschland zum „Tor des Jahrhunderts“ gewählt. Die speziellste Variante allerdings, von Uwe Seeler demonstriert, blieb leider unprämiert: Auf dem Rücken am Boden liegend, erfasste er den vom Torwart zurückprallenden Ball, stemmte sich auf einen Ellenbogen und kickte ihn liegend über seinen Kopf und den Tormann hinweg ins Tor.
All diese Aktionen erfordern eine fein abgestimmte Koordination der gesamten Körperbewegungen sowie eine gleichzeitige Einberechnung der Eigenbewegungen des Balles. Eine der schwierigsten Techniken beim Fußball, die Ballannahme mit der Ferse über den Kopf, zeigt beispielhaft die Kompliziertheit der Abläufe. „Während der Annahme mit der Ferse ruht das Körpergewicht auf dem im Knie stark gebeugten Standbein, dessen Fußspitze schräg nach vorn gerichtet ist“, beginnt die Erläuterung in einem Lehrbuch. Und so geht’s weiter: „Der Oberkörper wird vorgebeugt und etwas in Richtung des anderen Beins gedreht. Der Arm der Standbeinseite schwingt locker nach vorn, der andere etwas nach hinten, so dass beide das Gleichgewicht halten. Das Spielbein wird aus der Hüfte etwas nach außen gedreht und, im Knie leicht gebeugt, so weit nach hinten geschwungen, wie es die Höhe des ankommenden Balles erfordert. Die Längsachse des Fußes soll sich dabei parallel zum Boden befinden, so dass der Ball wie auf ein flaches ‚Tablett‘ fällt. Der Spieler hebt den Ball durch ein geringes Hochschwingen des Beines vor sich, wobei der Oberkörper noch stärker vorgeneigt wird.“
Der letztgenannte Stoß zählt, das sei zugegeben, nicht zum Standardrepertoire, das man auf Bundesliga-Plätzen geboten bekommt. Da nur allerbeste Techniker überhaupt eine Chance haben, ihn im Lauf eines Spiels einmal sinnvoll anzuwenden, vergessen moderne Lehrbücher oft sogar, ihn überhaupt zu erwähnen. Die oben zitierte Schilderung konnte einem ungarischen Lehrbuch aus dem Jahr 1955 entnommen werden, woraus man schließen mag, dass gerade die Ungarn vor dem von ihnen „Oxford“ genannten Stoß besonderen Respekt hatten. Tatsache ist jedenfalls, dass im Jahre 1945 der deutsche Kriegsgefangene Fritz Walter, als er in dem Durchgangslager Marmara Szigett die ungarische Wachmannschaft neidvoll beim Fußballspiel beobachtete, einen plötzlich auf ihn zufliegenden abgefälschten Ball mit eben einem solchen „Oxford“ wieder zu seinem Absender zurückbeförderte. Von diesem Kunststoß fasziniert, nahmen ihn die Ungarn in die Lagermannschaft auf und verhinderten damit seinen Abtransport nach Sibirien. Hätten sich die ungarischen Wächter nicht in die von ihm gebotene Fußball-Feinkost verliebt, so hätte er aller Wahrscheinlichkeit nach am Berner Endspiel von 1954 gar nicht teilnehmen können. Da ohne seine Teilnahme ein deutscher Erfolg wohl kaum möglich gewesen wäre, zeigt diese Geschichte nicht nur, dass die Schönheit der Fußballkunst militärische Vorschriften aufweichen kann; sie könnte auch Anlass geben, die alte Fußballer-Weisheit, dass Schönspielerei nicht zum Erfolg führt, endlich um die ungarische Variante zu erweitern: nämlich, dass schon zu viel selbstlose Freude am schönen Spiel spätere Niederlagen vorbereiten kann.
Dass Fritz Walter den „Oxford“ nur außerhalb einer Spielsituation und nicht etwa während des 54er Endspiels in so bemerkenswerter Weise demonstrieren konnte, lässt erahnen, wie schwer es ist, solche anspruchsvollen Techniken unter den Bedingungen des Spiels durchzuführen. Im Spiel findet jeder Ballkontakt unter hohem Tempo und bei permanenter Attacke durch einen Gegner statt. Im Spiel bleibt wenig Zeit für Kunststückchen, denn jede Bewegung muss schnell und effizient sein. Der Ball muss immer eng am Fuß geführt werden, oft muss der Gegner schon bei der Annahme mit einer Körperfinte getäuscht werden, damit man ihn nicht gleich wieder verliert. Freilaufen, Ballannahme, Körpertäuschung, Abspiel – all das muss in einem fließenden Bewegungsablauf nahezu synchron geschehen. Gerade für das moderne, immer athletischer und temporeicher gewordene Spiel ist eine hohe Flexibilität gefordert.
Perfekte Fußballspieler sind heute in der Lage, selbst aus scheinbar ausweglosen Situationen noch etwas zu machen. Wenn es darum geht, sich im Ballbesitz aus einer Umzingelung zu lösen, ist kaum einer so erfinderisch wie der geniale Zidane. Er versteckt den Ball unter der Sohle, dann vollführt er mit tänzerischer Eleganz einen Sprung mit schneller Drehung in Richtung einer seiner Gegner, die dieser unwillkürlich nachvollzieht; im selben Moment aber treibt er den Ball mit der Sohle des anderen Fußes durch die eben entstandene kleine Lücke auf der anderen Seite. Als sei er ein Schattenwesen, hat sich der Zauberer Zidane plötzlich seinen Widersachern entzogen und davongestohlen. Verblüfft können sie nur noch hinterhersehen, wie er ungehindert in den freien Raum stürmt, um dem Spiel eine völlig unerwartete Wendung zu geben.
Die Nachahmung des Zidane-Tricks stellt selbst Könner wie Bastian Schweinsteiger vor Probleme. Grundvoraussetzung ist, dass man sich mit beiden Füßen den Ball zum Freund machen kann. Dass die Kunst des Fußballspielens mit der Beidfüßigkeit eigentlich erst so richtig anfängt, ist den Experten freilich nicht erst seit gestern bekannt. Ende der 1940er Jahre ermahnte der brasilianische Fußballprofi „Dondinho“ seinen Sohn Pelé: „Wenn du jemals ein herausragender Spieler werden willst, musst du mit beiden Beinen gleich stark sein.“ Erst der beidfüßige Spieler kann den Ball in jeder Situation problemlos spielen, weil er sich den Ball nicht erst auf den „starken“ Fuß legen muss. Und nur der, der sich den Ball vom rechten auf den linken Fuß legen kann und umgekehrt, ist in der Lage, den Variantenreichtum des Fußballes voll auszuspielen.
Die Antwort des „linken“ Supertechnikers Wolfgang Overath auf die Frage nach seinem persönlich größten Problem ist von daher nicht erstaunlich: „Mein rechter Fuß.“ Weil die Beidfüßigkeit allgemein als für einen kompletten Fußballer erforderlich betrachtet wird, kann es vorkommen, dass ein verdienter Nationalspieler als „dritter Fuß vom Franz“ belächelt wird, und dass ansonsten balltechnisch exzellente „Einfüßige“ wie Ferenc Puskas versuchen mussten, ihre Schwäche schlitzohrig zu überdecken: „Mit einem Fuß kann man nur halb so viele Fehler machen wie mit zweien.“ Puskas war ein hervorragender Spieler; dennoch steht fest, dass ein Spieler erst durch zwei gleichstarke Füße die volle Entscheidungsfreiheit besitzt, in jedem Moment aus sämtlichen denkbaren Möglichkeiten die beste auszuwählen. Nur durch die Beidfüßigkeit wird ein Fußballspieler – siehe Zidane – für den Gegner unberechenbar.
Weil das Stoßen des Balles mit dem Fuß zwar enorm schwierig ist, aber dennoch vom filigranen Techniker mit hoher Perfektion durchgeführt werden kann, liegen im Fußball geniale Kunst und hilflose Stümperei so nahe beieinander wie in kaum einem anderen Spiel. Für den Zuschauer beruht also der Reiz des Spiels wesentlich auf den Schwächen der Füße. Weil die so oft am widerspenstigen Ball Fehler produzieren, weiß man nie, was passieren wird. Verzweifeln muss deswegen keiner; außer vielleicht die Feinde des Balles, die mit ihm ewig auf Kriegsfuß stehen.