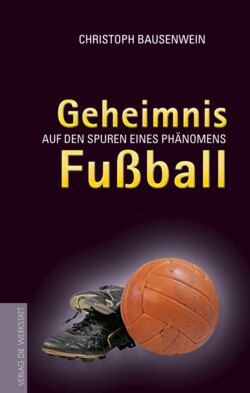Читать книгу Geheimnis Fussball - Christoph Bausenwein - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKÖRPER
Der Fußball ist hauptsächlich ein Fuß-Ballspiel. Trotzdem muss jeder Spieler seinen gesamten Bewegungsapparat koordinieren können. Insoweit unterscheidet sich der Fußball nicht von anderen Ballspielen. Dennoch ist er ein Sonderfall. Es gibt kein anderes Sportspiel, bei dem der gesamte Körper so umfassend im Einsatz ist und der Ball, trotz des Handspiel-Verbotes, auf so vielfältige Weisen bewegt werden kann. Das Berühren des Balles mit dem Oberschenkel, der Brust und dem Kopf ist für den Fußball ebenso typisch wie der Stoß mit dem Fuß. Sogar der Hintern ist manchmal mit im Spiel. Im August 2005 traf ein Mann namens Mathias Körber (!) mit diesem Körperteil sogar ins Tor. Im Spiel des fränkischen Kreisklassenvereins SV Puschendorf gegen Anadoluspor wurde Körber kurz vor Schuss noch einmal steil geschickt. „Als er die Aussichtslosigkeit seines Spurts erkannte“, so der Berichterstatter Michael Loos, „stoppte der Puschendorfer seinen Lauf und wendete sich vom Geschehen ab. Der Schlussmann der Gäste befand sich dagegen noch in höchster Alarmbereitschaft und setzte zu einem fulminanten Befreiungsschlag an. Dieser landete weder beim eigenen Mann noch im Seitenaus, sondern genau auf Körbers Hinterteil, von wo aus das Leder am verdutzten Torhüter vorbei etwa zehn Meter weit geradeaus ins Netz kullerte.“ Dieses seltene Tor zum 4:1-Endstand für Puschendorf kommentierte ein Zuschauer fachmännisch mit den Worten: „Den Mathias sei Arsch hat a Tor g’schossen.“
Seit diesem Ereignis sollte man korrekterweise nicht mehr von einem Fußball-, sondern von einem „Ganzkörberspiel“ sprechen. Der Hintern ist, das soll zugegeben werden, nur in Ausnahmefällen und dann meist nur beim Sperren des Balls beteiligt. Aber kommen wir zu den regelmäßig eingesetzten Körperteilen. Der Einsatz von Brust und Oberschenkel ist vor allem bei der Annahme hoher Bälle erforderlich. Durch Zurücklehnen des Oberkörpers wird der Ball „aufgefangen“ und dann auf den Fuß hinuntergelassen, durch Vorbeugen wird er auf den Boden gedrückt und in den Lauf mitgenommen. Dieselben Möglichkeiten bietet das Annehmen des Balles mit dem Oberschenkel. Von Brust oder Oberschenkel abgelegt, kann der gute Techniker den Ball seinen Füßen so servieren, wie er es für die folgende Spielaktion gerne haben will: So, dass er spielbereit zu Boden fällt, oder so, dass er – als „abgetropfter“ Ball – aus der Luft volley genommen werden kann.
Der Kopf kommt weniger bei der Ballannahme als bei der Abwehr hoher Bälle oder als Stoß aufs Tor zum Einsatz. Zum Kopfstoß muss der Spieler im richtigen Augenblick ansetzen, um den Ball frontal oder aus der Drehung mit der Stirn voll zu treffen. Ein außerordentliches „Timing“ erfordern Kopfstöße aus dem Sprung, insbesondere dann, wenn der Spieler dem Ball knapp über der Grasnarbe entgegenhechtet. Das Spiel ist also nicht nur durch „Bomber“ mit hartem Spannschuss gekennzeichnet oder durch mit dem Fuß wunderschön gedrechselte Bälle, sondern auch durch „Kopfball-Ungeheuer“ wie Horst Hrubesch, die mit ihrer Stirn den Gegner in Furcht und Schrecken versetzen. Entzückte den Fußball-Feinschmecker früher das „Sich-in-die Luft-Schrauben“ eines Karl-Heinz Riedle, so schnalzt er heute mit der Zunge, wenn der aus dem Mittelfeld sich heranpirschende Michael Ballack zum präzisen Kopfstoß ansetzt.
Zur Artistik wird das Fußballspiel, wenn alle diese Techniken kombiniert werden. Fußball-Rastellis sind in der Lage, den Ball gleich Jongleuren, denen man die Arme gefesselt hat, wie an unsichtbaren Schnüren gezogen stundenlang über ihren Körper wandern zu lassen, ohne dass er zwischendurch auch nur ein einziges Mal den Boden berührt. Stehend, laufend, sitzend und liegend versetzen sie ihm mit den Füßen, den Oberschenkeln, der Brust, den Schultern, dem Kopf, dem Nacken und sogar dem verlängerten Rücken so genaue Stöße, dass sie ihn immer wieder mit einem anderen Körperteil annehmen und in der Luft halten können.
Besonders erstaunlich war der Engländer George Best, der mit gleicher Geschicklichkeit wie mit dem Ball auch „mit den Frauen und den Millionen“ jongliert haben soll, fußballerisch bedeutsamer war jedoch das überragende Talent des Argentiniers Diego Maradona, der seine Ballzaubereien jederzeit sinnvoll in das Spiel seiner Mannschaft einzubauen wusste. Ihm gleichzustellen ist wohl nur der Brasilianer Pelé, der einmal – im Endspiel der WM 1958 gegen Schweden – folgendes Kunststück vollbrachte: Mit dem Rücken zum Tor stehend stoppte er einen hoch einfliegenden Ball mit dem Oberschenkel derart sanft, dass er dort einen kurzen Moment lang wie tot liegen blieb; dann ließ er ihn wie einen Wassertropfen über das Schienbein zum Fuß hinuntergleiten, lupfte ihn sich selbst und einem heranstürmenden Gegner über den Kopf, drehte sich im selben Augenblick um und schoss, noch ehe der Ball den Boden wieder berührt hatte – ins Tor!
Solche Aktionen wären unmöglich, wenn es beim Fußball darauf ankäme, den Körper statt den Ball zu „spielen“. Während das Spielprinzip beim American- und beim Rugby-Football auf dem „körperlichen Kontakt“ beruht, ist der Fußball insofern ein „körperloses“ Spiel, als die Berührung des Balles und nicht die des Gegners im Vordergrund steht. Da es verboten ist, den Körper des Gegners ohne Ball direkt anzugehen, muss er versuchen, den Gegner mit dem Ball auszuspielen. Weil er gleichsam nur „im Dienste des Balles“ eingesetzt werden darf, steht der Körper nicht im Mittelpunkt der Aktionen. Im Angriff geht es nicht darum, durch Wegdrücken des Gegners eine Bresche in die Abwehr zu schlagen, vielmehr muss der Ball durch körperliche Geschicklichkeit und ebenso geschickte Körpertäuschungen am Gegner vorbeilanciert werden. Der Fußball ist also schon vom Ansatz her gewaltloser als die mit ihm verwandten Football-Spiele. Und je mehr „körperlose“ Technik ein Fußballspieler in Anwendung bringen kann, desto weniger ist er auf Körperkraft und Gewalt angewiesen, um sich durchsetzen zu können.
Genau an diesem Punkt setzt die Kunst des Dribblings an. Der Begriff Dribbling bezeichnet das kontrollierte Führen des Balles am Fuß. Ein erfolgreiches Vorbeidribbeln am Gegner gelingt aber nur dann, wenn die sichere Führung des Balles kombiniert wird mit einer gleichzeitigen Körpertäuschung. Zuerst muss der Gegner in eine Bewegung hineingerissen werden, die ins Leere läuft, dann kann der Ball so gespielt werden, dass er keine Chance mehr hat, ihn zu erreichen. Der berühmte Matthews-Trick besteht nur aus der banalen, aber wirkungsvollen Finte „links antäuschen, rechts gehen“: Während der Abwehrspieler noch auf die Ausfallbewegung nach links reagierte, war Matthews schon vorbeigezogen. Über Matthews hieß es, dass er „wendig wie ein Affe“ gewesen sei, seinem brasilianischen Pendant Garrincha wurde „katzenhafte Geschmeidigkeit“ bescheinigt.
Andere Brasilianer haben die Techniken, mit denen der Gegner in die falsche Richtung gelockt und damit düpiert werden kann, heute noch perfektioniert. Beim „Ronaldo-Samba“ wird der Fuß von außen nach innen über den rollenden Ball geführt und der Oberkörper mit in diese Richtung verlagert, dann aber in die entgegengesetzte Richtung weggedribbelt. Der „Ronaldinho-Trick“ besteht darin, aus dem Dribbling heraus den Ball mit der Fußaußenseite in einer abrupten Bewegung aus dem Fuß- und Kniegelenk kurz nach außen anzuspielen, um ihn dann in einer raschen Gegenbewegung mit der Innenseite des gleichen Fußes direkt nach innen „wegzukappen“. Trotz solcher Tricks gilt neuerdings der Nachwuchsstar Robinho als „König des Dribblings“. Er brilliert vor allem mit rasend schnell vorgetragenen „Übersteigern“ am Fließband: Er tritt mit einem Fuß über den Ball, täuscht mit dem anderen eine Bewegung in entgegengesetzter Richtung an – und wiederholt das so oft, bis der Gegner Knoten in den Beinen hat.
Ein Matthews und ein Garrincha hätten im heutigen Tempo-Fußball trotz aller Wendigkeit wohl kaum eine Chance mehr. Heute muss alles viel schneller passieren, und so haben einige Spieler – der Nordire Ryan Giggs etwa, der Niederländer Arjen Robben oder der Portugiese Cristiano Ronaldo – Sprint und Dribbling zum „Tempodribbling“ kombiniert. In seiner geradezu aristokratischen Eleganz bis heute unerreicht ist freilich Franz Beckenbauer. Hans Blickensdörfer bewunderte die „Harmonie der sparsamen Bewegung“ in seinen Dribblings: „Ihm genügte schon die Andeutung einer Körperfinte, um den Gegner leer laufen zu lassen, und es ist eines seiner Geheimnisse gewesen, schon mit der nächsten aufzuwarten, ehe sich der Gegner wieder gefangen hatte.“ Die Beckenbauer oft bescheinigte „Arroganz“ beruhte vor allem auf dieser Fähigkeit, mit nur hingehauchten Bewegungen scheinbar mühelos alle Gegner abzuschütteln. Der fußballkundige Philosoph Heidegger, ein Fan des „genialen Spielers“ Beckenbauer, prägte für diese beispiellose Kombination von gefühlvoller Ballbehandlung und Körperbeherrschung den Begriff der „Unverwundbarkeit“ im Zweikampf.
Während man das „körperlose“ Spiel mit dem Ball allenthalben rühmt, wird der „körperlose“ Angriff auf den Ball nur äußerst selten einmal gewürdigt. Im Gegenteil: Seit 1993 die „Grätsche von hinten“ verboten ist, geriet jedes Tackling derart in den Ruf der Brutalität, dass auf den Fußballplätzen die Kunst des feinen „Gleitangriffs“ („sliding tackling“) kaum mehr zu sehen ist. Fest steht aber, dass auch die geschickte und das Bein des Gegners schonende Eroberung des Balles zur hohen Schule des Spiels zählt. Gemeint ist hier nicht die in Werner Liebrich – Stopper bei der WM 1954 – Gestalt gewordene rohe „Herberger-Grätsche“, sondern die Fähigkeit, dem Gegner den Ball „vom Fuß zu spitzeln“, ohne dabei ein Foul zu begehen. Einer wie der enorm faire Per Mertesacker löst heute das, was früher vor allem von den Engländern mit rassigen Gleitangriffen bewältigt wurde, mit einem überragenden Stellungsspiel. An seinem Beispiel lässt sich festmachen, dass die Antizipation des Geschehens – und damit das Erwarten des Gegners an dem Ort, wo er im nächsten Moment sein wird – das gut getimte Hineinrutschen weitgehend überflüssig machen kann.
Erfahrenen Trainern war schon immer klar: Das Gewinnen von Zweikämpfen im Fußball ist äußerst wichtig. „Denn der gewonnene Zweikampf“, so der Fußball-Nestor Hennes Weisweiler, „entscheidet über Ballbesitz, und nur mit dem Ball erreichen wir das gegnerische Tor.“ Konnte man früher allerdings nur vermuten, dass der Ausgang bestimmter Zweikämpfe über Sieg und Niederlage entscheidet – beispielsweise gilt für den Titelgewinn der deutschen Mannschaft bei der WM 1974 als ausschlaggebend, dass der Manndecker Vogts in der Auseinandersetzung mit dem holländischen Spielmacher Cruyff die Oberhand behielt –, so weiß man spätestens seit einigen nach der WM 1990 angestellten Analysen Genaueres: Nicht bestimmte Zweikämpfe, auch nicht die Härte der Zweikämpfe, sondern in der Anzahl der fair gewonnenen Zweikämpfe liegt der Schlüssel zum fußballerischen Erfolg.
Besonders signifikant ist die Analyse zweier Länderspiele zwischen der BRD und Holland. Bei der EM 1988 kassierten die Holländer in der 53. Minute das 0:1. In der Folgezeit waren sie ständig in der Offensive, begingen 30 Minuten lang kein Foul, gewannen zwei Drittel aller Zweikämpfe und schließlich auch das Spiel mit 2:1. Einen ganz anderen Verlauf nahm das Achtelfinalspiel bei der WM 1990 in Italien. Zwar ging die Beckenbauer-Equipe auch hier kurz nach der Halbzeit in Führung (50. Minute), anschließend aber waren die Holländer nicht mehr in der Lage, die Partie mit fairen Mitteln umzubiegen. Sie begingen bis Spielende zwölf Fouls, die fair spielenden Deutschen aber gewannen diesmal mehr als zwei Drittel aller Zweikämpfe, wobei sich der herausragende Klinsmann besonders hervortat. Die Holländer verloren das Spiel, die Deutschen wurden Weltmeister.
Dass die Ergebnisse in diesen Spielen keineswegs zufällig waren, lässt sich eindrucksvoll bestätigen. 1990 hatten die Deutschen in sämtlichen Spielen in der Regel fair gespielt und sich als die mit Abstand zweikampfstärkste Mannschaft erwiesen, wobei sich Guido („Diego“) Buchwald, der fast 70 Prozent seiner Zweikämpfe gewinnen konnte, besonders hervorgetan hatte. Diese Buchwald-Quote erreichte bei der WM 1994 in den USA die gesamte Defensivabteilung der Brasilianer. Folglich wurde Brasilien Weltmeister, und die Deutschen, die mit weniger als 60 Prozent gewonnener Abwehr-Zweikämpfe in dieser Sparte den drittletzten Platz besetzten, schieden im Viertelfinale gegen Bulgarien aus. In der Regel ist beim Fußball weder mit „laschem“ noch mit übertriebenem und brutalem Zweikampfverhalten ein Blumentopf zu gewinnen. Von Fußballspielern, die Erfolg haben wollen, wird ein hohes Maß an Selbstdisziplin und Aggressionskontrolle verlangt, und dies ist wohl – nebenbei bemerkt – auch mit ein Grund dafür, dass er, beispielsweise im Vergleich zum American Football, eine relativ ungefährliche Sportart ist.
Weil die Fähigkeit, den Ball anzugreifen oder zu verteidigen, und nicht die Körperkraft entscheidend ist, können im Zweikampf auch Spieler bestehen, die alles andere als Hünen sind (Beispiel Berti Vogts). Weil der Ball und nicht der Körper im Fußball die Hauptrolle spielt, müssen Fußballer grundsätzlich keine besonderen körperlichen Voraussetzungen mitbringen, um sich in diesem Spiel durchsetzen zu können. Große und Kleine, Schwere und Leichte, Kräftige und Schwächliche, Schnelle und eher Langsame – beim Fußball haben alle eine Chance, sich durchzusetzen. Nicht so beim Football und beim Rugby. Hier werden die körperlich Untauglichen vom Spiel ausgeschlossen, und der Rest wird nach den Merkmalen seiner Körperstatur sortiert. Die Bedeutung der Körperstatur für die Funktion eines Spielers innerhalb der Mannschaft lässt sich besonders gut beim Rugby ablesen, weil hier – anders als beim Football – auf eine „Panzerung“ der Spieler verzichtet wird: Die Pfeiler, die für die Eroberung hart umkämpfter Bälle zuständig sind, sind kräftig und untersetzt; die Flügelstürmer, die den Ball im Sprint nach vorne tragen sollen, sind besonders athletisch; die Zweite-Reihe-Stürmer, die ein Gedränge von hinten stabilisieren müssen, sind außerordentlich groß und schwer; der Gedrängehalb dagegen, der die Rolle eines Spielmachers und beweglichen Ballverteilers auszufüllen hat, ist meist auffallend klein und schmächtig.
Sicherlich gilt auch für den Fußball, dass bestimmte körperliche Merkmale im Spiel Vorteile bringen. So ist ein riesenhafter Mittelstürmer gegenüber einem zwergenhaften Abwehrspieler beim Kopfball sicher immer begünstigt. Dies schließt aber nicht aus, dass ein relativ kleiner Spieler wie Karl-Heinz Riedle aufgrund seiner enormen Sprungkraft zum weltweit gefährlichsten Kopfballspieler werden konnte. Die körperlichen Anforderungen, die an einen Fußballspieler gestellt werden, lassen sich also nicht so ohne weiteres in Zentimetern und Gramm ausdrücken. Fußballspieler sind im Durchschnitt wesentlich kleiner und leichter als Rugby- und Footballspieler. Mächtige Erscheinungen wie der Tscheche Jan Koller (2,02 Meter, 103 Kilogramm) sind auf Fußballplätzen eine große Ausnahme, die meisten Offensivkräfte von Klasseniveau sind eher schmächtig und klein.
Robinho, der dem großen Pelé nacheifernde brasilianische Wunderknabe, bringt es bei 1,72 Meter gerade mal auf 60 Kilogramm. Der Durchschnittskicker „Peter Müller“, den der „Kicker“ zum 40. Geburtstag der Bundesliga aus seiner Datenbank ermittelte, ist 1,81 Meter groß und wiegt 77 Kilogramm. Auch Sekunden- und Ausdauerwerte sind nicht unbedingt ausschlaggebend. Zwar gibt es Sprinter, die 100 Meter unter elf Sekunden zurücklegen und Spitzengeschwindigkeiten von 34 km/h erreichen, doch meistens sind solche Leichtathleten schlechte Techniker – von Ausnahmen wie dem Russen Oleg Blochin und dem Brasilianer Roberto Carlos einmal abgesehen. Und selbst wenn im modernen Spiel immer mehr gelaufen werden muss und das Messen der Laktatwerte zum Trainingsalltag gehört, sind dem Bestreben, nur mit überlegener Fitness den Erfolg zu suchen, natürliche Grenzen gesetzt. Da heute alle Topspieler gleichermaßen fit sind, hat der Satz des Altbundestrainers Sepp Herberger, dass die Kondition „nur das Gespann vor den spielerischen Möglichkeiten“ ist, immer noch nichts von seiner Gültigkeit verloren.
Was Gewicht und Größe angeht, ist der Fußball durch und durch demokratisch. Nicht einmal die Schuhgröße hat eine Bedeutung für das balltechnische Vermögen eines Spielers: Jan Koller stoppt den Ball gekonnt mit grotesken Riesenschlappen (Schuhgröße 50), Günter Netzer kam auf großem Fuß (Größe 46 2/3) aus der Tiefe des Raumes, Pelé (Größe 38) und Lothar Matthäus (Größe 40) brachten es in Knaben-Schühchen zu fußballerischem Ruhm. Ein Fußballspieler muss in erster Linie eine feine Koordination seiner Bewegungen und eine Menge Ballgefühl mitbringen. Bestimmte körperliche Eigenheiten können dabei eine Hilfestellung sein, sind aber keine Voraussetzung für fußballerischen Erfolg. Pelés Vater soll nach der Geburt seines Sohnes gesagt haben: „Ja, das wird einen guten Fußballer abgeben. Die Beine dafür hat er.“ Möglicherweise hat er an den Beinen des kleinen Pelé tatsächlich irgendetwas Besonderes entdeckt. Garrincha etwa, der beim Dribbling manchem Gegenspieler ein X für ein O vormachte, profitierte auf dem Fußballplatz von seinen körperlichen Besonderheiten: Sein längeres rechtes Bein war nach innen gebogen, das kürzere linke nach außen.
Die meisten Fußballexperten sind sich auch darüber einig, dass kleine Spieler mit außergewöhnlich tiefliegendem Körperschwerpunkt besonders wendig sind. Eben jener Garrincha sowie der wohl treffsicherste Torschütze aller Zeiten, Gerd Müller, waren mit diesem Merkmal ausgezeichnet. Statistisch belegt ist ebenso, dass linksfüßige Spieler – vermutlich aufgrund taktischer und motorischer Vorteile in einem normalerweise „rechtslastigen“ Spiel – bessere Schützen sind als rechts-füßige. Alle weiteren Mutmaßungen jedoch, die über die Bedeutung des Sonderwuchses bei großen Fußballspielern angestellt wurden, müssen wohl ins Reich der Fabel verwiesen werden: so etwa die sportjournalistische These, dass sich die Akkuratesse der Beckenbauer’schen Ballbehandlung unmittelbar aus der Länge und der Konstellation seiner „an Finger erinnernden Zehen“ herleiten ließe, oder die Vorstellung, dass die Genialität der Pässe Netzers auf dessen großem Fuß beruhe, weil erst der es ihm ermöglicht habe, dem durch einen Spannstoß bereits auf die Reise geschickten Ball kurz vor dem Abheben mit der großen Zehe noch den entscheidenden „Schlenker“ mitzugeben.
Der Fußballspieler benötigt also kaum körperliche Voraussetzungen, dafür umso mehr körperliche Begabung, die in ihrer höchsten Form zirkusreifer Artistik in nichts nachsteht. Es ist beim Fußball daher möglich, fast körperlos und allein zur Freude und zur Erholung zu spielen. Beim Football und beim Rugby, die von der Spielidee her junge, starke und furchtlose Spezialisten erfordern, die bereit und fähig sind zu hartem und gefährlichem körperlichem Einsatz, wäre das undenkbar. Der Fußball hingegen ist ein relativ ungefährliches Spiel mit vielen „körperlosen“ Momenten des virtuosen Jonglierens. Zugleich ist er aber nicht derart harmlos, dass jede Möglichkeit, „körperbetont“ zu spielen, herausgenommen wäre. Die Spieler treffen immer wieder mit ihren Körpern aufeinander, und die Grenzen zwischen Foulspiel und regulärem Körpereinsatz (Schieben mit angelegtem Arm, Sperren des Balles) sind nicht immer klar gezogen.
Der Fußball bietet daher beides: ästhetischen Genuss genauso wie packende Momente des harten Zweikampfs. Weil immer unmittelbar um den Ball gekämpft wird und die Mannschaften nicht durch ein Netz getrennt sind, bleibt er trotz aller möglichen Artistik immer ein Kampfspiel. Genau das, den Kampfcharakter, könne und dürfe man dem „englischen Spiel“ nicht nehmen, wenn es die Menschen auch in Zukunft begeistern solle, meinte der Fußball-Historiker William Pickford schon im Jahr 1906: „Wenn man den Geist der Angelsachsen vom Nationalcharakter abziehen und durch die Milde und Geduld der Hindus ersetzen würde, wäre es wohl möglich, Fußball auf rein wissenschaftliche Weise zu spielen, mit keinem größeren Risiko als dem, das Spielen wie Tennis und Golf innewohnt. Wenn dieser Tag jedoch gekommen ist, werde ich meinen Stift weggelegt und meine Knochen für ihre letzte Reise gebettet haben, denn dann will ich nicht mehr auf der Welt sein.“