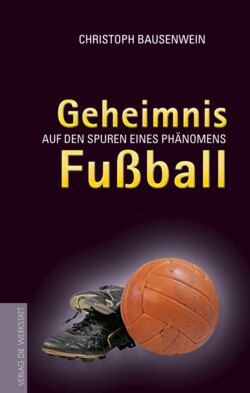Читать книгу Geheimnis Fussball - Christoph Bausenwein - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеREGELN
Der Fußball findet im Stadion seinen Höhepunkt. Aber er wird natürlich nicht nur im Stadion gespielt. Außerdem ist es möglich, auf viele verschiedene Arten und Weisen Fußball zu spielen. Als Kind spielte ich mit meinen Freunden in einer wenig befahrenen Wohnstraße auf ein Garagentor oft „Pensionieren“. Da galt es, den Ball „in der Luft“ einander zuzuspielen, um ihn dann volley aufs Tor zu schießen. Das Schießen ging einigermaßen, nur mit dem Hochhalten hatte ich einige Probleme. Besser war’s auf der „Schäferswiese“, wo die großen Spiele stattfanden. Gleich nebenan lag der Platz des Sportbundes Morgenrot-Mögeldorf, den wir manchmal benutzen durften. Dort traten wir in einheitlichen Trikots mit aus Filz selbst gemachten Wappen als Sportklub Tiergarten (SCT) gegen den Sportverein Mögeldorf (SVM) an. Auch Mädchen spielten mit. Gemein war allerdings, dass wir im Schnitt zwei bis drei Jahre jünger waren als die SVM-Spieler. Wir haben nie gewonnen.
Auch andere haben in ähnlicher Weise in Sackgassen und auf Bolzplätzen begonnen, oder, in sonnenverwöhnten Ländern wie in Brasilien, am Strand. Heute gibt es auch verregelte Varianten dieses „kleinen“ Fußballs. An der berühmten Copacabana in Rio de Janeiro wird der Beach Soccer in Ligen ausgetragen. In Südamerika und Südeuropa findet Futsal, eine von der FIFA geförderte Variante des mit Teams zu je fünf Spielern betriebenen Hallenfußballs, eine immer größere Verbreitung. Die brasilianischen Rororo-Stars – Ronaldo, Ronaldinho, Robinho – haben sich ihr hervorragendes balltechnisches Können allesamt bei diesem Kleinfeld-Fußball angeeignet. Wie beim Beach Soccer gibt es auch beim Futsal eine weltweite Wettbewerbsstruktur mit Ligen und Weltmeisterschaftsturnieren. Sogar eine seltsame Sportart wie der in Finnland sehr beliebte „Swamp Soccer“, bei dem sich die Fußballer durch knietiefe Schlammfelder kämpfen, kennt internationale Turniere.
All diese Fußball-Varianten sind in Deutschland bislang weitgehend unbemerkt geblieben. Schlammfußball ist sowieso eher ein Partygag, Sandstrände gibt es in Deutschland kaum, und Hallenfußball, die nordeuropäische Variante des meist auf Betonböden betriebenen Futsal, ist in Europa bis heute als Aktiven- wie als Zuschauersport nicht mehr als eine eher ungeliebte Ausweichmöglichkeit für den Winter. Einige wenige haben – so wie der ehemalige deutsche Rekordnationalspieler Herbert Erhard – das Fußballtennis als Ausgleichs- und Alterssport entdeckt, und im Training der Fußballvereine werden alle möglichen Spielvarianten ausprobiert. Grundsätzlich aber meint man, wenn man vom Fußball spricht, immer das „große“ Spiel. Bis jetzt jedenfalls ist kaum vorstellbar, dass irgendwo auf der Welt jemand nicht wüsste, welches Spiel bei einer „Fußball-Weltmeisterschaft“ betrieben wird.
Trotz einer mittlerweile sehr großen Auswahl an unterschiedlichen Fußballspielen hat nur eines den ganz großen Erfolg. In der Politik sind sich die Menschen uneinig und wählen Parteien unterschiedlicher Couleur, aber in ihrer Freizeit herrscht seltene Einigkeit in der Wahl. Fast alle, die vor dem Fernseher Fußball gucken oder öfter ins Stadion gehen, haben irgendwann auch mal selbst gegen einen Ball getreten. Die Liste der ehemaligen Kicker reicht vom einfachen Mann auf der Straße bis hin zum Regierungschef. Ex-Kanzler Gerhard Schröder pflügte beim Bezirksligisten TuS Talle als „Acker“ den Rasen um, Edmund Stoiber kickte ebenfalls im Verein, wenn auch nur, in Wolfratshausen, in der zweiten Mannschaft. Und Ex-Außenminister Joschka Fischer erreichte nachgerade Berühmtheit als Mittelstürmer einer Szene-Mannschaft, die regelmäßig im Frankfurter Ostpark kickte. Selbst als Minister in Berlin ließ er es sich nicht nehmen, ab und an nach Frankfurt zu fliegen, um mit alten Sportskameraden wie Daniel Cohn-Bendit den gepflegten Flachpass zu üben. Aufgegeben hat er die Passion erst, als es wegen der mitgebrachten Leibwächter, die ihren Schutzauftrag auch auf dem Platz erfüllen wollten, zu Irritationen gekommen war. Den Frankfurter Ostpark-Kickern ähnliche Vereinigungen gab es – und gibt es bis heute – in zahllosen anderen Städten Deutschlands. Statt in den als „konservativ“ verschrienen Vereinen kickten die Linken und Grünen in „Bunten Ligen“. Überall wurde in phantasievoll benannten Teams – mit internationalem („Hinter Mailand“, „Fellatio Rom“), traditionellem („Herbergers Jünger“), oder, in Nürnberg/Fürth, mit lokalem Hintergrund („Schießbefehl Stadtgrenze“) – stümperhaft gekickt, unbeholfen gefoult und lautstark geflucht.
Heute sind die meisten Protagonisten von damals wegen Altersschäden – Arthrose, lädierten Bandscheiben und Ähnlichem – vom aktiven Spielbetrieb zurückgetreten. Geblieben ist das Spiel und damit für alle Jüngeren und körperlich Unversehrten die Möglichkeit, im Verein oder in freier Vereinigung nach den Gesetzen der FIFA einem Ball hinterherzurennen. Die 17 Regeln des Fußball-Weltverbandes sind so einfach wie eh und je und gelten immer noch, trotz der zahlreichen neuerdings entstandenen Fußball-Varianten, als „Bibel“ des Fußballspiels. Sie definieren die formalen Voraussetzungen des Spiels (Anzahl der Spieler, Ausrüstung, Spielfeld, Spielzeit), legen die Entscheidungsfindung fest (Torerfolg) und regeln die Durchführungsbestimmungen bei Spielunterbrechungen. Sie schreiben lediglich den Rahmen des Spiels vor und haben – mit Ausnahme der Regel XI (Abseits) – keinen unmittelbaren Einfluss auf seinen Ablauf. Um nachvollziehen zu können, was auf einem Fußballplatz geschieht, ist es nicht nötig, diese Regeln auswendig zu lernen; es genügt, wenn man sich drei Dinge klarmacht: die Idee des Spiels, die Funktion der so genannten „Standardsituationen“ und die Rolle der Abseitsregel.
Ausgangspunkt ist die Grundidee eines frei fließenden Spiels zwischen zwei Mannschaften, die unter Verzicht auf den Gebrauch der Hände versuchen, den Ball im Tor des Gegners unterzubringen; durch die Standardsituationen wie Einwurf, Eckstoß und Freistoß muss lediglich sichergestellt werden, dass das Spiel nach Unterbrechungen auf die einfachst mögliche Weise fortgesetzt werden kann; die Abseitsregel schließlich – ein Spieler darf sich den Ball in der gegnerischen Hälfte nur dann zuspielen lassen, wenn sich im Augenblick des Abspiels zwischen ihm und dem gegnerischen Tor noch wenigstens zwei Spieler des Gegners befinden – zwingt die Akteure zu einem geordneten Verhalten auf dem Feld und sorgt gleichzeitig dafür, dass ein Torerfolg nur mit spielerischer Intelligenz erzielt werden kann.
Wie sich zeigt, sind die Regeln des Fußballspiels so einfach und leicht verständlich, dass noch der Dümmste sein Prinzip kapieren kann. „Fußball selbst ist ja geradezu primitiv: Tore verhüten, Tore schießen, das ist alles“, so der als Intellektueller verschriene Fußballtrainer Dettmar Cramer. Kompliziert scheint allein die Abseitsregel zu sein. Darum sei – in den Worten des Ex-Profis Stefan Lottermann – für etwaige Laien unter der Leserschaft noch etwas ausführlicher erläutert, warum sie für das geregelte Spiel auf genormtem Platz so bedeutsam ist: „Die Abseitsregel verhindert ein Spielverhalten analog zu Spielen wie zum Beispiel Handball und Basketball, die eine solche Bestimmung nicht kennen. In diesen Sportspielen läuft das Spielgeschehen vornehmlich vor dem Tor bzw. unter dem Korb ab, der Raum dazwischen ist ohne größere strategisch-taktische Bedeutung. Im Fußball ist es gerade der große Aktionsraum zwischen den beiden Toren, der eine erhebliche strategisch-taktische Dimension innehat. Durch die Abseitsregel ist es den Spielakteuren nicht möglich, sich unabhängig von der Position der Gegenspieler auf dem Spielfeld zu bewegen, zu verteilen und einen bestimmten Spielfeldabschnitt anzusteuern oder besetzt zu halten, außer man befindet sich in der eigenen Spielhälfte, in der die Abseitsstellung aufgehoben ist.“
Fußball ist ein simples Spiel. Die Abseitsregel ist zwar etwas komplexer, aber auch diese versteht auf der ganzen Welt jeder einigermaßen normal begabte Mensch. „Kehrte Robinson Crusoe zurück“, so schrieb der Rhetorik-Professor Walter Jens, „er könnte seinem Gefährten die englische Sprache am Beispiel der Abseitsregel erklären. Undenkbar, dass Freitag nicht wüsste, was ‚auf gleicher Höhe’ bedeutet!“ Wer selbst gespielt hat, versteht sie sowieso. Denn man weiß bei jedem Angriff, dass man nicht ungeordnet vorgehen kann. Viel hängt beim Fußball auch von spontanen Einfällen ab, aber durch die Abseitsregel kommt ein Moment hinein, das den Spielern eine Planung ihres Vorgehens zwingend abverlangt. Vielleicht verschafft dem Fußball ja bereits diese in den Regeln angelegte Dialektik von Plan und Spontaneität einen Großteil jener Faszination, die ihn zum einzigen auf der ganzen Welt gültigen Zeichensystem machte. Weder die genannten Abarten des Fußballs noch andere Ballsportarten haben auch nur ansatzweise jene Popularität erreicht, der sich bis heute der „richtige“ Fußball erfreut.
Daran, dass der Fußball unkompliziert ist und unter minimalsten Voraussetzungen gespielt werden kann, besteht demnach kein Zweifel. Ein ganz anderes Bild bieten da Rugby und American Football, die sich vom Fußball nicht nur durch einen wesentlich geringeren Anteil des Spiels mit dem Fuß, sondern vor allem durch die enorme Komplexität der Regeln und der damit zusammenhängenden voraussetzungsvollen Spielbedingungen unterscheiden. So nimmt in einem Regelbuch über Rugby allein die Beschreibung des Gedränges („scrummage“) vier Seiten ein, und zur Regelung des Abseits heißt es: „Wollte man alle Möglichkeiten aufzählen, die es gibt, um im Rugby abseits zu sein, bräuchte man gewiss mehr Seiten, als dieses Buch umfasst“ (was dann offensichtlich heißt: mehr als 120). Noch komplexer sind die Verhältnisse beim American Football, bei dem der Aktive so viele Regeln kennen und beachten muss wie bei keiner anderen Sportart. Dies allein macht schon deutlich, dass das Grundprinzip beider Sportarten nur unter zahlreichen Bedingungen zum Tragen kommen kann. Rugby und Football können nur auf einem großen und entsprechend genormten Feld gespielt werden, eine bestimmte Anzahl von Spielern ist notwendig, damit die für das Spiel notwendigen Funktionen auch ausgefüllt werden können, schließlich sind beide Spiele an besondere physische Voraussetzungen (Schwere, Kraft, Schnelligkeit) gebunden, und zuletzt sind sie auch noch so gefährlich, dass sie kaum zu einem erholsamen Freizeitsport taugen.
Da Rugby und Football um so viel komplizierter und anspruchsvoller sind als Fußball, werden sie auch von vergleichsweise wenigen Menschen aktiv ausgeübt. Völlig erfolglos sind sie deswegen freilich noch nicht. Gerade die Gefahr, die Unmittelbarkeit der kämpferischen Auseinandersetzung, macht wohl viel von dem „Thrill“ aus, der sie unter den besonderen Bedingungen der angloamerikanischen Länder zu vielbeachteten Zuschauersportarten hat werden lassen. Die Komplexität der Regeln eines Sports schließt demnach einen Erfolg beim Sportpublikum nicht aus, begrenzt ihn aber offensichtlich in der geografischen und sozialen Wirkungsbreite. Der geradezu grenzenlose Erfolg des Stadion- und insbesondere des Fernsehfußballs hängt also vermutlich davon ab, dass die Zuschauer jedes Spiel, das sie sehen, „im Prinzip“ auch selbst spielen können. So groß die Kluft zwischen Anfängern, Durchschnittsspielern und Könnern auch sein mag – die Distanz bleibt immer so gering, dass jeder noch so unbegabte Hobbyspieler unmittelbar nachvollziehen kann, was die Stars auf dem Rasen im Stadion zelebrieren. So groß der Unterschied zwischen Profi und Freizeitkicker hinsichtlich Athletik, Kondition, taktischer Disziplin, Schusskraft und technischer Perfektion auch sein mag – die besonderen „Gesetze“ des Fußballs sorgen dafür, dass beide immer einander nahe bleiben. Sogar den berühmtesten Spielern unterlaufen zuweilen anfängerhafte Fehler, während andererseits selbst der ungeschicktesten Altherrenmannschaft hin und wieder ein nahezu perfekter Spielzug gelingt. Deshalb dürfen die „Experten“ im Stadion oftmals nicht ganz zu Unrecht bemerken, dass sie vieles von dem, was da passiert „auch noch gekonnt hätten“.
Es scheint also durchaus berechtigt, wenn alle Kenner des Fußballs den Erfolg des Spiels damit begründen, dass es in jeder Hinsicht extrem „einfach“ sei – einfach zu verstehen, einfach zu spielen, einfach nachzuvollziehen. „Das ‚Geheimnis‘ um den Fußballsport“, so beispielsweise der DFB-Historiker Carl Koppehel, „ist leicht gelüftet. Fußball ist ein im Grunde sehr einfaches Spiel und in der Ausübung billig. Es ist leicht verständlich, die Spielregeln sind frei von erschwerenden Vorschriften, die Wertung ist unkompliziert.“ Wäre diese Feststellung ausreichend, wäre der Fußball also tatsächlich nur „herrlich einfach“ und schon allein deshalb „einfach herrlich“, dann könnte man sich jede weitere Ausführung sparen und diese Abhandlung sofort beenden – das Massenphänomen Fußball wäre erklärt. Bereits eine kurze Überlegung zeigt freilich, dass der schlichte Hinweis auf die Simplizität des Spiels viel zu simpel ist. Läge in der Einfachheit das einzige „Geheimnis“ des Fußballs, müsste man im Umkehrschluss folgern, dass sämtliche anderen Sportarten allein deswegen weniger Erfolg hatten und haben, weil sie komplizierter bzw. voraussetzungsvoller sind als der Fußball. Das mag im Fall von Football und Rugby richtig sein, auf viele andere – ja sogar die meisten – Ballsportarten trifft es aber nicht zu.
Nichts berechtigt beispielsweise zu der Annahme, dass das Handballspiel (sofern es im Freien gespielt wird) „im Prinzip“ mehr Voraussetzungen benötigt als das Fußballspiel; um Basketball zu spielen, braucht man zwar ein paar Voraussetzungen mehr (der Ball muss extrem sprungkräftig und der Boden muss hart sein), trotzdem kam diese Sportart anfangs mit nur 13 Regeln aus; auch beim Volleyball genügt ein leichter Ball und eine zwischen zwei Stangen gespannte Schnur, um mit dem Spiel beginnen zu können. Das Argument der Einfachheit kann also allenfalls erklären, dass sich der Fußball so schnell und so leicht verbreiten konnte, nicht aber, dass ausgerechnet er und er allein zu einem Massenphänomen wurde. Wer das Geheimnis des Fußballs lüften will, muss also schon etwas größere Begründungs-Anstrengungen auf sich nehmen. Sein Erfolg beruht allem Anschein nach auf Eigenschaften, die nicht so einfach zu erklären sind. Das Spiel muss irgendetwas an sich haben, was es „unvergleichlich“ macht – sonst wäre der Reiz, den es auf Millionen, ja Milliarden von Menschen ausübt, nicht zu erklären.
Während andere Spiele offensichtlich nur komplex oder nur einfach sind und nur für Zuschauer oder nur für aktive Spieler Reize besitzen, scheint beim Fußball ein schlichter Anlass so komplexe Wirkungen nach sich zu ziehen, dass das Spiel vielfältigsten Ansprüchen zu genügen vermag. Um dem Phänomen Fußball auf die Spur zu kommen, genügt es also nicht, nur die Regeln zu kennen. Man muss den Kern des Spiels in den Blick nehmen.
Zunächst und vor allem ist es der scheinbar primitive Vorgang des Tretens, der eine überraschende Vielfalt der Spielmöglichkeiten entfaltet. Der Fußball und seine Varianten wie Futsal sind die einzigen Spiele, bei denen das Bewegen des Balles mit dem Fuß zur Regel gemacht wird. Selbst diejenigen Spiele, die „Football“ genannt werden (American Football, Rugby Football), sind ja im Grunde genommen eher Handballspiele, denn auch bei ihnen basiert der Ablauf des Spiels auf dem Tragen, Werfen und Fangen des Balles. Es scheint von daher nicht nur ein bloßer Zufall zu sein, dass all die Ballspiele, bei denen der Ball mit der Hand oder durch deren Verlängerung – mit einem Schläger – in Bewegung gesetzt wird, einen weitaus geringeren bzw. nur regional bedeutsamen Erfolg haben. Wäre dieser einzigartige „Fuß-Fall“ der Ballspiele nur eine Angelegenheit weniger Sonderlinge, die tun, was sonst verboten ist, und die Nein sagen zu allem, was normalerweise erlaubt ist, so wäre das Ganze wohl kaum einer Erwähnung wert. Tatsache aber ist, dass der Fußball den anderen Ballspielen nicht nur den Ball, sondern ganz offensichtlich auch die Gesetze des Erfolgs aus der Hand genommen hat. Und da international nicht irgendein Fußball erfolgreich ist, sondern der nach den FIFA-Regeln betriebene, liegt die Vermutung auf der Hand, dass dieser auf Regeln fußt, die – um das Wortspiel zu Ende zu bringen – „Hand und Fuß“ haben.
Verzichtet man darauf, ein Spiel unter den genormten Bedingungen eines offiziellen Wettkampfs auszutragen, so braucht man nicht einmal die FIFA-Regeln zu kennen. Ein Fußballspiel kommt bereits zustande, wenn man lediglich die zwei Grundverbote beachtet: das Verbot des Handspiels (mit Ausnahme des Torwarts) und das Verbot des Foulspiels (getreten werden darf nur der Ball, nicht der Gegner). Wird nur zum Spaß gespielt, so reduzieren sich die Voraussetzungen des Fußballspiels nahezu auf null. An materiellen Bedingungen sind lediglich zwei Mannschaften, ein Spielplatz mit zwei Toren sowie ein Ball erforderlich. Die Anzahl der Spieler ist gleichgültig, man kann auch fünf gegen fünf spielen oder zwölf gegen zwölf, sogar ein Spiel eins gegen eins ist möglich oder eines mit ungerader Teilnehmerzahl, wenn es unterschiedliche Spielerqualitäten auszugleichen gilt. Ein richtiges Spielfeld ist nicht unbedingt nötig, es genügt schon eine holprige Rasenfläche, notfalls auch ein Stück freien Platzes im Hinterhof oder auf einer wenig befahrenen Straße, und wenn der Raum gar zu knapp ist, kann man sogar auf dem Dach kicken – wie in La Valetta (Malta) oder auf Hochhäusern im dicht besiedelten Japan. Als „Ball“ kann zur Not auch eine Blechbüchse oder irgendein anderer unförmiger Gegenstand dienen, sofern sich dieser nur mit den Füßen kicken lässt. Zur Markierung der Tore genügen Schultaschen, ein paar Zweige oder Steine. Das Spiel kostet also so gut wie nichts und kann praktisch unter allen Bedingungen gespielt werden.
Diese materielle Voraussetzungslosigkeit des Fußballs wird noch dadurch ergänzt, dass nicht einmal die Akteure selbst eine besondere physische Konstitution mitbringen müssen. Egal, wie groß, wie stark, wie alt oder wie sportlich jemand ist: Jeder kann prinzipiell mitspielen. Selbst der Verlust eines Arms muss nicht verhindern, im Fußball ein Großer zu werden. Der einarmige Hector Castro, Torschütze beim 4:2 Uruguays im Finale 1930 gegen Argentinien, war einer der besten Stürmer seiner Zeit. Und der bei einem Autounfall versehrte Robert Schlienz, die „einarmige Legende“ des VfB Stuttgart, brachte es zum Deutschen Meister und Nationalspieler. Umgekehrt muss man beim Fußballspiel selbst kaum befürchten, schwerwiegend verletzt zu werden. Denn wird dieser Sport der Grundregel gemäß betrieben, dann wird nur der Ball, nicht aber der Gegner getreten, dann gelten Angriffe nicht dem Körper, sondern werden mit dem Ball am Fuß vorgetragen. Deswegen müssen auch die Eltern keine Angst haben um die Kinder, die draußen auf dem Bolzplatz einem Ball hinterherjagen und dabei die großen Stars des Spiels imitieren.
Einer alten Legende zufolge besteht zwischen den Bolzereien der jugendlichen und den Meisterspielen der erwachsenen Kicker ein unmittelbarer Zusammenhang. Einst haben alle großen Stars ganz unten angefangen: auf den Straßen, in Sackgassen, in Garagen- und Hinterhöfen, auf Wiesen in Parks und auf brachliegenden Flächen in Industriegebieten. Weil dieser „Urfußball“ anscheinend überall der gleiche ist, kann noch jedes Kind, das irgendwo gegen einen Ball tritt, davon träumen, den größten aller Kicker auf ihrem Weg von den dunklen Ecken der Großstädte ins Rampenlicht der Sportarenen nachzufolgen. Pelé genügte eine mit Lumpen und Zeitungspapier ausgestopfte Männersocke, um sich auf den staubigen Straßen des brasilianischen Provinzkaffs Baurù jene Fußballvirtuosität anzueignen, die ihm den Ruhm des größten Kickers aller Zeiten einbrachte. Max Morlock, bester deutscher Torschütze bei der WM 1954, trainierte seine Treffsicherheit als Knabe mit einem aus Stoffresten zusammengefügten „Flecklesball“, den er unentwegt auf die Kellerfenster eines Mietshauses drosch, und neben diesem Sommersport des „Kellerfensterlns“ übte er des Winters seine koordinativen Fähigkeiten auf der zugefrorenen Fläche eines Teiches im „Eisfußball“, der, wie er noch als Weltmeister betonte, „Krone aller Sportarten“.
In den 1980er Jahren setzte hierzulande zunehmend die Kritik ein, dass der Mangel an tauglichen deutschen Kickern in Bundesliga und Nationalteam vor allem auch auf das Aussterben der Straßenfußballer zurückzuführen sei. Da die jungen Spieler zu früh auf dem großen Spielfeld stromlinienförmig auf Kampf, Kondition und Schnelligkeit getrimmt würden, versäumten sie es, sich die notwendige Grundlagen-Technik anzueignen, die man nur auf der Straße lerne. „Als ich mit 13 Jahren zu einem Spitzenverein kam, hatte ich aus täglich sechs Stunden Straßenfußball alle Technik dieser Erde intus“, meinte der Erfolgstrainer Ernst Happel: „Heute kommen Spieler zum Training, die können nicht einmal einen Stuhl umspielen.“ Der Ruhrpott-Kicker Olaf Thon, Mitglied des WM-Kaders von 1990, gilt als letzter Vertreter des klassischen Straßenfußballers aus deutschen Landen. Deutschland wurde Weltmeister, den schönsten Fußball aber spielte ein Team von ehemaligen Straßenfußballern. Mitten in Douala, einer Stadt in Kamerun, gibt es, einer Verkehrsinsel gleich, einen kleinen, holprigen, dreiecksförmigen Bolzplatz, auf dem sechs gegen sechs gespielt wird. Diesem „Spielraum“ wurden magische Kräfte zugeschrieben: Mindestens fünf Spieler der Nationalmannschaft, die in Italien so begeisterte, sollen unter diesen außergewöhnlichen Umständen die Kunst des fintenreichen Dribblings erlernt haben.
Der Straßenfußball prägte auch das französisch-algerische Ballgenie Zidane. In La Castellane, dem Ghetto der maghrebinischen Einwandererfamilien in Marseille, übte er auf einem betonierten Platz all jene Tricks, die ihn später berühmt machen sollten. „Alles, was ich gelernt habe, stammt aus dieser Zeit“, schrieb er in seiner Autobiografie. Derjenige, der einen neuen Trick entdeckt hatte, musste ihn den anderen zeigen. So hatte sich auch der kleine und schmächtige „Yazid“, wie er damals gerufen wurde, viele Tricks ausgedacht und sich gegenüber den anderen eine Menge Respekt verschafft, wenn er zeigen konnte, dass er den Ball besser beherrschte als sie. Auch Turniere gab es auf dem Betonplatz, wie bei einer WM. Nach dem Triumph der Franzosen beim Turnier 1998 musste der frischgebackene Weltstar wieder daran denken: „Als ich den WM-Pokal hochhob, erinnerte ich mich an früher“, so Zidane, an die Trophäe von einst: „Es war nur eine Plastikflasche. Mit Alufolie umwickelt.“
Im selben Bestreben – nämlich aus erträumten Pokalen echte zu machen – sind in Deutschland nach der verkorksten Europameisterschaft 2004 Jürgen Klinsmann und Oliver Bierhoff angetreten. Zu ihrem Erneuerungsprogramm, mit dem sie den deutschen Fußball wieder erstarken lassen wollen, gehört auch die Wiederbelebung des Straßenfußballs. Während der Bundestrainer als Präsident und Gründer der Stiftung Jugendfußball mit dem Projekt „streetfootballworld“ vor allem aus sozialen Gründen den „Fußball von unten“ unterstützen will, geht es dem Teammanager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei seiner Initiative „Bolzplätze für Deutschland“ auch um die konkrete balltechnische Förderung des deutschen Fußball-Nachwuchses. Damit die WM-Stars von morgen auch außerhalb von Schulen und Vereinen gute Trainingsmöglichkeiten erhalten, werden die verhinderten WM-Stars von gestern animiert, Bierkästen eines bekannten Herstellers zu kaufen, der einen Teil des Projektes finanziert. Je mehr Flaschen ausgetrunken werden, so das unausgesprochene Motto, desto weniger Flaschen auf dem Platz würde man später ertragen müssen.
Ob und wann dieses Bier-Hoffnungsprojekt Erfolg haben wird, muss man abwarten. Einige Fragezeichen sind freilich jetzt schon anzubringen. Vor rund 40 Jahren, als der Autor dieser Zeilen seine ersten Kickversuche machte, gab es noch genügend Straßenecken und Bolzplätze, wo er sich die Grundlagen des virtuosen Fußballspiels durchaus hätte erwerben können. Doch leider blieb das Koordinationsvermögen seiner Füße selbst unter – im straßenfußballerischen Sinne – paradiesischen Ausgangsbedingungen derart mager, dass er nicht einmal in seinen Traumphantasien wagte, Weltmeisterliches zu vollbringen. Spaß gemacht aber hat es trotzdem. Und vor allem: Es war immer möglich, mit Freunden gegen einen Ball zu treten. Gerade dieses Einfachheit des Zugangs war und ist auch heute noch – trotz des attestierten Mangels an Bolzplätzen – eines der Ur-Geheimnisse des Fußballspiels.