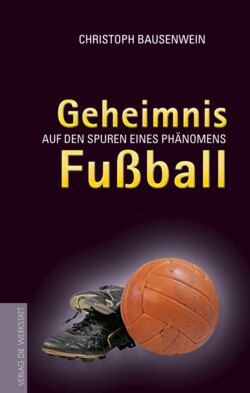Читать книгу Geheimnis Fussball - Christoph Bausenwein - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеRÄUME
Es ist ganz und gar nicht gleichgültig, in welchen klimatischen „Räumen“ Fußball gespielt wird. Im traditionellen englischen Spiel wurde das Leder von robusten Leuten über miserable, völlig durchweichte und mit Pfützen übersäte Spielfelder getrieben. Wenn man den Ball stoppte, war es schwierig, ihn wieder in Bewegung zu bekommen. Das kalte, regnerische Klima mit entsprechend weichen Böden begünstigte daher die Spielweise des Kick-and-Rush: Schneller Raumgewinn schien nur möglich, wenn man den Ball weit nach vorne drosch in der Hoffnung, dass ihn schnelle Außenstürmer erobern und hoch in den Strafraum bringen, wo dann der Stürmer die Sache per Kopf vollenden sollte. Die Engländer gewöhnten sich an das nasse Geläuf so sehr, dass sie auf keinen Fall mehr darauf verzichten wollten.1954 schlugen Stan Cullis’ Wolverhampton Wanderers die Fußballkünstler von Honved Budapest mit einem Trick: Das Spielfeld wurde so lange gewässert, bis es aussah wie eine Viehweide nach einer Woche mit Dauerregen. Die Ungarn gingen mit 2:0 in Führung, waren dann aber völlig erschöpft. Die schlammerprobten Wanderers gewannen noch mit 3:2.
Kurioserweise entwickelten die Schotten, bei denen die Wetterverhältnisse ja ganz ähnlich sind, schon frühzeitig eine andere Spielweise als die Engländer. Gerade bei Nässe seien steil geschlagene Pässe zu unsicher, so die schottische Auffassung, weil der Ball zu schnell und somit für den angespielten Spieler unerreichbar werde; also verlegten sie sich auf das später als „schottischer Stil“ bekannt gewordene Kurzpassspiel. Selbiges pflegten dann auch die Südamerikaner und Südeuropäer. Wärme und die damit verbundene Härte der Böden, so lautet die Begründung für den in südlichen Räumen gepflogenen Stil, stünden Athletik und Tempo entgegen, begünstigten vielmehr eine langsame, schnörkelige, auf versierter Ballkontrolle beruhende Spielweise. Aber so spielten auch die Schalker und Wiener in von der Sonne nicht gerade im Übermaß verwöhnten Räumen … Lassen wir den Boden außer Betracht, nehmen wir einmal einen perfekten Rasen an und wenden wir uns den „idealen Räumen“ des Fußballs zu.
Das Spielfeld, auf dem zwei Fußballmannschaften um den Ballbesitz streiten, ist rechtwinklig, wobei die Länge zur Breite im Verhältnis von 4:3 (durchschnittlich etwa 105 zu 70 Meter) stehen soll. Damit ist es nicht zu groß, um nicht noch sowohl vom Zuschauer wie vom aktiven Spieler als ein geschlossenes Gebilde wahrnehmbar zu sein, gleichzeitig ist es auch nicht so klein, dass ein anspruchsvolles Spiel im Raum verhindert würde. Dies ist zum Beispiel beim Handball der Fall: Weil das kleine Feld schnell überbrückt werden kann, spielt sich hier alles im Wesentlichen nur am Wurfkreis vor den Toren ab. Interessante, weit angelegte und plötzlich herausgespielte räumliche Konstellationen ergeben sich erst, wenn das Feld als Spielraum genutzt wird und also mehr ist als die bloße Entfernung zwischen zwei Kreisen. Das Fußballfeld ist hierfür ideal. Seine Länge ist so abgestimmt, dass ein schneller und blitzartiger Angriff möglich ist, dabei aber jede Verteidigung wenigstens im Prinzip immer eine Chance hat, sich zur Abwehr zu formieren. Seine Breite ist so gewählt, dass die ballführende Mannschaft nicht nur schnell nach vorne stürmen, sondern ihr Spiel auch auf die Seiten hin verzögern oder auf die Flanken verlagern kann. Zugleich ist das Feld aber auch klein genug, so dass die nicht im Ballbesitz befindliche Mannschaft durch geschicktes Vorgehen die Räume verengen und damit ihre Chance erhöhen kann, den Ball zu erobern.
Das Spielfeld selbst ist im Gegensatz zu anderen Sportarten nur wenig strukturiert. Es gibt lediglich die zwei durch eine Mittellinie getrennten Spielhälften, sowie die beiden Räume vor den Toren: den Strafraum (den „16-Meter-Raum“) und den Torraum (den „5-Meter-Raum“). Im Lauf eines Spiels kommt meist nur dem Strafraum eine entscheidende Rolle zu: Er begrenzt einerseits den Bereich, innerhalb dessen der Torwart mit der Hand eingreifen darf, andererseits bildet er diejenige Fläche, auf der die verteidigende Mannschaft besonders vorsichtig zu Werke gehen muss, da hier begangene Regelverstöße mit einem Strafstoß („Elfmeter“) geahndet werden können. Für die Organisation einer Mannschaft spielt er also insofern eine Rolle, als jede Mannschaft in der Defensive versuchen wird, den Angreifer bereits vor dem Strafraum zu stoppen, um keinen Elfmeter zu riskieren. In der Offensive folgt daraus die umgekehrte Taktik: Jeder Stürmer wird auch dann, wenn eine Aktion schon aussichtslos geworden ist, bemüht sein, in den Strafraum einzudringen, um eventuell ein Foulspiel zu provozieren und damit einen Elfmeter „herauszuschinden“.
Die Konstruktion des Fußballfeldes ermöglicht ein weitgehend freies Spiel im und mit dem Raum. Im Vergleich dazu sind beim American Football durch die an einen „Bratrost“ erinnernde Einteilung des Spielfeldes in einzelne Zonen und Abschnitte die Möglichkeiten der Spielzüge und der Verteilung der Spieler im Raum weitgehend vorgegeben. Football ist ein Spiel, bei dem um „Boden gekämpft“ wird. Weil es allein darum geht, Raum in Richtung der gegnerischen Endzone zu gewinnen, wiederholt sich stur derselbe Ablauf: Jede Mannschaft hat vier Versuche, um zehn Meter vorwärts zu kommen; schafft sie es, erhält sie einen weiteren ersten Versuch („First Down“); schafft sie es nicht, darf die gegnerische Mannschaft einen Versuch starten.
Ganz anders ist die Situation beim Fußball. Der Spielraum ist nicht durch die Regeln definiert, sondern er wird erst im Spiel selbst geschaffen. Überdies bestehe das Grundprinzip nicht im Erobern und Verteidigen von Rasenstücken, sondern im Öffnen und Schließen, bzw. Verengen und Erweitern von Spielräumen. Nicht auf das Festkrallen im Rasen, nicht auf Drücken und Schieben kommt es beim Fußball an, sondern auf das „Gefühl für die Lücke“: Man lässt den Gegner „ins Leere“ laufen, spielt den Pass „in die Gasse“, sucht die Lücke im „Riegel“, den die Verteidiger vor dem Strafraum aufbauen.
Die entscheidenden Kraftlinien, von denen das Fußballfeld durchzogen ist, und die Sektoren, in die es gegliedert ist, sind daher nicht auf den Rasen gezeichnet. Man muss auf die Leerräume zwischen den Spielern achten und nicht auf mit Kreide gezogene Linien, um zu erkennen, wie sie eine sinnvolle Verteilung auf dem Feld einnehmen. Jede Mannschaft beginnt ein Spiel mit einer taktischen Grundformation, nach der sich jeder Spieler auf einen bestimmten räumlichen Sektor des Feldes konzentrieren und dort mit den anderen genau abgestimmte Funktionen erfüllen soll. Eine erste Strukturierung des Raumes ist also bereits durch die Voreinstellung der Mannschaften bedingt. Die Verteilung und Staffelung der Spieler in Verteidigung, Mittelfeld und Angriff, die Frage, ob man im Sturm die Flügel angreifen will oder lieber aus einem massierten Mittelfeld heraus durch die Mitte sein Glück versucht – all dies sind Vorgaben, die einige Möglichkeiten der räumlichen Gestaltung schaffen, andere dagegen verhindern.
In Abhängigkeit von ihrer Strategie und ihren Spielern hat jede Mannschaft schon vor dem Anpfiff für sich ein eigenes Feld mit einer bestimmten Zonen- und Funktionsverteilung konstruiert. Weil dies so ist, hängt der Erfolg einer Fußballmannschaft in hohem Maß davon ab, ob es ihr gelingt, „ihr“ Spiel zu spielen und damit gleichzeitig dem Gegner die eigene Konzeption aufzuzwingen. Hätte es allerdings beim Fußball mit der Voreinstellung der Raumverteilung sein Bewenden, dann käme beim Spiel tatsächlich nicht viel mehr heraus als ein „Rasenschach“, bei dem eine Mannschaft mit Zugvorteil beginnt und die andere jeweils nur auf Vorgaben reagiert. Ein Spiel läuft jedoch in der Praxis nie derart statisch ab. Kennzeichnend für den Fußball ist vielmehr der dynamische Wechsel unterschiedlichster räumlicher Konstellationen, wobei sich auch die Rollen der Spieler unablässig verändern.
Bereits 1942 schrieb der französische Philosoph Merleau-Ponty: „Jedes Manöver, das der Spieler unternimmt, verändert das Bild des Spielfeldes und zieht neue Kraftlinien, innerhalb derer die Aktion ihrerseits abrollt und sich verwirklicht, indem sie aufs Neue das phänomenale Feld verändert.“ Im Lauf eines Spiels sind die Räume permanent in Bewegung, indem Lücken „gerissen“ oder „dicht“ gemacht werden, wird das bespielbare Feld permanent neu aufgeteilt oder neu zusammengefügt. Nicht immer ist dabei leicht zu erkennen, welche Mannschaft gerade im Vorteil ist. Denn der Raumgewinn allein zählt beim Fußball nicht. Entscheidend ist das geschickte Nutzen des Raumes, das Spiel im Raum und mit dem Raum. Man kann die Räume eng oder weit machen, man kann in die Tiefe oder in die Breite spielen, man kann das Spiel in andere Räume verlagern oder den Gegner auf kleinstem Raum ausspielen. Dieser Sachverhalt ist punktgenau getroffen, wenn man den Fußball als „das Spiel der wechselnden räumlichen Distanzen“ beschreibt.
Das Spiel mit dem Raum beginnt bereits in der Abwehr. Manche Teams, etwa die Italiener in den 1960er Jahren, verließen sich auf eine massive, tief gestaffelte Abwehr, die Griechen standen bei der EM 2004 ebenfalls weit hinten und erwarteten dort ihre Gegner. Das kann erfolgreich sein, modernes Abwehrspiel jedoch sieht anders aus. Es geht in erster Linie darum, das Spielfeld zu „verkleinern“. Johan Cruyff und sein Trainer Rinus Michels haben diese Strategie ab Ende der 1960er Jahre bei Ajax Amsterdam entwickelt. Eine Viererabwehrkette, vorgeschoben bis zur Mittellinie und dabei eine Abseitsfalle aufbauend, lässt für den Gegner nur noch halb so viel Platz. Dann geht es darum, in der Nähe des Balles Überzahl zu erreichen, den ballführenden Spieler einzukreisen, dadurch Abspiele zu erschweren und, wenn man den Gegner zum Fehler verleitet hat, selbst in Ballbesitz zu kommen. Ernst Happel, der das „Engermachen“ bereits in der gegnerischen Hälfte mit dem Hamburger SV der 1980er Jahre vorbildlich praktizierte, benutzte dafür den Namen „Pressing“: „Zerschlagen, was noch gar nicht entstand, und sich dann selber entwickeln.“
Was passiert, wenn man in der Abwehr nicht gut steht, mussten die Deutschen bei der Niederlage gegen Bulgarien im Viertelfinale der WM 1994 erleben. Weil sich der deutsche Libero Matthäus nach der 1:0-Führung hinter die Abwehr zurückzog, bekamen die Bulgaren Raum für gefährlich Aktionen in Tornähe und konnten das Spiel letztlich noch für sich entscheiden. Hätte er vor der Abwehr gespielt, hätte er im entscheidenden Moment schneller eingreifen können. Mangelnde Flexibilität und schlechte Raumaufteilung werden im modernen Spiel vom Gegner meist sofort bestraft. Früher gab es in der Abwehr nur eine zusätzliche Hilfe (den Stopper oder Libero), heute müssen alle beim Absichern eines Zweikampfes helfen. Auch die Offensivspieler müssen in der Defensive mitmachen, denn nur dann kann der ballführende Spieler in Überzahl gestellt werden. Heute ist die kollektive Abstimmung, das Verschieben und das Pressing in der Defensive, so ausgeprägt, dass es in keiner Phase mehr unbeteiligte Spieler geben darf. Jeder ist am Übernehmen, Übergeben, Verschieben beteiligt, selbst der Mittelstürmer muss bei Ballverlust sofort auf Defensive umschalten. Umgekehrt muss in der Offensive durch permanente Beteiligung des defensiven Personals Überzahl hergestellt werden.
In der Qualifikation zur WM 2006 jagten vor allem die von José Pekerman trainierten Argentinier vorbildlich im Kollektiv nach dem Ball. Wird der Ball vom Gegner nach außen oder hinten gepasst, ist dies das Signal für die argentinischen Spieler, sich sofort in Richtung Ball zu verschieben, um dem Gegner den Raum abzuschnüren, dadurch unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu verleiten. Argentinische Teams machen das Spielfeld nicht nur in der Länge, sondern auch in der Breite enger und stellen ihre Gegner unentwegt in „verdichteten“ Räumen. Andere, Mexiko etwa, schaffen es mit guter Raumaufteilung und enormer Laufbereitschaft, den ballführenden Spieler immer mit zwei Mann zu attackieren. Beim Confed-Cup 2005 kauften sie mit dieser Methode des permanenten Doppelns sogar den übermächtig scheinenden Brasilianern den Schneid ab.
Man kann also auch ohne Ball mit dem Raum spielen, eine Raumordnung vorgeben und dadurch dem Gegner in gewisser Weise das „eigene“ Spielfeld aufzwingen. Doch genau so, wie der Verteidiger dem Stürmer in der Bewegung immer hinterher ist, so ist auch die gesamte Mannschaft, die nicht im Ballbesitz ist, zu einem permanenten Hinterrennen gezwungen. Grundsätzlich hat daher die Mannschaft, die sich im Ballbesitz befindet, mehr Optionen. Und so versuchen auch alle Teams, die gewinnen wollen, das Spiel durch Ballbesitz zu beherrschen. Bis auf die Italiener, die als einzige die geradezu metaphysische Kraft besitzen, ein Spiel auch ohne Ballbesitz zu kontrollieren, streben alle siegeswilligen Mannschaften zunächst einmal nach der Ballkontrolle. Wer den Ball hat, kann entscheiden, was passiert, und der Gegner muss darauf reagieren.
Eine hervorragende Angriffsformation versteht es, sich durch pausenloses In-Bewegung-Sein und Rochieren so im Raum zu verteilen, dass es immer mindestens einen Spieler gibt, der besser zum Ball steht als der Gegner. Gute Mannschaften brillieren mit langen Ballstafetten, die den Gegner zum Statisten degradieren. Während die einen mit schnellen Kurzpässen das Spiel scheinbar mühelos kontrollieren, rennen die anderen hilflos hin und her. Wichtiger als jedes Spielsystem ist daher die Berücksichtigung der grundlegenden Fußballweisheit Sepp Herbergers, der zufolge es im Fußball allein darauf ankomme, „dass man dort, wo die Entscheidung fällt, jeweils zahlenmäßig stärker ist als der Gegner“. Entscheidend für den Torerfolg ist dann der Blick für die Lücke, der Pass in den „freien“ Raum, der für die eigene Mannschaft einen Spielzug ermöglicht, auf den der Gegner nicht mehr rechtzeitig reagieren kann.
Ohne Ball lautet das Credo, die Räume eng zu machen; bei Ballbesitz besteht die Hauptaufgabe darin, sie weit zu machen. Durch das Auseinanderziehen des Spiels – schnelle Flügelwechsel, öffnende Diagonalpässe – sollen möglichst viele Spieler des Gegners aus dem Spiel genommen werden. Für die angreifende Mannschaft stellt sich demnach das Spielfeld im Prinzip als ein geometrisierter Raum mit verschlossenen und offenen Flächen dar; durch deren geschicktes Verschieben will sie ein Übergewicht der eigenen Kräfte in Richtung gegnerisches Tor bzw. Platz für das eigene Spiel schaffen. Zentrale Aufgabe ist, die zunächst noch unsichtbaren Linien zu erkennen, auf denen das Spiel geöffnet werden kann. Genial ist, wer diese Linien erkennt und an ihnen entlang den Ball spielt. Aber natürlich müssen auch die anderen mitmachen und die entsprechenden Wege gehen.
Fußballdenker sehen die Linien besser. Aber Spieler, die den Raum mit ihren Pässen neu definieren können, benötigen auch ein hervorragendes Ballgefühl. Denn nur derjenige, der den Ball „blind“ beherrscht, hat den Blick frei für das Beobachten des Spielverlaufs. Im Gegensatz zum zaubernden Dribbler, der über seiner Ballverliebtheit oft den besser postierten Mitspieler vergisst, zeichnet den Spielgestalter neben guter Technik vor allem der ständige Überblick über die jeweils aktuelle Spielsituation sowie die Fähigkeit aus, mögliche Entwicklungen zu antizipieren. In der Regel weiß ein Spielgestalter schon vor dem Ballbesitz, wohin er den Ball abgeben kann, und in dem Augenblick, in dem er ihn spielt, hat er schon längst einen „Spielfilm“ parat für das, was dann passieren wird. Bernd Schuster beschrieb seine Qualitäten mit den Worten: „Wenn der Ball auf mich zurollt, weiß ich mindestens zwei Stellen, wo ich ihn hinschießen kann.“ Könner wie Schuster haben dann auch die Fähigkeit, den Ball ihren Mitspielern punktgenau „auf die Zunge zu legen“.
Weil sie diejenigen sind, die in oft genialer Weise mit dem Raum spielen und dadurch für die Vollstrecker die Wege zum Tor erst öffnen, gelten vielen die Denker und Lenker im Mittelfeld als die eigentlichen Helden des Spiels. Diese Regisseure oder Spielmacher eröffnen dem Spielverlauf ungeahnte Möglichkeiten, indem sie, wie etwa der geniale Netzer, „aus der Tiefe des Raumes“ einen Pass über die halbe Spielfläche schlagen und damit die Abwehrreihen zerteilen „wie den Pfirsich mit dem Obstmesser“. Aus solchen Pässen, die wie aus dem Nichts plötzlich ganz andere Situationen entstehen lassen, wird der Raum für Überraschungen gezimmert, der den Fußball so interessant macht. Wunderbar anzusehen ist auch das wieselflinke Kurzpass-Spiel der niederländischen Ballstrategen, deren Spiel – vor allem außerhalb Deutschlands – als „brillant Orange“ (David Winner) zum Synonym für schönen Fußball geworden ist. In beiden Fällen wird der Fußball zum Raum-Spiel und damit für den Zuschauer zum ästhetischen Genuss. Die von virtuosen Ballarchitekten auf den Rasen gezauberten Kunstwerke sind zwar nur flüchtige Erscheinungen; doch auch wenn nicht in Stein, so sind sie immerhin in die Erinnerung derer eingemeißelt, die sich für die Schönheit der Fußball-Geometrie begeistern können.
Die klassische Figur des Spielmachers und Regisseurs gilt mittlerweile als überholt. Der lange, öffnende Flugball habe abgedankt, so liest man immer wieder, weil die Räume zu eng geworden seien, weil die verteidigenden Mannschaften zu schnell nachschieben und das Spiel auf schmale Bereiche verdichten würden. Im Mittelfeld gefragt seien daher nicht mehr einsame Strategen à la Netzer, die mit einem genialen langen Pass die Räume „aufreißen“, sondern Teamarbeiter, die einen effektiven Kombinationsfußball aufziehen und den Ball über mehrere Stationen laufen lassen.
Tatsächlich haben mit Lothar Matthäus und Stefan Effenberg die letzten Spezialisten des langen Balles abgedankt. Und tatsächlich fand bereits 1993 der meiste Teil des Champions-League-Endspiels zwischen Olympique Marseille und dem AC Mailand (1:0) nur auf einem etwa 40 Meter tiefen Streifen rund um die Mittellinie statt: Zwei perfekt organisierte Abwehrreihen hatten sich im wahrsten Sinne des Wortes den Spielraum „geklaut“. Lange Pässe waren da wirkungslos. Dennoch kam es immer noch, wenn auch seltener, zum großräumigem Spiel; so trugen Stefan Effenbergs lange Bälle nicht unwesentlich zum Champions-League-Sieg Bayern Münchens im Jahr 2001 bei. In der Saison 2005/06 ließ sich der Niederländer Raffael van der Vaart vom HSV oft weit zurückfallen, um einen klassischen Pass „aus der Tiefe des Raums“ zu spielen. Der lange Pass ist also noch nicht ausgestorben; doch ist er keine Frage des Prinzips mehr, sondern der sich bietenden Gelegenheit.
Gelegentliche Flugbälle machen aber noch keinen Fußballsommer. Der gepflegte Spielmacher-Pass auf die Flügel mit anschließendem Dribbling und Flanke in den Strafraum ist heute weitgehend Fußball-Nostalgie. Im modernen Fußball setzen die Trainer nicht mehr auf klassische Spielmacher, sondern auf intelligente und ballsichere Leute, die das Spiel aus der Defensive mit klugen Zügen eröffnen können. Frank Rijkaard hat es beim AC Mailand, dem Europapokalsieger von 1989 und 1990, vorgemacht; Edgar Davids spielte bei Juventus Turin ganz ähnlich und wurde 2004 durch Emerson ersetzt, der von Fachleuten wie Urs Siegenthaler, dem Spielebeobachter des DFB, als wichtigster Spieler des aktuellen brasilianischen Teams eingeschätzt wird.
Im modernen Fußball müssen alle mitarbeiten und in der Lage sein, verschiedene Funktionen auf dem Spielfeld auszufüllen. Es gibt keine festen Arbeitsplätze mehr wie einst, als ein Verteidiger nur einen Streifen von 30 x 10 Metern beackerte. Heute geht alles viel schneller, kürzer und meist durch die Mitte, am perfektesten von den Brasilianern vorgeführt. Grundlage ihres „Flipperspiels“ ist eine hohe Laufbereitschaft, eine gute Abstimmung der Laufwege in entsprechenden Spielzonen und eine perfekte Technik, die es erlaubt, Dribblings zu gewinnen und den Ball selbst unter Bedrängnis sicher zu verarbeiten.
Doch auch wenn die Spielgestaltung auf mehrere Schultern verteilt wird, hat das schöne Spiel im und mit dem Raum noch nicht ausgedient. Alle Spieler müssen sich heute disziplinierter denn je mit hohem Tempo unermüdlich auf dem Platz bewegen. In entscheidenden Momenten aber sind immer noch die Ideen und Kunstfertigkeiten von Spielgestaltern gefordert. Und natürlich ebenso die Mitspieler, die ihre Entwürfe verstehen, die entsprechenden Wege gehen und so die sich öffnenden Möglichkeiten auch nutzen können. Und beides, die Vorlage und das Eingehen auf eine Spielidee, erfordert wie zu Zeiten Netzers einen hohen Grad an Konzentration und räumlicher Intelligenz.
In keinem anderen Bereich des Lebens liefen „auf so kleinem Raum mit so einfachen Mitteln so elementare und zugleich hochdifferenzierte Prozesse“ ab wie beim Fußball, bemerkte der Kunsthistoriker Horst Bredekamp. Das menschliche Hirn sei durch das geforderte intellektuelle Spiel mit dem Raum ganz besonders beansprucht. Mit Sicherheit gehöre es „zu den glänzendsten Fähigkeiten, zu denen menschliches Raumdenken fähig ist“, um in Sekundenbruchteilen „die Bewegungen des Gegenspielers mit denen der Mitspieler zu vergleichen und den Ball auf einen Punkt zu spielen, auf dem sich einer der Mitspieler in wenigen Sekunden freigelaufen haben wird“.
Genau das – die Genialität eines öffnenden Passes im Moment des Abspiels bewundernd zu erkennen – macht gerade für den Zuschauer den ästhetischen Reiz des Spiels aus. Solche „Kunstwerke des Augenblicks“ erschließen sich im vollen Maße erst für den Besucher im Stadion. Denn nur er kann – im Gegensatz zum Fernsehkonsumenten – die Gesamtsituation auf dem Spielfeld als Ganzes überblicken und beurteilen. Für ihn ist es zudem ein besonderer intellektueller Reiz, die nichtrealisierten Entwicklungsalternativen einer Spielsituation zu erfassen; und so wird es unter Fußball-Feinschmeckern zu einem beliebten Spiel, auch die situativ vielleicht bestmögliche Situation noch zu bekritteln. Weil im Fußball „alles“ möglich ist, kann eben nie ausgeschlossen werden, dass man „alles noch viel besser“ hätte machen können.