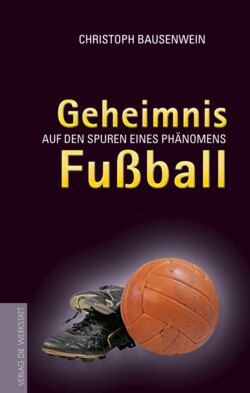Читать книгу Geheimnis Fussball - Christoph Bausenwein - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMANNSCHAFTEN
Im Fußball spielt nicht nur die Körperbeherrschung eine Rolle. Aus 22 je für sich jonglierenden Künstlern oder elf Pärchen, die je für sich dribbeln und grätschen, käme noch kein Fußballspiel zustande. Im mangelnden Mannschaftsspiel sahen die europäischen Experten die große Schwäche afrikanischer Fußballer. Das gängige Vorurteil lautete: Afrikaner hätten zwar generell „eine außergewöhnliche motorische Begabung und sehr viel Spielfreude“, zugleich aber fehle ihnen „oft das Spielverständnis“. Ähnlich lauteten einst die Urteile über die Brasilianer. Als sie dann seit 1958 WM-Titel in Serie holten, meinte ein Kommentator: „Von dem Tage an, an dem die Brasilianer das Mannschaftsspiel lernten, waren sie nicht mehr aufzuhalten.“
Fußball ist ein Mannschaftssport, und das heißt, dass je elf Spieler in gleichsam organischem Zusammenspiel eine schlagkräftige Einheit bilden müssen. Diesem „Mannschaftskörper“ hat Joachim Seyppel metaphorischen Ausdruck verliehen, als er einem Protagonisten seines Romans „Wer kennt noch Heiner Stuhlfauth“ die Aufstellung eines Fußballteams anhand der männlichen Anatomie erläutern ließ: „Das hier ist mein Rechtsaußen, sozusagen mein rechtes Bein, mein linkes Bein ist der Linksaußen, meine beiden Gehirnhälften stehen halbrechts und halblinks, meine beiden Lungen spielen Außenläufer, die beiden Verteidiger als Nieren scheiden gewissermaßen das für uns Gefährliche aus, der Torwächter ist unser Magen und Darm und muss leichte und schwere Brocken verdauen, das Herz fungiert als Mittelläufer, und vorn steht mein Mittelstürmer, der muss die Tore schießen, unser fruchtbarster Stoßkeil, sozusagen das Geschlecht … und die Mannschaft als Ganze ist, wenn ich mich so ausdrücken darf, die Haut, die alles zusammenhält …“
Wie jedes einzelne menschliche Organ nur im „Zusammenspiel“ mit allen anderen seine Funktion erhält, so macht auch jeder einzelne Fußballspieler nur innerhalb des Gesamtgefüges einer Mannschaft „Sinn“. Die Spielweise eines Teams lässt sich erst verstehen, wenn man die Interaktion der Spieler beachtet. Für ein Tor ist nie nur der Schütze allein entscheidend, denn es ist immer Resultat einer langen Reihe von Kombinationen. Wer nur Ausschnitte eines Spieles sieht, kann den konsequenten Zusammenhang und die Folgerichtigkeit des Geschehens nicht verstehen. Die Beobachtung eines einzelnen Spielers ist vollkommen sinnlos, da seine Aktionen, seien sie auch noch so artistisch, für sich genommen nichts bedeuten. Der mit Sepp Herberger befreundete Schauspieler Bernhard Minetti erkannte in diesem Zusammenhang unmittelbare Ähnlichkeiten zwischen einem Theaterensemble und einer funktionierenden Fußballmannschaft. Herberger, so Minetti, „war ja ein so guter Trainer, weil er die Menschen sehen, erkennen und ihren Beweggründen und Veranlagungen gemäß behandeln konnte“. Und ähnlich habe er, wenn er einmal im Theater zu Besuch gewesen sei, den Schauspieler „im Verhältnis zum Zusammenspiel“ beurteilen können. „Das war immer wieder erregend und überwältigend für mich. Unser beider gemeinsames Wissen: Ensemblespiel im Theater analog dem Mannschaftsspiel Fußball.“
Selbst der schönste Stürmertrick bleibt bloße Spielerei, solange er nicht dem Spiel der ganzen Mannschaft dient, und auch die permanente Balleroberung eines Verteidigers führt zu nichts, wenn er die mit dem Ballbesitz verbundene Spieloption nicht konstruktiv zu nutzen vermag. Deswegen gilt heute immer noch die Ermahnung Sepp Herbergers: Der Zweikampf – sei es in der Offensive oder in der Defensive – darf nicht zum Selbstzweck werden, sondern man hat in ihm einen nur „durch die Umstände aufgezwungenen Aufenthalt auf dem Wege zum Tor“ zu sehen.
Erst durch eine sinnvolle Kombination von Handlungssequenzen wird aus dem zusammenhanglosen Einzelspiel ein Miteinander, das eine Gesamtleistung erzeugt.
Von größter Bedeutung ist dabei die Ausgewogenheit des Spiels. Das beste Angriffsspiel nützt nichts, wenn dadurch die Abwehr so entblößt wird, dass sie in einem schnellen Gegenstoß locker ausgespielt werden kann; massiert sich dagegen eine Mannschaft zu sehr in der Verteidigung, läuft sie Gefahr, irgendwann dem Druck des Gegners nicht mehr standhalten zu können; konzentriert sich das Spiel zu sehr im Mittelfeld, dann wird es oft so statisch, dass man gar nicht mehr vors Tor gelangt. Ein im Ganzen harmonisches Mannschaftsspiel ergibt sich also erst dann, wenn die Kombinationen zwischen Verteidigung, Mittelfeld und Angriff fließend ineinander übergreifen. Selbst der Torhüter, ansonsten der einzige Einzelkämpfer im Fußball, muss sich bei Abschlag oder Abwurf geschickt verhalten, denn bei ihm fängt jeder Angriff an. Was dann am Ende verglichen und zur Entscheidung gebracht wird, sind daher nicht die aufeinander gerechneten Einzelleistungen von je elf Spielern, sondern die kollektive Leistungsfähigkeit zweier Teams. Die drückt sich in gelungenen Spielzügen und in Torchancen aus, und, wenn eine entsprechende Kaltschnäuzigkeit und das nötige Quäntchen Glück im entscheidenden Moment hinzukommt, auch in Toren.
Erste Aufgabe eines Trainers ist es, unter den ihm zur Verfügung stehenden Spielern die richtige Mischung auszuwählen. Jeder muss überlegen, wie er die ihm zur Verfügung stehenden individuellen Qualitäten am wirkungsvollsten einsetzen kann.
Frankreichs Nationaltrainer Aimé Jacquet hatte 1998 das Glück, eine „Weltauswahl“ präsentieren zu können. In der „Équipe tricolore“, die mit prickelndem Champagner-Fußball den Weltmeistertitel errang und dabei nicht nur die französischen Fans begeisterte, fanden sich sehr talentierte Spieler unterschiedlichster Herkunft zusammen. Um den „Urfranzosen“ Didier Deschamps bildeten Spieler wie Lilian Thuram und Thierry Henry (Guadeloupe), Patrick Vieira (Senegal), Marcel Desailly (Ghana), Zinedine Zidane (Algerien), Youri Djorkaeff (Armenien) und Christian Karembeu (Neu-Kaledonien) ein multikulturelles Team. Fast konnte man den Eindruck gewinnen, als sei diese Mischung ein Geheimrezept für zauberhaften Fußball. Das französische Team vereinigte viele Qualitäten, die aber natürlich ursächlich nichts mit der ethnischen Herkunft der Spieler zu tun hatten. Entscheidend war die Kombination der Fähigkeiten und Charaktereigenschaften der einzelnen Spieler.
„Elf Kämpfer“, sagte die Trainer-Ikone Hennes Weisweiler, „wachsen ebenso wenig zu einer guten Mannschaft wie elf Techniker.“ Jeder Trainer muss aus technisch versierten, robusten, schussstarken, schnellfüßigen, konditionsstarken, spontanen und intelligenten Spielern eine richtige Mischung formen und sie in den Mannschaftsteilen einsetzen, wo ihre Stärken am besten zur Wirkung kommen. Der ehemalige deutsche Bundestrainer Helmut Schön schwor auf eine Kombination von drei Elementen: auf Spieler, die dafür sorgen, dass sich die Mannschaft diszipliniert und nach System auf dem Platz bewegt (das ordnende Element), auf Individualisten, die mit spontanen Aktionen überraschende Akzente setzen können (das spielerische Element), sowie auf „Männer mit Herz“, die immer Dampf machen und nie aufgeben (das kämpferische Element). Aber nicht nur die Vereinigung der Eigenschaften von Denkern, Musikern und Kriegern ist wichtig. Zu einem funktionierenden „Rezept“ gehören noch weitere Zutaten, etwa die Ergänzung der Tugenden von alten Spielern (Übersicht, Erfahrung) durch die Vorzüge junger Talente (Unbekümmertheit, Tatendrang). Zudem muss die Mischung nicht nur spielerisch, sondern auch „seelisch“ stimmen. Nur wenn die geistige und psychische Zusammen-Stimmung passt, wenn ausgleichende und aggressive Typen ein leistungsförderndes Klima schaffen, wird eine Mannschaft stark. Trotz der enormen Bedeutung, die der mannschaftlichen Geschlossenheit zukommt, gibt oft erst ein Quäntchen individuelles Rebellentum den Ausschlag zum Sieg. Nicht selten sind es gerade die unangepassten, unbequemen und eigenwilligen Ausnahmespieler à la Maradona, die den entscheidenden Schlussstein im Spielerpuzzle setzen.
In früheren Zeiten gab es in jeder Mannschaft eine klare Hierarchie: Bei dem in den 1920er Jahren dominierenden 1. FC Nürnberg gab es als spielbestimmende Figur den Mittelläufer Hans Kalb, dem der konditionsstarke Läufer „Bumbes“ Schmidt zur Seite stand; in der berühmten Gladbacher Mannschaft der 1970er Jahre hielt dem Regisseur Günter Netzer das „Laufwunder“ Hacki Wimmer den Rücken frei; im Weltmeister-Team von 1974 ließ sich der Libero Franz Beckenbauer von seinem „dritten Fuß“ Georg Schwarzenbeck die Gegner weghauen. Nicht alle Spieler einer Mannschaft, so lässt sich daraus schließen, müssen „geniale“ Fußballer sein, denn nicht immer, so Cesar Luis Menotti, der argentinische Weltmeister-Trainer von 1978, ist der „bessere Spieler auch der wertvollere für das Team“. Deswegen war es keineswegs unwichtig, dass Helmut Schön, der dem armen Schwarzenbeck zunächst noch die Tür zur Nationalmannschaft verschlossen hatte – „mit so einem lachen einen doch alle aus“ – später zur Einsicht und mit einem siamesischen „Schwarzenbeckenbauer“ zum WM-Titel kam.
Besonders in deutschen Mannschaften war das Spezialistentum ausgeprägt und die Rollenzuteilung streng. Chefs waren die Spielmacher im Mittelfeld, anerkannt waren die „Bomber“ in der Sturmmitte, bewundert wurden die Dribbelkönige und Flankengötter auf den Flügeln. Der Rest waren die Helfer, die Lungen, die Wasserträger, die Männer fürs Grobe, die den Machern, Vollstreckern und den „Künstlern“ zu dienen hatten. Solche Hierarchien scheinen heute weitgehend aufgelöst. Eine klare Trennung zwischen Arbeitern und Kreativen gibt es nicht mehr. Zwar wird in Deutschland noch diskutiert, ob eine Mannschaft einen „Kommandeur“ benötigt, doch in anderen Ländern ist die Vorstellung, dass es „Führungsspieler“ gibt, die durch entsprechende „Komplementärspieler“ ergänzt werden müssen, schon lange zu den Akten gelegt. Heutige Autoren betonen unermüdlich, moderne Teams seien funktionierende Kollektive, die keinen eigentlichen Chef mehr benötigten. Je nach Spielsituation nehme immer wieder ein anderer Spieler eigenverantwortlich den Dirigentenstab in die Hand und gebe den Takt an. Trotzdem gibt es aber wohl immer noch kleine Unterschiede.
Die Feststellung, im modernen Fußball hätten totale Spezialisten nichts mehr zu suchen, ist sicher richtig. Die Zeit, in der es noch reine Stürmer und reine Verteidiger gab und in der ein Mann wie der Argentinier Stabile, dessen Fähigkeiten einzig auf Schnelligkeit und Schusskraft beruhten, zum Torschützenkönig einer WM (1930) werden konnte, sind heute vorbei. Damals waren die Argentinier noch mit der Taktik zum Erfolg gekommen, dass die in der Ballführung perfekten Spieler den Gegner an sich zogen und dann mit dem schnellen Pass in die so entstandenen Lücken den „Abwehr-Filtrierer“ („El Filtrador“) Stabile bedienten. Heute wird jedem Spieler eine außergewöhnliche Vielseitigkeit abgefordert. Während beim Football Spieler eingewechselt werden, um nur eine einzige spezielle Aktion auszuführen, ist der moderne Fußballspieler im Verlauf eines Matches gezwungen, die unterschiedlichsten Aufgaben zu erfüllen: Ein Verteidiger muss auch stürmen können, ein Stürmer muss auch verteidigen können, im Mittelfeld muss die kreative und athletische Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden.
Angefangen habe dieses moderne Spiel, so wird allenthalben erzählt, mit dem „totalen Fußball“ der Niederländer in den 1970er Jahren. Dieses Team war, trotz der überragenden Figur Johan Cruyff, ein Kollektiv, in dem jeder Spieler prinzipiell jede Position ausfüllen konnte. Aber das Kollektiv hatte auch einen Kopf. Cruyff stand wie ein Feldherr dazwischen, korrigierte die Positionen und zeigte Laufwege an. In seiner Funktion für das Team hätte er von dem bulligen Neeskens wohl kaum adäquat ersetzt werden können. Und nicht nur die Leichtigkeit und Finesse, auch die Führungsstärke eines Zinedine Zidane war im französischen Weltmeister-Team genauso unersetzbar wie es heute ein Michael Ballack in der deutschen Nationalmannschaft ist. Beide Beispiele zeigen aber zugleich, dass der Star im klassischen Sinn, der für sich Sonderrechte beansprucht, ausgedient hat. Beide sind herausragende Einzelspieler, ordnen sich jedoch ins Kollektiv ein. Sie wissen, dass sich nicht das Spiel der Mannschaft auf sie, sondern dass sie sich auf das Spiel der Mannschaft einstellen müssen. Kein Team kann sich mehr primadonnenhafte und lauffaule Stars leisten, die aus der Gesamtdisziplin ausscheren.
Grundelement des gelungenen Zusammenspiels sind einstudierte Spielzüge. Gute Mannschaften zeichnen sich immer dadurch aus, dass die Spieler ihr Handeln aufeinander abstimmen können, dass jeder Spieler weiß, wie sich die anderen verhalten, wie sie sich bewegen und wie sie den Ball spielen werden. Im Fußballsport ist Eingespielt-Sein eine Macht, und dementsprechend resultiert aus fehlendem Verständnis fußballerische Ohnmacht. Fehlt das Zusammenspiel, so kommt es zu sinn- und fruchtlosen Einzelaktionen und vielen Ballverlusten, weil sich die Mitspieler nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort befinden. Sinnvolle Spielzüge können nur dann herauskommen, wenn die Individuen sich „verstehen“, wenn sie in der Lage sind, sich wechselseitig in die Erwartungen und Absichten der anderen einzufühlen. Jede Handlung eines Spielers, so der Philosoph und Psychologe George Herbert Mead, „wird von der Annahme über die voraussichtlichen Handlungen der anderen Spieler bestimmt. Sein Tun und Lassen wird durch den Umstand kontrolliert, dass er gleichzeitig auch jedes andere Mitglied der Mannschaft ist, zumindest insoweit, als diese Haltungen seine eigenen spezifischen Haltungen beeinflussen.“ Wenn Spieler in der Lage sind, ihre Aktionen und Reaktionen wechselseitig „wie im Schlaf“ zu kontrollieren, dann kommt dabei eine Mannschaft heraus, die „wie aus einem Guss“ spielen kann, weil der Ball scheinbar selbstverständlich von Spieler zu Spieler läuft.
Erst im Zusammenspiel kann jene Perfektion zustande kommen, die sich auch in Toren auszahlt. Besonders gut funktionierende Sturmreihen wie die – damals noch aus fünf Spielern bestehende – von River Plate Buenos Aires in den 1940er und die von Real Madrid in den 1950er Jahren haben denn auch kollektive Ehrennamen erhalten: Die „River Macquina“ lief geschmiert wie eine Maschine, und das „Weiße Ballett“ der Madrilenen vollzog sich so formschön, als folgte es einer strengen Choreographie. Ähnliche Metaphern fanden Sportjournalisten auch für Abwehrreihen. Willy Meisl schrieb zur brasilianischen WM-Elf von 1958: „Vor dem durchgekommenen Spieler baut sich immer wieder einer der wieselflinken Brasilianer auf. Immer hat man den Eindruck, dass ein gut geöltes, aus genau ineinander gepassten Teilen bestehendes Gitter sich einschaltet, dass irgendwo unsichtbare Knöpfe gedrückt werden, die dieses robotmäßig effektive, aber völlig individualisierte Verteidigungssystem funktionieren lassen.“ Ähnliches ließe sich in der Gegenwart von den „Gummimauern“ italienischer und argentinischer Abwehrreihen sagen. Aber auch über jene Brasilianer, die im Confed-Cup-Finale 2005 eben jene scheinbar so perfekten Argentinier mit 4:1 vom Platz fegten. Wie eine Flipperkugel schoss der Ball zwischen den Robinho, Adriano, Kaká und Ronaldinho hin und her, alles vollzog sich so schnell, dass man kaum noch folgen konnte, und alles geschah derart leichtfüßig, locker und so sicher, als würde da ein Computer-Programm abgespielt. Mochte man da noch einen Einzelnen herausheben? Allenfalls konnte man feststellen, dass man Ronaldo nicht vermisste. Vermutlich hätte er in diesem perfekten Kollektiv auch nur gestört und Sand ins Getriebe gebracht.
Ronaldo gilt als einer von der aussterbenden Spezies jener anarchistischen Spieler, die sich der disziplinierten Arbeit im System verweigern. Noch während der WM 2002 konnte er als i-Tüpfelchen in einer hervorragenden Mannschaft die spielentscheidenden Überraschungsmomente setzen. Solche Spieler, die sich der Fron im Kollektiv nicht fügen, haben den Trainern früher graue Haare wachsen lassen. Trotzdem hätte sich diese der grauhaarige Jupp Derwall wohl ausreißen können, nachdem er sein Enfant terrible, den „blonden Engel“ Bernd Schuster, nur einmal, beim Gewinn der EM 1980, zur Entfaltung hat kommen lassen. Der hätte seiner drögen Truppe bei den Turnieren von 1982 (WM) und 1984 (EM), wo er nicht dabei war, sicher ein wenig Leben einhauchen können. Denn es steht fest: Obwohl der Grundcharakter des Spiels geprägt ist durch die wechselseitige Abhängigkeit der Mitglieder einer Mannschaft, ist es jederzeit möglich, dass ein herausragender Spieler dem Spiel einer Mannschaft seinen Stempel aufprägt. Weil jede Handlung eines Einzelnen Signal ist für die anderen, kann es einem Einzelnen sogar gelingen, seine Mitspieler mitzureißen und zum Sieg zu führen.
Und nicht nur in diesem psychologischen Sinn kann es vorkommen, dass ein Spieler „allein“ ein Match entscheidet. In jedem Spiel gibt es Augenblicke, in denen ein Spieler „sein Herz in die Hand nimmt“ und erfolgreich etwas „auf eigene Faust“ unternimmt. In ganz seltenen Fällen kann es sogar vorkommen, dass einer den Gegner „im Alleingang“ schlägt. Dem Tschechen Josef Masopust gelang 1962 im Maracana-Stadion gegen die Brasilianer ein Slalomlauf, den er mit dem Treffer zum 1:0-Sieg abschloss. Das „Tor des Jahrhunderts“ aber schoss Diego Maradona. Im Viertelfinale der WM 1986 gegen England hatte der Argentinier bereits ein irreguläres Tor mit der Hand erzielt, dann schritt er zur Wiedergutmachung. Noch in der eigenen Hälfte startete er zu einem Solo, bei dem er nacheinander drei Engländer stehen ließ und anschließend auch noch Torhüter Shilton umspielte. Selbst der englische Trainer Bobby Robson war begeistert: „Ein Wundertor. Ein phantastisches Tor. Es ist herrlich für den Fußball, dass es so einen Spieler gibt.“
Maradona prägte sein Team, wie kaum ein anderer es je vermochte. Natürlich wussten auch die Gegner das. Bei der WM 1982 folgten die Italiener dem schlichten Gedanken: Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir Maradona ausschalten. Und so zermürbte ihn Claudio Gentile mit brutalen Tritten. Bei der WM 1986 versäumten das die Engländer und mussten, siehe oben, die Konsequenzen tragen. Die davon schwer beeindruckten Deutschen wollten es im Finale besser machen und konzentrierten sich darauf, das argentinische Ballgenie auszuschalten. Es war dennoch umsonst. Nach der 2:3-Niederlage Deutschlands schrieb die französische Zeitung „Libération“: „Der Sieg des Maradona-Effektes. Im Endspiel dachten die Deutschen nur an ihn. Und die Argentinier in seinem Schatten, seine fast anonymen Partner, haben dies genützt, um das Spiel ihres Lebens zu spielen.“ So wie manche Genies enttäuschen können, so kann auch der Gedanke verhängnisvoll sein, die Ausschaltung des besten Spielers der gegnerischen Mannschaft allein genüge schon zum Sieg.
Die Beispiele zeigen, dass der Grundwiderspruch zwischen individueller Freiheit und kollektiver Disziplin in jedem Fußballspiel von Neuem zu lösen ist. Im Mannschaftssport Fußball kann ein Team nur dann erfolgreich sein, wenn sich jeder Einzelne kooperativ in das Ganze einfügt. Einerseits. Andererseits kann der Erfolg gerade davon abhängen, dass der Einzelne sich für einen Moment aus diesem Ganzen herauslöst und etwas Unerwartetes tut. Und beides gilt auch für den Misserfolg: Zu starre Disziplin kann zu unflexibel machen, unbedachte Einzelaktionen können dem Gegner Chancen zum Konter eröffnen. Es bleibt eine nicht hintergehbare Fußball-Tatsache: Jedes Mannschaftsmitglied ist einerseits zwar immer von den Gesamtbewegungen des Kollektivs abhängig, andererseits aber bleibt jede Bewegung auf dem Spielfeld durch die Entscheidungen Einzelner bedingt.
Der perfekte – man möchte in diesem Zusammenhang sagen: der „mündige“ – Spieler zeichnet sich möglicherweise dadurch aus, dass er erkennt, wann er gegen die Disziplin des Kollektivs verstoßen darf und wann nicht, dass er strenge Vorgaben nicht stur befolgt, sondern sie je nach situativer Angemessenheit neu auslegt und sogar überschreitet. Als Paradebeispiel dafür könnte der geniale und zugleich äußert mannschaftsdienlich spielende Zinedine Zidane genannt werden. Auch wenn er immer versucht, den Ball besonders elegant zu spielen, will er die anderen nicht in den Schatten stellen. Er zieht nicht pausenlos den Ball an sich, sondern er arbeitet im Getriebe des Teams wie ein feinsinniger Mechaniker, der je nach Situation zündende Ideen und kleine Funken einstreut oder aber unprätentiös einen Kollegen in Szene setzt. In einer funktionierenden Mannschaft wie dem französischen Weltmeister-Team gelingt es, den Widerspruch zwischen den Ansprüchen des Einzelnen und den Erfordernissen des Ganzen aufzuheben.
Wie eine Mannschaft dann tatsächlich in einem Spiel auftritt, hängt natürlich nicht nur von ihren Bestandteilen ab, sondern auch vom Gegner. Es ist ein ziemlich komplexer Sachverhalt, dass jede Mannschaft nur so spielen kann, wie es die andere zulässt, und somit nicht nur Gegner, sondern Mitspieler zugleich ist. Nicht umsonst heißt es von Mannschaften, die sich ausschließlich auf die Verteidigung des eigenen Strafraums beschränken, sie würden „das Spiel kaputt machen“. Ein – zumindest oberflächlich betrachtet – geradezu langweiliges Spiel ergibt sich dann, wenn zwei nahezu perfekt agierende Mannschaften aufeinander treffen. Im WM-Finale 1994 zwischen Brasilien und Italien lief der Ball in jeder Mannschaft wunderbar, allerdings nur bis zum gegnerischen Strafraum. Dort trafen die Angreifer jeweils auf ein fehlerlos agierendes Kollektiv von Verteidigern. Weil man sich gegenseitig schachmatt setzte, blieben Chancen Mangelware, und das Ergebnis, ein 0:0, war daher geradezu programmiert.
Glücklicherweise treffen solche perfekten Kollektive nur selten aufeinander. Selten sind auch Spiele, bei denen eine Mannschaft den Ball so gut kontrolliert, dass der Gegner ihn kaum mehr sieht. Normalerweise macht jede Mannschaft Fehler. Und jeder Fehler kann zu einem Tor und damit zu einem ganz „neuen“ Spiel führen. Ein Rückstand zwingt sogar ein zunächst rein defensiv eingestelltes Team, nun selbst die Aktion in der Offensive zu suchen. Die ganze Dramatik des Fußballs zeigt sich freilich erst in Begegnungen, bei denen beide Kontrahenten den offenen Schlagabtausch suchen und das Spiel zwischen beiden Toren hin- und herwogt. Die spannendsten und schönsten Matches entwickeln sich, wenn beide Mannschaften den Willen zum Sieg haben, wenn sie versuchen, „ihr“ Spiel zu machen, anstatt sich allein darauf zu konzentrieren, das Spiel des Gegners nur zu zerstören. Da sie sich dann wechselseitig zu konstruktiven Aktionen herausfordern, kann man sogar davon sprechen, dass sie zugleich gegeneinander und miteinander spielen.
Den spezifischen Reiz eines gelungenen Fußballspiels – das permanente Hin und Her, den plötzlichen Wechsel der Spielsituationen in Aktion und Reaktion – kann man sich verdeutlichen, wenn man nochmals den Unterschied von Hand und Fuß bedenkt. Bei allen Handballspielen – wozu man aus bereits erwähnten Gründen auch Rugby und Football rechnen muss – ist der Ball nur selten frei zu greifen. Weil er sich permanent im festen Griff irgendeines Spielers befindet, ist es in Spielen wie Handball und Football für den Angreifer äußerst schwierig, sich in Ballbesitz zu bringen. Es gibt im Grunde nur zwei Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen: Entweder erlaubt man, dass der Ball demjenigen, der ihn gerade in Händen hält, gewaltsam entrissen wird, oder man verbietet jede Attacke, sobald ein Spieler den Ball sicher unter Kontrolle hat.
Zur ersten Lösung tendieren Rugby und Football, während Handball und Basketball zum Gegenteil neigen. Die mit beiden Varianten verbundenen Probleme liegen auf der Hand: Erlaubt man eine Attacke auf den Körper des Gegners, ist man sofort mit der Aufgabe konfrontiert, Mittel und Wege zu ersinnen, wie die so herausgeforderte Gewalt wieder eingeschränkt werden kann. Im Rugby und insbesondere im Football mussten daher äußerst genaue und komplizierte Regeln geschaffen werden, um einerseits schwerwiegende Verletzungen zu vermeiden und andererseits zu verhindern, dass jeglicher Spielfluss in einem Tohuwabohu sich raufend ineinander verkeilender Menschen erstickt wird. Verbietet man den Angriff auf den sicher gehaltenen Ball, liegt das Problem darin, wie der für ein Spiel doch notwendige Ballwechsel zwischen den Parteien überhaupt noch möglich bleiben kann. Tatsächlich ist die Eroberung des Balles ein für das Handball- und Basketballspiel uncharakteristischer Vorgang. Beide Spiele sind nahezu reduziert auf die ununterbrochene Abfolge von Versuchen, ein Tor bzw. einen Korb zu erzielen. Bei Treffern und Fehlversuchen wechselt der Ballbesitz automatisch, und da beides so häufig ist, ist das Hin und Her des Spiels nicht abhängig von Fehlern bei der Ballabgabe.
Die Frage, wie der Ball im Spiel zwischen den Parteien wechseln kann bzw. soll, ist einzig im Fußball befriedigend gelöst. Die Probleme von Spielen wie Football, Handball oder Basketball – Gewalt und Verregelung einerseits, Mangel an Dramaturgie durch die Vielzahl der Treffer andererseits –, werden im Fußball bereits durch das einfache Verbot des Handspiels vermieden. Einzig beim Fußball bleibt der Ball, weil „ungegriffen“, frei und ist dadurch permanent dem „Zutritt“ des Gegners ausgesetzt. Nie kann sich ein Spieler seines Besitzes sicher sein, gleichzeitig muss er aber auch nicht um Leib und Leben fürchten, wenn andere versuchen, ihrerseits den Ball zu erobern. Weil er ein „offenes“ Spiel ist, muss beim Fußball keineswegs jeder Angriff mit einem Torschuss oder einem Treffer abgeschlossen werden, damit der Ball zum Gegner wechselt; und weil er ein in sich diszipliniertes Kampfspiel ist, kann er auf komplizierte Regeln verzichten, die den Einsatz körperlicher Gewalt regeln müssten.
Es scheint so, als verberge sich hinter der vermeintlichen Insuffizienz des Fußballspiels – schätzungsweise jede zweite Angriffsaktion endet mit einem Fehlpass! – eine geheimnisvolle Spiel-Stärke. Das durch die Ungeschicklichkeit der Füße verursachte extrem hohe Risiko des Ball-verlusts führt dazu, dass dem Fußball eine elementare Unsicherheit und Unkalkulierbarkeit im Ablauf des Geschehens eigen ist, die sich mit kaum einer anderen Mannschaftssportart vergleichen lässt. Aussichtsreich scheinende Angriffe enden plötzlich durch überraschende Fehler oder durch das gelungene Tackling eines Verteidigers, schon wendet sich das Blatt, und der eben noch Angreifende wird kalt von einer Konterattacke erwischt. Gerade diese Unvollkommenheit ist also die Voraussetzung für eine Permanenz der Spannung.
Nirgendwo sonst wechselt der Ball so oft und oft so überraschend zwischen den Mannschaften, nirgendwo sonst ist der Ablauf eines Spiels so unvorhersehbar. Kurz: Weil der Fuß so unzuverlässig ist, kann der Fußball auf komplizierte Regeln verzichten und gleichzeitig zu einem dramatischen Spiel werden, das sowohl durch rassige Zweikämpfe wie durch ein fließendes Hin und Her der Bewegungen gekennzeichnet ist. Oder, paradox ausgedrückt: Der Erfolg des Fußballspiels beruht zu einem großen Teil auf einem Misserfolg – nämlich dem Misserfolg des menschlichen Versuchs, einen Ball mit dem Fuß zu „greifen“.