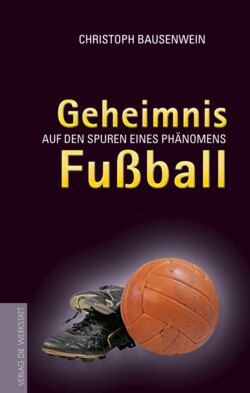Читать книгу Geheimnis Fussball - Christoph Bausenwein - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKAMPF
Fußball ist definiert als ein Kampfspiel zwischen zwei Mannschaften aus je elf Spielern. Zwar darf der Ball nicht gegriffen werden, und es wird nicht im eigentlichen Sinne um ihn gerauft, doch kommt ein Spieler ohne Kampf nicht zum Ballbesitz, und ohne Ballbesitz gibt es keine Chance auf einen Torerfolg. Zweikämpfe um den Ball werden von den Zuschauern als „packend“ erlebt und von den Journalisten oft als „rassig“ bezeichnet. Sie gehören zur Faszination des Spiels und haben etwas Mitreißendes, gleichwohl beinhalten sie immer die Versuchung zum Foulspiel bzw. das Risiko, eines zu begehen. Das war früher so, und es blieb auch so. „Eine Schattenseite dieses nützlichen Bewegungsspieles bleibt es, dass Drängen, Stoßen und Ringen dabei unvermeidlich sind und im Eifer zuweilen Ausschreitungen begangen werden“, schrieb der Verfasser eines Artikels im „Meyer-Lexikon“ von 1904. „Wenn du den Ball hast“, dozierte Franz Beckenbauer 1994, „kann der Gegner kein Tor schießen. Aber wenn du nur halbherzig hingehst, kriegst du den Ball nie.“ Beabsichtigt ist natürlich die Perfektion – „verletzen wollen wir niemanden“, so Beckenbauer. Auch das Foul und damit ein gegen das eigene Team verhängter Freistoß ist möglichst zu vermeiden. Im Eifer des Gefechts kann es aber zum Einsatz irregulärer Mittel kommen, in brenzligen Situationen wird das Foulspiel sogar bewusst in Kauf genommen. Um Schaden vom eigenen Team abzuwenden, wird die „Notbremse“ gezogen und der durchgebrochene Gegner von den Beinen geholt. Im Jahr 1980 bekannte Paul Breitner in seinem Buch „Ich will kein Vorbild sein“: „Bevor ich dem Gegner erlaube, ein Tor zu schießen, muss ich ihn mit allen Mitteln daran hindern – und wenn ich das nicht mit fairen Mitteln tun kann, dann muss ich das eben mit einem Foul tun. Lieber ein Freistoß als ein Tor. Wer das nicht offen zugibt, der lügt sich was vor – oder er ist kein Fußballer.“ In manchen Fällen wurde diese Ansicht noch gesteigert zum Vorsatz, den herausragenden Spieler des Gegners per Foulspiel gänzlich auszuschalten, das heißt: ihn so zu verletzen, dass er ausgewechselt werden muss.
Da ein Spiel nur dann unterbrochen wird, wenn der Ball ins Aus geht oder der Schiedsrichter einen Freistoß pfeift, können Fouls zu einem taktischen Mittel werden. Mit einem so genannten „taktischen Foul“ im Mittelfeld wird ein möglicherweise gefährlicher Angriff bereits im Ansatz verhindert. Zudem unterbricht die Provokation eines Freistoßes, der weit entfernt vom eigenen Tor erfolgt, den Spielfluss des Gegners und gibt dem eigenen Team Gelegenheit, Luft zu holen und sich wieder neu zu organisieren. Umgekehrt können aber auch die ballführenden Spieler ein Foul provozieren. Viele Stürmer nutzen die kleinste Berührung durch den angreifenden Verteidiger, um sich theatralisch fallen zu lassen. Besonders oft passiert das in Strafraumnähe, um einen Freistoß in torgefährlicher Entfernung herauszuholen. Andere heben sofort zur „Schwalbe“ ab, kaum dass sie die Strafraumgrenze überschritten haben, und provozieren so einen Elfmeter. Im Fußball spielt also die simulierte Gewalt mindestens genau so eine große Rolle wie die tatsächliche Gewalt.
Vor über zwei Jahrzehnten lösten brutale Szenen auf den Fußballplätzen eine lang andauernde Gewaltdiskussion aus. Keiner, der es am Fernseher gesehen hat, wird das üble Foul des deutschen Torhüters Toni Schumacher im Halbfinale der WM 1982 vergessen. Schumacher sprang dem heranstürmenden Franzosen Battiston mit der Hüfte voran entgegen, obwohl er keinerlei Aussicht hatte, den Ball zu erreichen; Battiston blieb mit Gehirnerschütterung, Halswirbelriss und drei ausgeschlagenen Zähnen liegen. Schumachers Untat waren in der Bundesliga drei weitere spektakuläre Fouls vorangegangen. 1979 trat der Schalker Manfred Drexler dem am Boden liegenden Münchner Kraus hinterrücks in den Rücken; Kraus, vorübergehend bewusstlos, erlitt eine schwere Wirbelsäulen- und Nierenprellung. 1980, im Bundesligaspiel zwischen Leverkusen und Frankfurt, holte der Leverkusener Gelsdorf den schnellen Koreaner Bum Kun Cha von den Beinen; Cha entging nur knapp der Invalidität (Lendenwirbelriss). 1981 zeigte der Bremer Siegmann – Trainer Rehhagel soll ihn dabei mit den Worten ermuntert haben: „Tritt dem L. in die Knochen, pack ihn dir“ – seinem Bielefelder Gegenspieler Lienen, wie man mit spitzen Stollen einen Oberschenkel auf 20 cm Länge aufschlitzen kann.
Die geschilderten Fouls fielen in eine Zeit, als grätschende Verteidiger wie Berti Vogts („der bissige Terrier“, Fußballer des Jahres 1979) und eisenharte Manndecker wie Karl-Heinz Förster („der Treter mit dem Engelsgesicht“, Fußballer des Jahres 1982) im deutschen Fußball die Szene beherrschten. Immer mehr Kritiker mahnten, dass solche primitiven Kampfhunde und Blutgrätscher das Fußballspiel kaputtmachen würden. Statistiker wollten erkennen, dass die erkennbar zunehmende Gewalt im Spiel unbedingt gestoppt werden müsse. In einer kriminologischen Untersuchung aus dem Jahr 1985 zur Körperverletzung bei Fußballspielen wurde die Verdoppelung der Platzverweise in der Bundesliga von der Saison 1982/83 auf die Saison 1983/84 (11 zu 21) als „Indiz für wachsende Härte und Brutalität im Kampf auf dem grünen Rasen“ gewertet. 1987 beklagten die Sportsoziologen Gunter A. Pilz und Wolfgang Wewer, dass auf den Fußballplätzen nur noch rücksichtsloses Erfolgsdenken herrsche und dies nicht nur zu einer Zunahme, sondern auch zu einer zunehmenden Tolerierung des Foulspiels geführt habe: „Taktische Fouls (z.B. Verhindern einer Torchance) werden nicht mehr als unfair, sondern als notwendig angesehen, gerechtfertigt und als ‚faire Fouls‘ akzeptiert.“
Die These, dass sich eine Sportmoral durchgesetzt hat, die Regelverletzungen im Interesse des sportlichen Erfolgs legitimiert, ließe sich durch weitere Platzverweis-Statistiken erhärten. Vergleicht man die Saison 1982/83 mit der Saison 1991/92 (11 zu 76), dann hat sich in einem Zeitraum von neun Jahren die Härte in der Bundesliga versiebenfacht! Doch die Zahlen täuschen. 40 der 76 Platzverweise von 1991/92 gingen auf das Konto der soeben eingeführten gelb-roten Karte, mit der ein bereits bestrafter Spieler, der nach einer weiteren mittelschweren Grobheit noch mal gelb erhielt, vom Platz musste. Eine weitere Steigerung auf den Rekordwert von 98 roten und gelb-roten Karten gab es 1994/95, als die FIFA das Verbot der „Grätsche“ einführte. Der Nationalspieler Wolfgang Rolff, kein Freund des sanften Spiels, gehörte damals zu den vielen, die den Verlust schmissiger Tacklings betrauerten: „So macht Fußball keinen Spaß mehr.“ Doch die Spieler gewöhnten sich daran. Die Zahl der Platzverweise fiel bereits in der Folgesaison und blieb seitdem relativ konstant (zwischen 60 und 80 pro Spielzeit).
Die Steigerung der Platzverweis-Quote im Lauf der 1980er Jahre ist signifikant. Gleichwohl kann sie eine Zunahme der Brutalität auf den Fußballplätzen nicht belegen und schon gar nicht, wie manche behaupteten, eine Tendenz zum Härterwerden der Auseinandersetzungen in der Gesellschaft überhaupt. Feststellen lässt sich lediglich, dass sich in dieser Zeit die Wahrnehmung der Gewalt änderte. Jedenfalls korrespondiert die Vermehrung und Differenzierung der Strafen auf dem Platz dem gleichzeitigen Bestreben, das Fußballspiel insgesamt von dem Geruch einer schmuddeligen, nur für Arbeiter und Proleten geeigneten Sache zu befreien. Während man die Profis zu einem zivilisierter und sauberer wirkenden Spiel anhielt, begann man damit, neue und schönere Stadien zu bauen, die Gewalttäter und Underdogs auf den Rängen hinauszutreiben und die saturierte Mittelschicht hereinzubitten. Im Ergebnis hatte man auf den Rängen und auf dem Rasen nicht mehr, sondern weniger Gewalt. Insofern muss dann die Zunahme der Platzverweise eher als Indiz für das Gegenteil herhalten, nämlich das Sanfter-Werden des Spiels.
Dereinst ging es auf den Fußballplätzen wesentlich härter zu. Und die „Fußball-Fachsprache“ hielt für den gewalttätigen Aspekt des Spiels eine Fülle von Ausdrücken bereit, die heute nur noch selten Verwendung finden: Einsteigen, fällen, hacken, holzen, kaltstellen, kloppen, knüppeln, schruppen, strecken, umlegen, umnieten. Seit der Fußball-Steinzeit war Gewalt ein beinahe natürlicher Bestandteil des Spiels. Manchen konnte es gar nicht genug sein. In den 1890er Jahren, als das Spiel Newton Heath F.C. gegen Burnley mit der Bemerkung angekündigt wurde, dass die örtlichen Beerdigungsunternehmer sicher wieder eine Sonderschicht würden einlegen müssen, beschwerte sich der Fußballveteran W.J. Oackley sogar noch über die angeblich verzärtelten „Milch- und Wasserspieler der Gegenwart“. Im Jahr 1910 berichtete eine deutsche Tageszeitung den noch recht wenig sportkundigen Lesern, dass beim Fußballspiel „Fußtritte in den Unterleib mit nachfolgenden Blasenbrüchen, Darmbrüchen und Unterleibsentzündungen“ an der Tagesordnung seien. Der Artikel mag übertrieben gewesen sein. Tatsache ist, dass der 17-jährige Dixie Dean, der später zum erfolgreichsten englischen Torjäger aller Zeiten avancieren sollte, von einem Gegenspieler so schwer in den Unterleib getreten wurde, dass ihm ein Hoden entfernt werden musste.
Schiedsrichter hatten damals weit mehr Mühe, brutales Spiel zu unterbinden. Manch einer sah sich genötigt, die Männer trauriger Berühmtheit schon vor dem Anpfiff einzuschüchtern. Vor dem englischen Cup-Finale 1920 kam Schiedsrichter Jack Howcroft in die Kabine von Aston Villa und warnte den berüchtigten Frank Barson: „Bei der ersten falschen Bewegung, die du machst, Barson, fliegst du vom Platz.“ Der deutsche Schiedsrichter Peco Bauwens hatte im Wiederholungs-Endspiel um die Deutsche Meisterschaft im Jahr 1922 in Leipzig (das erste Spiel war beim Stand von 2:2 n.V. abgebrochen worden) nach dem Anpfiff mit Ermahnungen der Mannschaftsführer vergeblich versucht, die „scharfe Note“ aus dem Spiel zu nehmen. Erst verwies er den Nürnberger Boes, der den am Boden liegenden Hamburger Beier in den Bauch getreten hatte, vom Platz, dann eskalierte die Sache in der Verlängerung. Der Nürnberger Kugler schied verletzt aus, wenig später erteilte Bauwens dem bereits mehrfach negativ aufgefallenen Clubspieler Träg, der Beier mit Wucht in den Rücken gestoßen hatte, einen Platzverweis. „Die Handlung war derart gemein, dass ich nahe daran war, das ganze Spiel jetzt schon abzubrechen“, so Bauwens. Der Abbruch erfolgte schließlich vor Beginn der zweiten Verlängerung beim Stand von 1:1, als Popp wegen völliger Erschöpfung ausscheiden musste und die Nürnberger damit regelwidrig weniger als acht Mann auf dem Platz hatten. Die Nürnberger gaben zwar auch jetzt noch nicht auf und verteilten unter anderem Postkarten, die sie als „Meister des Jahres 1922“ auswiesen, doch bis heute wird, einmalig in der deutschen Fußballgeschichte, für dieses Jahr kein Meister geführt. Nach einigem Hin und Her hatte der Hamburger SV den ihm schließlich am grünen Tisch zugesprochenen Titel abgelehnt.
Die „fränkische Brutalität“ war 1922 wegen eines scharf durchgreifenden Schiedsrichters nicht erfolgreich. Anders lief es bei der WM 1934, als die von schwachen Unparteiischen nicht gestoppten Italiener mit hemmungsloser Brutalität bis ins Endspiel vordrangen. Vorübergehend von Spanien gestoppt (1:1), konnten sie mit derben Mitteln wenigstens das Wiederholungsspiel für sich entscheiden, weil sieben Spanier – unter ihnen die Torwart-Legende Zamora – auf der Strecke geblieben waren. Im Halbfinale wurde Österreichs Supertechniker Sindelar rüde ausgeschaltet. Der schmächtige Stürmer wusste zwar selbst seinen Körper einzusetzen – „allein mit’n Schmäh“, sagte er einmal, sei das Toreschießen auch „net immer gangen“ –, doch gegen den hünenhaften Monti hatte er keine Chance. Im Finale schließlich zeigten die von Diktator Mussolini angetrieben Azzurri den Tschechoslowaken, wie man mit einer bis zur Rücksichtslosigkeit gehenden Härte Weltmeister wird. „Was sich auf dem Rasen abspielte“, so der Kommentar des „Kicker“, „hatte mit Fußball und Sport gar nichts mehr zu tun.“
Wenige Wochen später, am 14. November, folgte in London gegen England die „Battle of Highbury”. Wieder stand Luisito Monti im Zentrum des Geschehens, diesmal allerdings als Opfer. Wenige Minuten nach dem Anpfiff brach er sich bei einem Zusammenstoß mit dem Engländer Ted Drake den Fuß. Während Monti ins Hospital abtransportiert wurde, traten seine Kameraden gegen alles, was sich bewegte, Kapitän Hapgood wurde die Nase gebrochen. Die Engländer antworteten mit Remplern und wilden Tacklings – insbesondere Wilf Copping sprang den Italienern immer wieder mit beiden Füßen voran in die Parade – blieben aber ansonsten cool und erzielten recht mühelos drei Tore. Die zweite Halbzeit verlief dann etwas friedlicher, die Italiener spielten zwischendurch ein wenig Fußball und kamen noch auf 2:3 heran. Geblieben ist hernach aber der Eindruck einer Schlacht. Ein britischer Journalist unterschrieb seinen Bericht mit den Worten: „Von unserem Kriegskorrespondenten“.
Die Chronik brutaler Spiele ließe sich mühelos verlängern. Bei der WM 1962, die als „Beton-Turnier“ in die Annalen einging, waren die Auseinandersetzungen regelmäßig härter als die Knochen der Spieler. Auch beim Turnier von 1966 in England herrschte oft „böser Fußball“, vorgetragen diesmal vor allem von den Tretern aus Argentinien und Uruguay. Zum Sinnbild des Bösen wurde allerdings, nicht ganz gerecht, der als „Staubsauger“ vor der Abwehr agierende Engländer Nobby Stiles. Das hatte auch mit seiner Spielweise, vor allem aber mit seinem Aussehen zu tun: Vor jedem Spiel legte der kurzsichtige „Giftzwerg“ Stiles (166 cm groß) sein Gebiss ab, um mit spitzen Schneidezähnen seinen Gegner „anzulächeln“. Nach 1966 ging es bei den Weltmeisterschaften zwar ebenfalls nicht immer fair zu, doch zu solch hemmungslosen Knüppeleien und Wutausbrüchen, wie sie dort etwa die Spieler Uruguays im Match gegen Deutschland gezeigt hatten, sollte es nie mehr kommen. Das lag einerseits daran, dass Fouls nun differenzierter bestraft wurden (bei der WM 1970 wurde die gelbe Karte eingeführt), anderseits hatte es mit einer Veränderung der Einstellung zum Foulspiel zu tun.
Die Fouls der Uruguayer waren „dumm“ und überflüssig. Troche foulte weitab vom Spielgeschehen Emmerich und erhielt dafür die rote Karte. Bevor er den Platz verließ, verpasste er Seeler noch eine Ohrfeige. Wenig später konnte Silva, der nach einem ungestümen Foul an Haller ebenfalls „Rot“ gesehen hatte, nur mit Hilfe eines Bobbys vom Platz geführt werden. Die emotional aufgeladenen Urus hatten ihre Nerven nicht im Griff und schadeten sich am Ende selbst. Ihre Härte war zwar beabsichtigt und zielstrebig, viele Fouls wurden aber aus der augenblicklichen Erregung heraus begangen. Vor allem wegen undisziplinierten Verhaltens also hatten sie zwei Mann und am Ende das Spiel mit 0:4 verloren.
In Europa, vor allem in England, pflegte man eine andere, diszipliniertere „Foulspiel-Kultur“. Dort war man zwar ebenfalls nicht zimperlich, aber man akzeptierte das Foul als Konsequenz einer kompromisslosen und mit ganzem Körpereinsatz geführten Auseinandersetzung. Nach dem Motto: „Wo gehobelt wird, fallen Späne“, nahm man es mit stoischer Miene hin, wenn eine Grätsche mal danebenging und die Knochen aufeinander krachten. Eine „mannhafte“ Einstellung dieser Art war vor allem unter den englischen (Arbeiter-) Profis bis nach dem Zweiten Weltkrieg verbreitet. Der Spieler sollte ehrlich und aufrichtig, aber auch hart und robust sein (tough); es wurde ausgeteilt, gleichzeitig sollte jeder aber auch Schmerzen ohne Jammern ertragen. Typisch war etwa die Aussage des knochenharten Verteidigers Frank Barson, der noch nach vier gebrochenen Nasen und zwei schweren Rückenverletzungen sagte, dass er sich vor keinem Zusammenstoß gedrückt habe und immer „mit mehr Respekt für den Mann, der mich niederstreckte“, wieder aufgestanden sei. So hart das Spiel auch war, es beschwerte sich keiner, auf Effekthascherei jeglicher Art wurde verzichtet, eine hinterlistige Spielweise – etwa das Vortäuschen von Verletzungen, Zeitschinden, verstecktes Foulspiel – war verpönt. Auf ähnliche Weise lässt sich der Arbeiterfußball der 1950er Jahre in Deutschland charakterisieren. Man kämpfte hartnäckig und gab keinen Zweikampf verloren, man führte Attacken mit aller Entschlossenheit und ohne Schonung des Gegners durch, aber man schonte auch sich selbst nicht und beschwerte sich nicht über den Gegner. Kurz, der Fußball war damals ein Abbild der Arbeit selbst: hart, aber ehrlich.
Der Vorstopper „Katsche“ Schwarzenbeck bewunderte noch 1972 die Einstellung der Engländer. Nach dem historischen 3:1-Sieg in Wembley stellte er fest: „Dieser Chivers war natürlich schon ein gewaltiger Brocken. Wenn ich mich hinter ihn stellte, hat man bestimmt nichts von mir gesehen, obwohl ich auch nicht gerade schwindsüchtig bin. 88 Kilo und ein Antritt wie ein Sprinter. Es gibt in Deutschland Leute, die behaupten, dass da, wo ich hinlange, kein Gras mehr wachse, aber ich garantiere ihnen, dass dieser Chivers ohne zu wackeln mehr verträgt als eine Plakatsäule. Da kann man hinlangen, wie man will, aber ich meine, dass es auch ein Beweis dafür ist, dass viele Mittelstürmer bei uns absichtliche Bauchlandungen machen, nur um mich zum Buhmann abzustempeln.“
Bei der WM 1954 hatte Ferenc Puskas, als er sich im Spiel gegen Korea nach einem Zusammenprall scheinbar vor Schmerzen krümmte, die Schwalbe noch als Gag für die Galerie inszeniert: „Der Schiri unterbrach das Spiel und lief besorgt zu ihm hin“, erzählte der Augenzeuge Max Morlock, „da hüpfte Puskas fröhlich auf, grinste über das ganze Gesicht und lief weg. Der Schiedsrichter und die Koreaner sahen sich verdutzt an und konnten sich nur noch über das große Talent eines verhinderten Schauspielers wundern.“ Die absichtliche Bauchlandung, die Simulation eines Fouls, geriet als ernste Angelegenheit erstmals beim WM-Halbfinale 1970 zwischen Deutschland und Italien ins Blickfeld der Weltöffentlichkeit. „Das ist ja entsetzlich, das ist ja widerlich“, schimpfte Radioreporter Kurt Brumme in sein Mikro, als die Italiener immer wieder schreckliche Verletzungen simulierten. „Burgnich ist soeben verstorben“, witzelte er gequält, und musste sich gleich wieder korrigieren: „Nein, da kommt er wieder.“ Aber auch die Deutschen sollte das Schwalbenfieber rasch ergreifen. Der Frankfurter Bernd Hölzenbein muss sich bis heute gegen den Vorwurf verteidigen, dass er den Elfmeter, der im Finale 1974 zum 1:1-Ausgleich Deutschlands gegen die Niederlande führte, erschwindelt habe. Im Mai 2005 lief er demonstrativ mit dem Trikot seines Gegenspielers Wim Suurbier herum und erklärte dem „Kicker“: „Wäre es kein Elfer gewesen, hätte es nach dem Abpfiff bestimmt keinen Trikottausch gegeben.“
In England ist die Schwalbe, die dort „Diver“ genannt wird, bis heute verpönt. Während kein englischer Profi auf die Idee käme, als Antwort auf ein rasantes Tackling vorzeitig zum Flug abzuheben, hat das simulierte Foul in anderen europäischen Ligen mittlerweile solche Ausmaße angenommen, dass man als Zuschauer sich schon fast genötigt sieht, die kunstvollen Schauspielereien zu bewundern. Im ursprünglichen „Schwalbennest“, in Italien, haben sie derart überhand genommen, dass sich der italienische Verband zu Beginn der Saison 2005/06 sogar genötigt sah, Foul-Betrüger nach TV-Beweis mit Sperren von mindestens zwei Spielen zu belegen. In Deutschland, wo das Elfmeterschinden vom Schiedsrichter nur direkt im Spiel geahndet werden kann, hat sich diese begrüßenswerte Idee noch nicht durchgesetzt. So bleibt Andreas Möller bis heute der einzige Bundesligaspieler, der nach einer Schwalbe gesperrt wurde: Im Jahr 1995 war dem dilettierenden Schauspieler ein „Luftsprung“ im Strafraum so offensichtlich misslungen, dass sein anschließender Schwur, wirklich gefoult worden zu sein, die grobe Unsportlichkeit erst perfekt gemacht hatte.
Die Perfektionierung der „Fallsucht“ in betrügerischer Absicht ist die neueste Variante der „coolen“ – oder skrupellosen – Spielweise, die sich seit den 1970er Jahren im Profifußball durchsetzte. Man foulte immer weniger aus der Hitze des Kampfes heraus oder mit offenem Visier, sondern immer mehr aus kühler Berechnung. Das hatte zwar eine Verringerung der Brutalität zur Folge, zugleich aber bedeutete es auch eine Veränderung des Spielverständnisses. Nun hieß es: Wer zu brutal tritt, dem fehlt die Cleverness. Als „professionell“ hingegen ist seitdem dasjenige Foulspiel akzeptiert, das zwei Dinge vermeidet: den Platzverweis für den Foulenden und die Verletzung des Gefoulten. Vernünftige Profis rechnen damit, dass die Gegner genauso wie sie selbst notfalls auch mit unerlaubten Mitteln zum Erfolg kommen wollen; sie wollen sich aber zugleich darauf verlassen, dass schwere Verletzungsfolgen nicht vorsätzlich in Kauf genommen werden. Fouls, die sie zu Sportinvaliden machen, akzeptieren sie nicht – denn dies wäre eine eklatante Verletzung der Profisolidarität, die sich aus ihrer Eigenschaft als „Unterhaltungsarbeiter“ ergibt. Ein Beispiel für ein klassisch-professionelles Foul gab Michael Ballack im Halbfinale der WM 2002 gegen Südkorea. Mit einem taktischen Foul vereitelte er eine Chance des Gegners und sicherte so seinem Team den Einzug ins Finale. An dem konnte er dann selbst nicht mehr teilnehmen, weil er durch die zweite gelbe Karte, die er sich damit eingehandelt hatte, gesperrt war.
Das weit verbreitetste Foul ist inzwischen – entwickelt als Folge des Grätschen-Verbots der FIFA vom Jahr 1994 – das Halten und Zerren an Hemd und Hose. „Früher kam die Grätsche“, schrieb der „Kicker“, „gnadenlos. Auch von hinten. Ist heute nicht mehr erlaubt. Deshalb haben sich die Herren Bundesliga-Profis etwas anderes einfallen lassen: Grapschen statt grätschen. In jedem Spiel werden die Trikots auf ihre Festigkeit geprüft.“ Zugleich geht das Zerren am Trikot einher mit dem bereits attestierten Hang zu Simulation: An jedem Bundesliga-Wochenende fallen die Stürmer bei der kleinsten Berührung so theatralisch, als habe sie gerade die Faust des amtierenden Box-Weltmeisters getroffen.
Seit einiger Zeit ist der Griff nach dem Trikot wieder seltener zu sehen. Die Verteidiger sind nicht zahmer, aber die Textilien sind inzwischen hauteng geworden. So bleibt kaum eine Chance mehr, einen Zipfel von des Gegners Wäsche zu erhaschen, und die Abwehrspezialisten erledigen ihre Arbeit wieder mehr mit den Füßen. Vorsichtig zu Werke gehen müssen sie trotzdem, da oft schon der Hauch einer Berührung genügt, um einen Pfiff des Schiedsrichters auszulösen.
Zweifelsohne ist nach wie vor ein Grundgehalt von Gewalt mit im Spiel, doch über weite Strecken spielt sie nur noch zum Schein ein Rolle. Aus dem Kampfspiel droht daher ein Simulationsspiel zu werden, in dem das Foul, das gar keines ist, zum zentralen Moment einer psychologischen Kriegführung wird. Heute sind nicht mehr die Stürmer die armen Schweine, weil sie so viel gefoult werden, sondern die Gelackmeierten sind die Verteidiger, die für Fouls bestraft werden, die sie gar nicht begangen haben.
So ist zusammenzufassen: Paradoxerweise hat gerade die Angst vor dem unfairen Spiel zu einer Erweiterung des Spielraums für Betrügereien geführt. Erst die permanente Ausweitung des Strafauftrags und der Strafgewalt der Schiedsrichter, erst die härtere Ahndung des Foulspiels, erst die Gefahr, dass der Elfmeterpfiff flott erfolgt, erst das Risiko, dass gelbe, gelb-rote und rote Karten schnell gezückt werden, provoziert die Versuchung, einen Vorteil zu Lasten des Gegners herauszuschinden. Es könnte daher durchaus sein, dass der Fußball zu der Zeit, als die Spieler einander noch hart und ehrlich bekämpften, im Grunde fairer war als heutzutage.