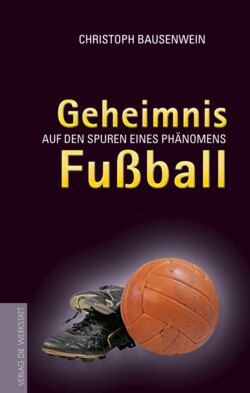Читать книгу Geheimnis Fussball - Christoph Bausenwein - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSYSTEME
Es kann mit Recht in Frage gestellt werden, ob jede Mannschaft mit System spielt. Fest steht aber, dass jede ein System hat. In den 1970er Jahren begann der Autor dieser Zeilen seine eigene bescheidene Fußballer-Karriere in der C-Jugendmannschaft der Sportvereinigung Nürnberg-Ost im damals festgeschriebenen 4-3-3-System. Wir spielten mit zwei Außenverteidigern (Nummer 2 und 3), einem „Libero“ (Nummer 5) plus Vorstopper (Nummer 4) in der Abwehr, zwei Läufern (Nummer 6 und 8) und einem Spielmacher (Nummer 10) im Mittelfeld, vorne mit zwei Außenstürmern (Nummer 7 und 11) und einem Mittelstürmer (Nummer 9). Eine Zeit lang wurde unser Team von einem älteren Mann trainiert, der in seinen taktischen Vorbesprechungen die Begriffe „Mittelläufer“ und „Halbstürmer“ verwendete. „Du spielst den Mittelläufer“, sagte er zu einem meiner Mitspieler. „Du spielst auf halbrechts“, wies er mich an. Zu einem Dritten sagte er: „Du machst den rechten Läufer!“
Das war alles etwas verwirrend. Den Mittelläufer konnte man noch identifizieren. „Der meint halt den Libero“, machte man sich klar – auch wenn das Team damals nicht eigentlich mit einem Libero spielte, sondern mit einem Ausputzer, der die Bälle hinten rausschlug und nie die Mittellinie überschritt; aber das war eben die Position Beckenbauers und der spielte „Libero“. Schwieriger war es mit den „Halbstürmern“. Rechts gab es einen Verteidiger, einen Läufer, einen Außenstürmer. Auch die Position des Spielmachers im zentralen Mittelfeld war bereits besetzt. Mir war ziemlich unklar, wo nun ich meinen Platz finden sollte, und ich lief daher mit dem unbestimmten Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmen konnte, auf den Platz.
Heute kann ich mir klarmachen, was passiert war. Der Trainer hatte die in den 1970er Jahren übliche Aufstellung des 4-3-3 überlappt mit dem traditionellen 2-3-5-„Pyramiden“-System und dabei Positionen aus beiden Systemen verteilt. Mit diesem alten System war der traditionsreiche Arbeiterverein SpVg (damals TuS) Nürnberg-Ost im Jahr 1932 vor 30.000 Zuschauern in Nürnberg mit einem 4:1 über Cottbus 1893 letzter Meister des Arbeiter-Turn- und Sportbundes geworden. Beim englischen Cupfinale von 1933, als die Spieler erstmals mit Rückennummern aufgelaufen waren, hatte man sie von hinten rechts bis vorne links so durchnummeriert: 2 (rechter Verteidiger), 3 (linker Verteidiger), 4 (rechter Läufer), 5 (Mittelläufer), 6 (linker Läufer), 7 (Rechtsaußen), 8 (Halbstürmer rechts), 9 (Mittelstürmer), 10 (Halbstürmer links), 11 (Linksaußen).
Damit die Aufstellung des Trainers hätte funktionieren können, hätten wir mit zwölf statt mit zehn Feldspielern antreten müssen: Eben mit allen Positionen des 4-3-3 plus zwei Halbstürmern. Es ist davon aus-zugehen, dass unser Systemtheoretiker zwei Spielern doppelte Positionen gegeben oder aber zwei Positionen schlicht vergessen hat. Da relativ unwahrscheinlich ist, dass zwei Spieler ohne Murren sich auf „Doppelpositionen“ haben aufstellen lassen, muss er wohl zwei Positionen unbesetzt gelassen haben. Welche das waren, kann ich heute nicht mehr sagen. Ganz offensichtlich ist nur, sofern man regulär mit zehn Feldspielern antritt: Man kann nur entweder mit Läufern oder mit Halbstürmern spielen, wenn man zugleich vier Leute in der Abwehr haben will.
Damals war mir das allerdings nicht auf Anhieb klar. So lief ich also, ein starker Läufer (im leichtathletischen Sinne), auf den Platz und suchte meine Position in Abstimmung mit dem nominierten Läufer. Das Problem löste sich dann überraschend schnell, als der Gegner im Angriff war. Jeder suchte sich einfach seinen Mann, und so kamen wir in der Defensive dann ganz gut zurecht. Wenn wir selbst in Ballbesitz waren, wurde es komplizierter. Da musste man sich von seinem Mann lösen, sich freilaufen, bestimmte Wege gehen, sich anbieten. Und wenn einer vorging, musste er sich mit dem Nachbarn absprechen, damit der sich dann zurückfallen ließ. Wir haben also immer aufeinander geachtet und sind viel gelaufen. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel ausging; nur so viel, dass wir uns jedenfalls nicht dramatisch blamiert haben.
Eine der Erfahrungen, die ich aus diesem Spiel hätte mitnehmen können, ließe sich so formulieren: Das System ist nicht alles; es kommt vor allem darauf an, wie man sich auf dem Platz bewegt. Das war auch früher schon so, als man nicht, wie die Jugendmannschaft der SpVg Nürnberg Ost, in einem zwei-, sondern in einem eindeutigen System zu spielen pflegte. Der allseits geachtete Experte Willy Meisl formulierte 1928 die Ansicht, dass die „Passpyramide“ das „letztgültige“ System sei: Die Aufstellung des 2-3-5, so seine Meinung, „ist nicht vorgeschrieben und könnte daher durchaus geändert werden; aber sie wird es nicht, weil sie … sich als die zweckmäßigste erwiesen hat.“ Tatsächlich spielten noch in den 1930er Jahren fast alle mitteleuropäischen Teams nach diesem alten System mit Mittelläufer, obwohl Herbert Chapman in England den Fußball bereits mit dem W-M-System revolutioniert hatte. Einige Teams entwickelten im klassischen System einen sehr erfolgreichen Stil. In Schalke „kreiselte“ man, in Wien „scheiberlte“ man. Während die Schalker um den Ballverteiler und Ideengeber Fritz Szepan eher nüchtern und zielstrebig die Lücke suchten, neigten die Österreicher des „Wunderteams“ um den genialen Sindelar zu nicht immer effektiven, dafür aber dann besonders schönen Schnörkeln.
Das Spielprinzip aber glich sich: Um den Mittelläufer in der Zentrale gruppierten sich die beiden Läufer sowie die beiden Halbstürmer und ließen den Ball zirkulieren; im entscheidenden Moment kam dann von einem dieser fünf Spieler der Steilpass auf die Stürmer.
Auch beim 1. FC Nürnberg, der in den 1920er Jahren den deutschen Fußball mit seinem – manchmal, wie es hieß, zur „Überkombination“ neigenden – Flachpassspiel dominiert hatte, war es ähnlich zugegangen. Interessant ist nun, dass sich die genannten Teams im Spiel aus dem System sozusagen „herausspielen“ konnten. Die Nürnberger bewegten sich bei ihren oft noch recht gemächlich vorgetragenen Ballstafetten im Angriff bereits 1924 intuitiv in einer „W“-Formation. Darin zeigt sich: Die Aufstellung allein sagt noch nicht alles darüber aus, wie ein Team sich dann bewegt. Die Clubspieler hatten aus der Praxis Wege entwickelt, die sie theoretisch eigentlich noch gar nicht hätten kennen sollen. Vorne lauerten die drei Stürmer auf einer Linie; einige Meter dahinter agierten die Halbstürmer; noch einige Meter dahinter rückten die drei Läufer mit dem zentralen Ballverteiler Kalb auf. In der Offensive unterschied sich die Spielweise also gar nicht so sehr von dem, was Chapman später im W-M-System mit Arsenal praktizieren lassen würde.
Als Otto Nerz in den 1930er Jahren das W-M-System in der deutschen Nationalmannschaft einführte, buhte das Publikum dennoch lautstark. Denn jetzt kam das defensive „M“ hinzu, das den Mittelläufer als zurückgezogenen Stopper in die Abwehr verdammte. Niemand wollte es verstehen, wie man den „besten Mann“ zum Manndecker machen konnte. Hans Kalb, ehemaliger Mittelläufer des 1. FC Nürnberg, wetterte gegen die „Dressur“, die das neue System dem Einzelnen abverlange: „Mit ihm richtet man die Individualisten – und jeder herausragende Sportler ist Individualist – wie Polizeihunde ab. Sport muss auch im Verband einer Mannschaft Vergnügen und Lebenslust sein. Mit dem System des Mauerns aber diktiere ich dem Dreh- und Angelpunkt einer Mannschaft: Mauert um jeden Preis, auf dass ihr ja nicht verliert!“
Chapmans Motto war dem Kalb’schen völlig entgegengesetzt: „Wenn es uns gelingt, ein Tor zu verhindern, haben wir einen Punkt gewonnen. Schießen wir aber zudem ein Tor, dann haben wir beide Punkte.“ Chapman ging es, wie bereits geschildert wurde, in erster Linie um die Stärkung der Defensive. Es galt, die durch die neue Abseitsregel von 1925 entstandenen Lücken zu schließen, und zu diesem Zweck wurde der zentrale Aufbauspieler, der Mittelläufer, geopfert. Insofern ist Kalbs Kritik also verständlich; doch konnte man in Deutschland damals noch nicht sehen, welche offensiven Möglichkeiten das neue System bot. Denn anstelle des Mittelläufers gab es jetzt ja zwei Halbstürmer im offensiven Mittelfeld. Während der rechte etwas defensiver agierte, wurde der linke, der mit der späteren Nummer „10“, zum Spielmacher. Diese Rolle nahm im Team Arsenals der 1930er Jahre der herausragende Alex James ein, über den die meisten Angriffe vorgetragen wurden.
Die im W-M-System angelegte und für die weitere Entwicklung des Fußballs entscheidende Neuerung waren aber weder Stopper noch Spielmacher, sondern ganz grundsätzlich die Etablierung des Mittelfeldes als eigener Bestandteil des Systems. Die beiden offensiv ausgerichteten Halbstürmer bildeten zusammen mit den defensiven Läufern ein „magisches Quadrat“. Dadurch eröffneten sich neue Spiel-Räume und ein zuvor nicht gekannter Variantenreichtum in der Spielanlage. In der pyramidalen Dreieck-Aufstellung lief der Spielaufbau immer über nur eine zentrale Figur in der Mitte. Das war durchschaubar, die Möglichkeiten waren begrenzt, außerdem blieben auf dem Platz viele unbespielte – sozusagen „leere“ – Flecken. Mit dem Mittelfeld-Quadrat aber hatte die Idee, das Feld in seiner ganzen Breite und Tiefe auszunutzen, Fuß gefasst. Stück für Stück konnten nun die im Fußball angelegten Kombinationsmöglichkeiten entwickelt werden. Kurz: Weniger die Erfindung des W-M-Systems selbst hatte den Fußball revolutioniert, sondern vielmehr die dadurch bewirkte Entdeckung des Raums. So setzte sich allmählich die Erkenntnis durch, dass eine Mannschaft viel mehr erreichen konnte, wenn sich die Spieler nicht mehr auf fest vorgegebenen, sondern auf möglichst variablen Wegen bewegten. Die Aufstellungssituation zu Spielbeginn definierte immer weniger das gesamte Spielprinzip und reduzierte sich mehr und mehr zu einer Orientierungshilfe.
Die Ungarn demonstrierten als Erste, was nun möglich geworden war. Am 25. November 1953 verlor England gegen Ungarn und damit zum ersten Mal gegen eine nicht-britische Mannschaft ein Heimspiel. „Beim 3:6 bleibt vor allem für Mittelläufer Johnston ein Mirakel, wie er gegen den zurückgezogenen Mittelstürmer Hidegkuti spielen soll“, formulieren Christoph Biermann und Ulrich Fuchs: „Ihm ins Mittelfeld folgen und hinter sich Löcher lassen oder Hidegkuti aufspielen lassen?“ Johnston, der seine Deckungsaufgabe nicht erfüllen konnte, war in dem Spiel mehr oder weniger „verschenkt“. Die Engländer waren schon allein durch diese ungewohnte Situation durcheinander. Dazu kam, dass die Ungarn auf die jeweilige Entwicklung der Spielsituation flexibel reagierten. Sie klebten nicht auf ihren Positionen fest, sondern wechselten und rochierten. Wenn Rechtsaußen Budai nach innen zog, gab Rechtsverteidiger Buzanszky den Rechtsaußen. Die beiden spielten also ganz modern, „überlappend“, wie man heute sagt. Umgekehrt ließ sich nicht nur der „hängende“ Mittelstürmer Hidegkuti zurückfallen, sondern auch die Außenstürmer Czibor und Budai halfen immer wieder hinten aus. „Wir haben ständig die Positionen getauscht; wo wir beim Anstoß standen, war völlig irrelevant“, fasste Nandor Hidegkuti zusammen.
Der Erfolg der Ungarn wurde wenig später im Rückspiel gegen die Engländer noch einmal eindrucksvoll bestätigt. Sie gewannen mit 7:1, und diesmal machten sie statt Johnston einen Mann namens Owen besonders unglücklich. „Ich konnte diese Burschen niemals richtig tackeln“, stellte er resigniert fest. „Wann immer ich sie attackierte, spielten sie den Ball vorher einem besser postierten Nebenmann zu.“
Die Engländer hatten immer noch kein Mittel gefunden gegen diese mit schnellen Positionswechseln ergänzte Variante des Kurzpassspiels. Dabei war die Sache im Prinzip gar nicht so schwer zu verstehen. „Wenn wir ein Geheimnis hatten“, erläuterte Rechtsverteidiger Buzanszky, „dann das, dass wir schon damals im Schnitt um ein- bis zweitausend Meter mehr gelaufen sind bei den Fußballspielen als unsere Rivalen, und wir konnten füreinander kämpfen.“ Und dann kam natürlich auch noch das herausragende balltechnische Vermögen der einzelnen Spieler hinzu.
Das System – oder besser: die Methode – der Ungarn gelangte vermutlich über den ungarischen Trainer Bela Guttmann nach Brasilien, ins Land des künftigen Serien-Weltmeisters. Jedenfalls war der ab 1956 in Sao Paulo tätig; und irgendwoher mussten die Brasilianer ja ihr 1958 praktiziertes 4-2-4-System haben, das die Experten als Weiterentwicklung der ungarischen Variante interpretieren. Aber was heißt 4-2-4-„System“? Entscheidend für den Erfolg war nicht die nominelle Verteilung, sondern die Bewegung im Raum. Sie deckten tief gestaffelt, immer ballorientiert. Und sie verschoben sich je nach Spielsituation wie eine Ziehharmonika: Beim Verteidigen zogen sie sich zusammen, beim Angriff verteilten sie sich blitzartig im Raum. Und nicht zuletzt: Sie waren alle perfekt am Ball.
Die Brasilianer waren auch gut in der Defensive, aber sie verließen sich nicht allein auf die Abwehrarbeit. Andere Teams trafen da eindeutigere Entscheidungen. Eine gezielte Stärkung der Defensive hatten in den 1930er Jahren der Italiener Vittorio Pozzo mit seiner „Metodo“ und der Schweizer Karl Rappan mit seinem „Riegel“ entwickelt. Beide Teams waren mit ihrer Philosophie, zusätzliche Sicherungen in die Abwehr einzubauen, erfolgreich. Italien wurde 1934 und 1938 Weltmeister, die Schweizer kegelten bei der WM 1938 das „großdeutsche“ Team aus dem Wettbewerb. Vor allem die Italiener blieben auch nach dem Zweiten Weltkrieg der Defensive treu. Es waren zunächst die kleinen Klubs, die das Verteidigen perfektionierten, um gegen die großen eine Chance zu haben. Bei Salernitana zog Gipo Viani den Mittelstürmer in die Abwehr zurück. Der Journalist Gianni Brera taufte die neue Position auf den Namen „Libero“. In Triest und beim AC Mailand erprobte Nereo Rocco den „Catenaccio“ in Anlehnung an den Schweizer Riegel. Das Abwehrsystem wurde schließlich von Helenio Herrera bei Inter Mailand adoptiert und dann in den 1960er Jahren berühmt-berüchtigt. Herrera wollte vor allem eines nicht: geschlagen werden. Fünf Defensivspieler – vier Verteidiger und ein Mittelläufer dahinter – sorgten dafür, dass das fast nie geschah. Weitere Spieler mussten sich ebenfalls in die Defensive mit einschalten, so agierte etwa der Linksaußen bei Inter sehr weit hinten. Bei Ballbesitz ging es dann darum, überfallartig nach vorne zu stoßen. Das heißt: Die Außenverteidiger standen zwar hinten, mussten aber auch mit angreifen. Auf diese Weise wurde der linke Verteidiger Giacinto Facchetti zum Prototyp des stürmenden Verteidigers. Führten die Italiener mit 1:0, verschwendeten sie keine Energie mehr und stellten konstruktive Bemühungen oft vollständig ein.
In gewisser Weise war der „Catenaccio“ der Anfang vom Ende der Außenstürmer. In früheren Zeiten blieben die Außenstürmer vom klassischen Typus eines Stanley Matthews einfach stehen, wenn ihr Team gerade nicht in Ballbesitz war. Waren sie bei Ballbesitz gut abgeschirmt und daher nicht anspielbar, konnten sie am Flügel regelrecht „verhungern“. Umgekehrt blieben die klassischen Verteidiger beim Angriff zurück und beobachteten das Spiel aus sicherer Distanz. Im Prinzip hatte Herrera also vor allem „Ausfallzeiten“ reduziert, indem er die Aufgaben der Außenstürmer von den Außenverteidigern mit übernehmen ließ. Englands Trainer Alf Ramsey zog 1966 die Konsequenz, dass er gleich ganz auf traditionelle Flügelspieler verzichtete. Ein Novum war darüber hinaus der „Sweeper“ (Feger) Nobby Stiles, der nicht hinter, sondern vor der Abwehr agierte. Bei Ballbesitz eröffnete er das Spiel aus dem hinteren Mittelfeld heraus.
Das englische System bei der WM 1966 war in der Theorie ein 4-3-3: hinten eine Vierer-Abwehrkette auf einer Linie, davor ein Dreier-Mittelfeld und vorne drei aus dem Zentrum heraus agierende Stoßstürmer. In Deutschland setzte sich wenig später ebenfalls ein 4-3-3 als Prinzip durch, das allerdings etwas anders aufgebaut war. Die Endspiel-Aufstellung 1974 hatte zwei Außenverteidiger (Vogts, Breitner) sowie Libero und Vorstopper in der Abwehr (Beckenbauer, Schwarzenbeck); im Mittelfeld trieben Hoeneß, Bonhof und Overath, unterstützt von dem immer wieder nach vorne gehenden Beckenbauer, das Spiel an; vorne stürmten Grabowski (rechts), Müller und Hölzenbein (links). Vom klassischen W-M-System unterschied sich diese Aufstellung vor allem durch den Verzicht auf die Halbstürmer: Aus dem einen war der Vorstopper, aus dem anderen ein Mittelfeld-Spieler geworden. Der Aufbau des Spiels war relativ statisch. Beckenbauer schaltete sich zwar – nach dem Vorbild des stürmenden Außenverteidigers Facchetti – als offensiver Libero ins Angriffsspiel mit ein, andere Spieler aber klebten an ihren Positionen fest und fielen als reine Verteidiger für das Aufbauspiel praktisch aus.
Auch die Niederländer, der Gegner im Endspiel, spielten nominell im 4-3-3. Aber was für ein Unterschied in der Interpretation! Die „Modernität“ fing ganz hinten an, bei Torhüter Jongbloed, der als erster Offensiv-Torhüter den Ball auch öfter mal mit dem Fuß spielte. Libero Haan kam nicht nur, wie Beckenbauer, sporadisch nach vorne, sondern spielte permanent vor der Abwehr. Die Positionen der Außenstürmer waren zwar besetzt (Rep, Rensenbrink), konnten aber auch von den Außenverteidigern (Suurbier, Krol) übernommen werden. Dann zogen die nominellen Stürmer nach innen. Das konnten sie, weil dort meist Platz war. Der Chef der Niederländer, Johan Cruyff, war nominell nämlich nicht, wie meist angenommen wird, ein Mittelfeldspieler, sondern Mittelstürmer. Er ließ sich aber meist zurückfallen, so dass Platz für andere geschaffen wurde. Wie Cruyff waren auch alle anderen Spieler, dabei immer aufeinander abgestimmt, ständig in Bewegung. In jedem Moment spielten alle mit. Die „Oranjes“ waren ein flexibles, in hoher Geschwindigkeit agierendes Kollektiv, das immer als „Gesamtkörper“ im Spiel blieb. In der Defensive wie in der Offensive verschoben sich alle Spieler ballorientiert – so wie das heute sämtliche Spitzenteams tun.
Ganz anders als bei den Niederländern lief zur selben Zeit das 4-3-3 in der Jugendmannschaft der Sportvereinigung Nürnberg Ost ab. Während die „Oranjes“ den Fußball revolutionierten, spielten wir eine tumbe Manndeckung. Es war ja auch viel einfacher zu verstehen. Manchmal, wenn der Gegner einen sehr starken Spielmacher hatte, hieß es: „Den nimmst du jetzt in Manndeckung.“ Das war eine klare Anweisung. Die Idee war, den besten gegnerischen Mann aus dem Spiel zu nehmen. Man erkannte auch, dass es gar nicht so wichtig war, wenn dann das eigene Läuferspiel nicht mehr stattfand. Falls es gelang, den Gegenspieler zu neutralisieren, waren eben zwei Mann aus dem Spiel genommen; der Rest spielte neun gegen neun. Aber „spielten“ die eigentlich überhaupt? Auch die waren ja in das Prinzip der Manndeckung eingebunden. Der Vorstopper machte es mit dem Mittelstürmer, die Außenverteidiger machten es mit den Außenstürmern, und beim Gegner war es umgekehrt. Wenn der dann auch noch unseren eigenen Spielmacher in Manndeckung nehmen ließ, blieben nur noch zwei „freie“ Spieler übrig: der Libero und der zweite Läufer. Da der Libero aber, wie bereits beschrieben, kein Libero war, lag die ganze Last des Spielaufbaus im Grunde genommen auf den Schultern eines einzigen Spielers. Und bis der dann seinen direkten Gegenspieler fand – auch auf der Gegenseite gab es ja nur noch einen „freien“ Mann – dauerte es nicht lange; und so hatte sich auch noch das letzte Pärchen gefunden, das sich, je nach Ballbesitz, wechselseitig verfolgte.
Wenn einer seinen Gegner verloren hatte und er alleine herumstand, hieß es oft: „Wo ist dein Mann?“ Keinen Mann zu haben, war nicht gut und führte zu Unsicherheit. Man fühlte sich dann irgendwie überflüssig. Und so sah man immer wieder Spieler auf der Suche nach ihrem verlorenen Mann umherhetzen. Keinen Mann zu haben, war nur bei Ballbesitz gut. Dann konnte man durchmarschieren, dann hatte man Platz. Und wenn man vom Gegner angegriffen wurde, konnte man zu dem Mitspieler abgeben, dessen Deckung der gerade aufgegeben hatte. Dieser Fußball war übersichtlich. Er bestand im Wesentlichen aus einem Kampf Mann gegen Mann. Sieger wurde meist, wer die meisten Duelle gewann. Hinten benötigte man bissige Verteidiger, vorne schnelle Flitzer und gute Dribbler, die entweder die Bälle des Spielmachers erlaufen oder ihre Zweikämpfe gewinnen konnten; und einen entscheidenden Vorteil hatte, wer im direkten Laufduell Sieger bleiben konnte.
In dieser Weise wird auch heute noch in den meisten Jugendmannschaften gekickt. Vorteile hat das Team, dem es gelingt, die festen Positionen einmal aufzulösen. Denn wenn einer à la Beckenbauer nach vorne stößt, hat er meist freie Bahn, da die Spieler ihre Positionen nicht verlassen und vor allem die Stürmer es nicht gewohnt sind, sich ins Defensivspiel mit einzuschalten. Im heutigen Profifußball würde sich allerdings ein Libero Beckenbauer im Maschendraht eines im Raum fließend aufgebauten Abwehrriegels verheddern. Heute kann es sich keine Mannschaft mehr leisten, nach einem starren System zu spielen. Heute orientiert man sich in Defensive wie Offensive nicht mehr am Mann, sondern am Ball. Klassische Mittelstürmer, klassische Spielmacher, klassische Manndecker, die nur in bestimmten Situationen am Spiel teilnehmen, sind out. Somit ist das moderne Spiel, weil es jedem Spieler konstruktive Fähigkeiten abverlangt, technisch und taktisch anspruchsvoller geworden.
Das erste deutsche Team, das richtig modern spielte, war der SC Freiburg, der Überraschungsdritte der Bundesliga-Saison 1994/95. Trainer Volker Finke erläuterte damals: „Wir spielen mit jeweils einem Mann auf den Außenbahnen und vor einem Dreier-Abwehrblock, aus dem sich in der Regel ein Manndecker oder der Libero in die Offensive einschaltet, im Zentrum mit drei Mann auf einer Achse. Die verschieben sich ballorientiert.“ Auf der Basis der Grundformation 3-5-2 baute der SC Freiburg mit dem Prinzip strikter Raumdeckung und situationsbedingtem Rochieren ein „System der kurzen Wege“ auf, das eine permanente personelle Überzahl in Ballnähe garantieren sollte. Freiburg hatte den Nachteil, dass man nur durchschnittliche Spieler verpflichten konnte, durch taktische Verbesserungen ausgeglichen. Heute hat sich der Vorsprung aufgebraucht, da alle Teams taktisch nachgerüstet haben. Borussia Dortmund konnte 1995 noch mit einem relativ unflexiblen System Meister werden, weil es die besten Einzelspieler hatte. Heute benötigt man beides: balltechnisch perfekte Einzelspieler und taktische, mit hoher Flexibilität angewandte Disziplin.
Der deutschen Nationalmannschaft des Jahres 2005 mangelte es an beidem. Da gab es einen Torhüter Kahn, der die Bälle einfach nach vorne schlug, statt das Spiel mit Übersicht und sicherem Pass zu eröffnen, sowie einen unbeholfenen Manndecker Robert Huth, der als Anspielstation beim Aufbauspiel ein völliger Ausfall war. In der Bewegung nach vorne auf einen Mann verzichten zu müssen, kann sich aber heute eigentlich kein Team mehr leisten; vor allem dann, wenn auch die anderen Spieler individuelle Qualitätsmängel aufweisen. Man kann dann an dem „richtigen System“ so lange herumtüfteln, wie man will. Ob das 4-3-3 (Vierer-Abwehrkette, zwei defensive und ein offensiver Mittelfeldspieler sowie drei Stürmer) oder das 4-4-2 (Vierer-Abwehrkette, Raute im Mittelfeld und zwei Stürmer) „besser“ ist, bleibt eine akademische Frage. Denn der Erfolg liegt nicht im System begründet. Letztlich bleibt immer entscheidend, wie perfekt – ballsicher, schnell und flexibel – sich die Spieler in permanenter wechselseitiger Abstimmung im Raum bewegen können.