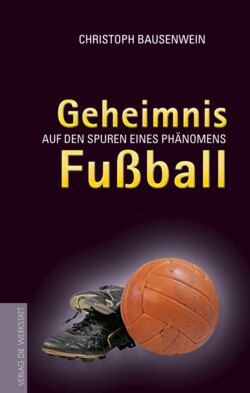Читать книгу Geheimnis Fussball - Christoph Bausenwein - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIM STADION
Für die Zuschauer eines Bundesligaspiels beginnt das Match schon lange vor dem Anpfiff. Wenn sie von zu Hause aufbrechen zum Spiel, sind die meisten bereits von einer Nervosität und Erregung ergriffen, die sich auf dem Weg zum Stadion langsam steigert. Von überall her strömen die Leute zusammen, Busse und Bahnen füllen sich mit Gleichgesinnten. Fast hat es den Eindruck, als kenne am Spieltag die ganze Stadt nur ein Thema und ein Ziel: das Stadion. Das letzte Stück des Weges nehmen alle zu Fuß, und je näher man dem Ziel kommt, desto mehr gehen die einzelnen Gruppen auf in einer dichten Menge, die wie von einem Magneten in dieselbe Richtung gezogen wird. Offensichtlich erwarten sie sich dort etwas ganz Besonderes: Das, was der britische Romancier J. B. Priestley im Jahre 1928 schrieb – dass der Weg durch das Drehkreuz „eine andere und weit prächtigere Art des Lebens“ verspreche –, scheint auch 80 Jahre später nichts von seiner Gültigkeit verloren zu haben.
„Etwas sehr Sonderbares geht in jener engen Durchfahrtsstraße vor, die zum westlichen Teil der Stadt führt“, schrieb Priestley seinerzeit. „Was gerade jetzt so sonderbar scheint, ist, dass die Straße selbst überhaupt nicht zu sehen ist. Eine graugrüne Flut windet sich schwerfällig durch sie dahin. Es ist eine Flut von Stoffmützen.“ Diese Stoffmützen trugen einige Tausend Arbeiter aus den umliegenden Fabriken von Bruddersford, die für einen Schilling ihren Klub, den Vereinigten FC, im Stadion spielen sehen wollten. Damals war der Fußball ein festliches Ereignis für ein recht homogenes Zuschauerpotenzial. Es drängten fast nur Arbeiter ins Stadion, um das Spiel auf engen Stehrängen zu verfolgen, die unbequem waren und darüber hinaus den Nachteil hatten, dass einem die Vorderleute die Sicht auf das Spielfeld versperrten. Der kleine Teil von vornehmeren Leuten, die auf der Haupttribüne ihren Sitzplatz einnehmen sollten, fiel in dieser Masse kaum auf.
Der Schweizer Georges Haldas, Jahrgang 1917, wusste zu berichten, dass die Leute einst vor großen Spielen oft bereits am Morgen, wenn nicht gar am Vortag, um das Stadion herum kampierten. Der Schriftsteller selbst war vor jedem Spiel seines Vereins FC Servette Genf lange vor dem Anpfiff im „Buvette“ des Stadions „Les Charmilles“ zu finden, wo er sich auf das bevorstehende „Match“ einstimmte. Sodann begab er sich auf die noch leeren Ränge und setzte seine Vorbereitungen fort, betrachtete „die noch stillstehende Uhr mit den Namen der beiden sich bald gegenüber stehenden Mannschaften, nach der sich gegen den Schluss der Partie so viele von sonderbarer Angst erfüllte Blicke wenden werden, die einen, weil die letzten Minuten zu schnell verfließen … die andern, weil diese Minuten zu langsam vorbeigehen“. Die Zeit wird beim Fußball ganz verschieden erlebt, je nachdem, welche Mannschaft gerade führt, und je nachdem, für welche man zittert.
Wer Fan einer schlechten Mannschaft ist, muss sich wappnen für die zu erwartenden Enttäuschungen. So erging es Nick Hornby, der schon als Junge kein Spiel seines Vereins Arsenal London im Highbury-Stadion versäumte. „Natürlich hasste ich die Tatsache, dass Arsenal langweilig war“, schrieb er Jahre später in seinem Beststeller „Fever Pitch“. „Natürlich wollte ich, dass die Mannschaft Zillionen von Toren erzielte und mit dem Schwung und Nervenkitzel von elf George Bests spielte, doch das würde nicht passieren, jedenfalls nicht in absehbarer Zukunft.“ Und so bereitete er sich Spieltag für Spieltag auf die Seufzer und das Stöhnen seines neben ihm sitzenden Vaters vor. „Ich war an Arsenal und mein Dad an mich gekettet, und es gab für keinen von uns einen Ausweg.“ Vater und Sohn waren Arsenal-Fans, unentrinnbar, ihrem Team viel mehr verpflichtet als dem Spiel. 1969, als der grandiose George Best für Manchester United in Highbury zwei Tore erzielte, war es besonders schlimm. Hornby konnte sich über die von Best gezeigte Kunst nicht freuen. Der Mann stand in der falschen Mannschaft. „Jedesmal wenn er den Ball erhielt, jagte er mir Angst ein, und ich wünschte damals, genauso wie ich es vermutlich heute noch tue, dass er verletzt gewesen wäre.“ Beim Fußball geht es um was ganz anderes als im Theater. „Wer“, fragt Hornby, „würde eine teure Karte fürs Theater kaufen und hoffen, dass der Star des Stücks unpässlich ist?“
Manche mögen die „falschen“ Stars lieber nicht sehen; sicherlich aber kaufte sich auch ein Nick Hornby vor allem deswegen eine Karte, weil er – eben ganz anders als im Theater – vorher nicht wusste, welches Stück gegeben wird. Umgekehrt langweilte sich der Stückeschreiber Peter Handke wohl manchmal bei den Inszenierungen auf der Bühne. Dann ging er ins Stadion, wo wegen des ungewissen Verlaufs des bevorstehenden Ereignisses immer eine knisternde Atmosphäre herrscht. Die Situation unmittelbar vor Spielbeginn bezeichnete er als den „schönsten Augenblick“ eines Fußballspiels: „Alle halten den Atem an und schauen.“ Warten wir daher noch ein wenig mit dem Anpfiff. Schauen wir uns erst einmal um, wer alles ins Stadion gekommen ist.
„Noch in den Siebzigern waren die Stadien sehr übersichtlich aufgeteilt, in den Fanblock und die anderen“, schrieb das Fanzine „11 Freunde“ im Jahr 2001. „Wer singen und klatschen wollte, stellte sich zu den anderen, die singen und klatschen wollten. Und jeder Fanblock hätte die Idee wohl einigermaßen absurd gefunden, den Nebenmann zu fragen, was er denn bitte sei …“ Die Ersten, die schon in den 1960er Jahren auffielen, waren die Kuttenfans. Sie tragen Trikots des Vereins, den sie unterstützen, nietenbestickte Jeansjacken mit Aufnähern, dazu Mützen und Schals. Sie kommen in Fanklub-Gemeinschaften, feuern ihre Mannschaft lautstark an, begleiten sie zu Auswärtsspielen, liefern sich Sprechchor-Wettkämpfe mit den Fans des Gegners und unterstützen ihren Verein auch in schlechten Zeiten bedingungslos. Nicht zu verwechseln mit den Kuttenfans ist die kleine Gruppe der Hooligans, die seit den 1980er Jahren mit ihren Gewalttaten in die Schlagzeilen kamen. Diese Raufbolde mischen sich unauffällig unter die Zuschauer auf den Sitzplätzen und verabreden sich mit den Hools des Gegners zu Kämpfen. Seit den 1990er Jahren hat die in italienischen Stadien entstandene Ultra-Bewegung viele Anhänger gefunden. Die Italiener entwickelten eindrucksvolle Choreographien mit Fahnen, Transparenten, Papptafeln, Feuer und Rauch. In Deutschland fühlen sich die Ultras als die einzig unabhängigen und „echten“ Fans, und deswegen distanzieren sie sich vor allem von unkritischen Anhängern, die ihre Vereinsklamotten in den Fanshops kaufen.
Alles, was nicht Kutte, Hooligan, Ultra oder „Hooltra“ (gewaltbereiter Ultra) ist, gilt als „Normalo“. Doch auch die „normalen Zuschauer“ lassen sich noch differenzieren. Da gibt es die kleine Gruppe älterer Anhänger, die viel über die Tradition des Vereins wissen und eine Menge von lange zurückliegenden Erfolgen zu berichten wissen. Beim Anmarsch kaum zu sehen sind die so genannten VIPs. Sie bahnen sich mit ihren Limousinen einen Weg durch die Menge und parken unmittelbar hinter der Haupttribüne. Das Spiel verfolgen sie hinter Glas bei Sekt und Schnittchen in teuer angemieteten Logen oder auf extra abgesperrten Ehrenplätzen. Die größte Menge der heutigen Besucher bilden wenig auffällige Durchschnittsmenschen, auch Frauen sind darunter und viele Kinder. Die auf den billigeren Sitzplätzen, oft ehemalige Amateurfußballer, nörgeln viel und verlassen das Stadion, wenn es für das eigene Team nicht so gut läuft, oft schon vor dem Abpfiff. Auch bei den besser gestellten Leuten auf den etwas teureren Plätzen handelt es sich um recht kritische Konsumenten, die vor allem ein unterhaltsames Spiel und eine ihrem Eintrittsgeld entsprechende Leistung sehen wollen.
Heute finden sich Menschen aus allen Bevölkerungsschichten in den Arenen des Fußballs zusammen. In der Verteilung der Zuschauer im Mikrokosmos Stadion (Logen, Haupttribüne, billige und teure Sitzplätze, Stehränge) spiegeln sich auch die Sozial-und Konfliktstrukturen der Gesellschaft. In den unterschiedlichen Formen der Teilnahme am Ereignis – die einen wollen vor allem ein schönes Spiel sehen, die anderen unbedingt einen Sieg ihrer Mannschaft, wieder andere wollen vor allem „die Sau“ rauslassen – zeigt sich ebenfalls, dass es keineswegs eine undifferenzierte Masse ist, die zuschaut. Anders als im wirklichen Leben sind es hier allerdings die auf den billigen Plätzen, die das Stadion lautstark als ihren Herrschaftsraum deklarieren. Das bessere Publikum betrachtet das Spiel interessiert-distanziert und begrüßt die Inszenierung des Volkes auf den Rängen als folkloristische Zugabe zu dem Erlebnis, für das man zahlt. Während man die zahlungskräftigste Schicht in den Logen während des Spiels kaum wahrnimmt, fallen die Möchtegern-VIPs auf der Haupttribüne vor allem durch ihr Schweigen auf und dadurch, dass die „La-Ola-Welle“ bei ihnen in der Regel verebbt.
Leute, die vom Fußball keine Ahnung haben, können sich nur wundern über das, was da allwöchentlich passiert. Für diese Leute besteht der Fußball lediglich darin, dass 22 Spieler mit oft merkwürdigen Verrenkungen einen Ball hin- und herstoßen. Sie können nicht verstehen, was so anziehend sein soll an diesem Geschehen. Wie könnte man solchen Fußball-Banausen verständlich machen, was so reizvoll ist an einem Stadionbesuch? Soll man ihnen sagen, dass Fußball einfach ein tolles Spiel ist? Wie soll man ihnen aber erklären, dass man auch dann noch hingeht, wenn der Unterhaltungswert eines Spiels nicht größer ist, als wenn man 22 gemütlich grasenden Rinder zusieht? Und wäre ihnen nicht Recht zu geben, wenn sie behaupten, dass man ein Fußballspiel am Fernseher im Grunde viel besser verfolgen kann?
Tatsache ist, dass es beim Besuch eines Fußballspiels nicht nur um Fußball geht. Die These, es gehe im Stadion auch um das, was durch die Besonderheit des Ortes erst möglich wird, ist keineswegs weit hergeholt. Die Verhaltensweisen und Erfahrungen der Besucher von Fußballspielen lassen sich von dem „physischen Milieu“, in dem sie stattfinden, nicht trennen. Überspitzt ausgedrückt: Die Gefühle, von denen der Fußballzuschauer ergriffen wird, verhalten sich zum architektonischen Raum, in dem sie stattfinden, wie die Software zur Hardware beim Computer. Ohne die besondere Konstruktion des Stadions würde nicht funktionieren, was das Besondere des Zuschauererlebnisses Fußball ausmacht.
Die Arenen sind meist am Rande der Städte angesiedelt. Allein das weist sie bereits als Orte aus, die außerhalb des Normalen stehen. Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn man ihre Konstruktion betrachtet. Stadien sind als ein in sich geschlossener Kreis konzipiert, der einen Innenraum von der Außenwelt abgrenzt. Indem die Zuschauer ihre Aufmerksamkeit dem Geschehen in diesem Innenraum zuwenden, kehren sie dem gewöhnlichen Leben im wahrsten Sinne des Wortes den Rücken zu. Stadien sind besondere Orte, in denen die alltäglichen Normen für eine Weile außer Kraft gesetzt sind. Menschen legen draußen die Vernunft ab und überlassen sich ihren Gefühlen. Mit leerem Kopf, ganz Fußball, ballen sie sich zur Masse zusammen und artikulieren sich als solche.
Dieser in sich und nach außen hin geschlossene Ring scheint mit geradezu ungeheuerlichen Phänomenen in Zusammenhang zu stehen. Nähert man sich während eines Spiels einem Stadion von außen, so kann man ein Jubeln und Brüllen, ein Keuchen und Ächzen vernehmen, das so wirkt, als käme es von einem einzigen Wesen und nicht von mehreren tausend verschiedenen Menschen. Man könnte den Eindruck gewinnen, so der Schriftsteller Georges Haldas, als habe man in der Arena „ein Fabeltier, halb Mensch, halb Reptil, oder halb Mensch, halb Stier, gefangen“, das einmal seine Wut und ein andermal seine Lust hinausstöhnt oder -brüllt. Neben den Lauten der Aggression und der Freude ist aber auch das gesittete Klatschen eines kennerhaften Publikums zu vernehmen, selbst inbrünstige Gesänge fehlen nicht. Kriegsgeschrei, ausgelassene Festlichkeit, Karnevalsstimmung, Konzert- und Theaterbegeisterung, religiöse Andacht – alles scheint da an ein- und demselben Ort versammelt, der zugleich „Schlachtfeld“, „Partysaal“, „Hexenkessel“, „Oper“ und „Kathedrale“ sein kann.
Zwar beschränkt sich die Gemeinsamkeit der Zuschauer auf die Identifikation mit einer Fußballmannschaft: Sie sind nicht einfach nur beisammen, sondern getrennt nach Schichtzugehörigkeit und Alter auf verschiedene Ränge verteilt. Dennoch gilt in gewisser Weise für das gesamte Stadion, dass nach dem Lösen einer Eintrittskarte alle Zuschauer ihre Individualität abgelegt haben und die Zeit des Spiels tendenziell zu einer Zeit der Gleichheit wird. Alle haben Fußball im Sinn – insofern unterscheidet sich der Generaldirektor als Zuschauer nicht vom kleinsten Angestellten seines Betriebs, ja nicht einmal vom neunjährigen Sohn des Nachbarn. Alle legen am Stadioneingang die Verkleidungen der Person ab und nehmen im gleichen Wasser ein Gefühlsbad. Die Differenz besteht lediglich darin, dass die einen (die auf den Fanblöcken) kopfüber hineinspringen, während die anderen (die auf den Sitzplätzen) sich mal nur kurz nass machen oder (die in den Logen) lediglich den kleinen Zeh hineinhalten.
Jedes Stadion ist ein spezieller Ort der Enthemmungen, wie sie sonst im öffentlichen Raum in so massiver und massenhafter Form nicht vorkommen. Wenigstens ansatzweise findet in einem Fußballstadion ein kollektiver emotionaler Ausstieg statt, bei dem all die Rollenzwänge und Verhaltensmaßregeln, die den gewohnten Ablauf des Lebens bestimmen, für eine begrenzte Zeit aufgebrochen, ja abgelegt werden können. Während der Alltag Pause hat, ist erlaubt, was sonst verboten ist, hier darf die Sau raus, die sonst im Stall bleiben muss. Wildfremde Menschen dürfen sich um den Hals fallen, sich ungebremstem Jubel hingeben, ungeniert brüllen, johlen, pfeifen und mit unflätigsten Flüchen und Beschimpfungen um sich werfen, oder, frei von jeder Scham, ihrer Verzweiflung freien Lauf lassen.
Die Aufhebung der Verbote und die Befreiung von den Lasten und Zwängen des Alltags schaffen im Fußballfest eine Zeit für Gefühle aller Art. Fröhliche Ekstase ist nicht ausgeschlossen, genauso wenig aber auch das übelste Ressentiment aus der untersten Schublade der Vorurteile. Leute, denen man das außerhalb des Stadions nie zutrauen würde, versteigen sich zu Hasstiraden, andere geben rassistische Schmähungen von sich, bei einigen führt die Erregung zum Gewaltausbruch. Wegen dieser bösen Seiten der Enthemmung, die nicht nur mit der Alkoholisierung zu tun haben, galt der Fußball lange als nicht gesellschaftsfähig. Vor allem in den letzten Jahrzehnten hat man mit vielen Verboten, zahlreichen Sicherheitsmaßnahmen und hoher Polizeipräsenz versucht, das Fußballereignis zu reglementieren und zu zivilisieren. Darunter hat dann auch die positive Stimmung unter den Fans gelitten, so dass die Spieltage wohl nicht mehr ganz so tolle Tage sind wie früher. Trotzdem: Immer noch zeigt ein vollbesetztes Stadion von der äußeren Erscheinung her Ähnlichkeit mit den wilden und ungezügelten Formen des karnevalistischen Treibens. Fans haben sich verkleidet, ihre Gesichter sind bemalt, sie schwenken aufgeblasene Bananen, werfen Konfetti, machen Lärm mit Tröten und Rasseln, zünden Räucherkerzen an, früher durften sie auch noch riesige Fahnen schwenken und Feuerwerk machen. Kurzum: Die Fußballzeit ist und bleibt eine Zeit des Sich-Auslebens und des Überschwangs der Triebe, oder wie es einmal der Journalist Horst Vetten ausdrückte: „Im Fußballstadion pupt die Volksseele, hier darf sie.“
Auch wenn sie dies heute zum Teil – in England seit der Saison 1994/95 gänzlich – im Sitzen tun müssen, stehen die Fans mit einer Unbedingtheit hinter ihrer Mannschaft, die keine Aufforderung von den Spielern benötigt. Noch ist es den Fans in der Bundesliga erlaubt, sich auf den Stehblöcken dicht aneinander zu drängen und, begünstigt durch die Nähe untereinander, auch körperlich zu einer Masse mit einer einzigen Emotion zusammenzuwachsen. Sie wollen dem Geschehen auf dem Rasen nicht nur zusehen, sondern durch ihre Art der Anwesenheit unmittelbar an ihm teilnehmen. Im Bestreben, ihre Mannschaft stimmgewaltig zum Sieg zu treiben, verstärken sie deren Kräfte. Ihr Anfeuern ist keineswegs umsonst: Mannschaften im eigenen Revier, wo sie von ihren Fans unterstützt werden, spielen meist wesentlich erfolgreicher als auswärts. Oft gelingt es den Fans, mit ihrem Enthusiasmus die Spieler auf dem Feld anzustecken. Sie schauen also nicht nur zu, sondern kommunizieren mit ihren Helden.
Vor allem die Fans sorgen dafür, dass am außergewöhnlichen Ort das sonst Verbotene, das zugleich so reizvoll ist, überhaupt möglich wird: massenhafter Fan-atismus. Durch die Leidenschaft, mit der sie ihre Mannschaft antreiben, auf dem Rasen das Spiel zu diktieren, fällt ihnen im Zuschauerrund eine Führungsrolle zu. Ihre Rituale wirken als emotionale Impulse auf die übrigen Zuschauer. Sie stimulieren den Rest des Stadions zum „richtigen“ Mitgehen. Erst wenn die Fans die Stimmung anheizen, brüllen auch die Zuschauer auf den Sitzen mit. Erst wenn die Fans eine „La-Ola-Welle“ inszenieren, heben auch die anderen ihren Hintern.
Durch die Aktivität der Fans werden müde Beine oft erst munter, der durchschnittliche Zuschauer hingegen erhebt sich in der Regel erst dann, wenn ihn das Spiel vom Sitz reißt. Zumindest ansatzweise verwandeln sich im Stadion jedoch nicht nur die Aktivisten auf den Stehrängen, sondern alle Zuschauer in „Fußballmenschen“. Niemand kommt hierher, um nur wie im Theater ruhig zuzusehen. Selbst der schweigsamste Einzelgänger auf dem ruhigsten Sitzplatz kann sich der Atmosphäre kaum entziehen. Im Gegensatz zum Theater, wo die Zuschauer der Bühne gegenübersitzen, bilden sie im Stadion einen engen, abgegrenzten Kreis um den riesigen Tisch des Fußballfeldes. Während alle sehen können, was unten auf dem Spielfeld vor sich geht, sitzen sie einander gegenüber und bannen sich so als Menge selbst. Erst diese Einkesselung bewirkt, dass sich die Gefühle gleichsam wie von selbst hochschaukeln. Jeder bemerkt die Erregung der anderen, die er gleichzeitig, weil die einzelnen Gesichter „verschwimmen“, nur als Masse wahrnehmen kann. Diese Unmöglichkeit, andere als Individuen wahrzunehmen, wirkt wie ein Sog. Nach und nach gehen alle mehr und mehr aus sich heraus, werden in die allgemeine Erregung hineingezogen, bis das „Ich“ mit all den anderen verschmolzen ist zu einem homogenen Etwas „mit eigenem Körper“. Und in den besten, den dramatischsten Momenten eines packenden Spiels ist es manchmal so, als ob die Zeit stehen bliebe.
Trotz aller Unterschiede und Trennungen kommt es im Stadion zu einer Vereinigung. Alle gehen mit, alle sind voll dabei und erleben gleichzeitig das Gleiche. Dieses von der Konzentration aller Energien auf ein Ziel geprägte Erleben, das verbunden ist mit einem Verlust der Selbstkontrolle und einer innerlichen Vereinigung mit der Umgebung, firmiert im psychologischen Newspeak unter der Bezeichnung „Flow“. Wenn die Aufmerksamkeit auf ein beschränktes Feld von Reizen konzentriert ist, wenn die Ziele eindeutig sind und die Rückmeldung unmittelbar erfolgt, wenn Körper, Handlung und Bewusstsein miteinander verschmelzen, dann ist ein Zustand des „reinen“ Erlebens erreicht, ein Zustand, bei dem man „im Tun aufgeht“. Obwohl die Theorie des Flow eher für die sportlich sich bewegenden Fußballer selbst erdacht ist – man denke an die Mannschaft, die sich „in einen Rausch“ spielt –, wäre es äußerst ungerecht, wollte man den Fans im Stadion dieses Gefühl des Fließens nur im Zusammenhang mit alkoholhaltigen Flüssigkeiten zugestehen.
Der „Feind“ ist Anlass für die Gefühlsvereinigung im Stadion. Und zugleich verhindert seine Anwesenheit, dass die anwesende Menschenansammlung gänzlich rund und kompakt wird. Es handelt sich, so Elias Canetti in seinem berühmten Werk „Masse und Macht“, um eine in einem Ring angeordnete „Doppelmasse“. Zwar ist die Auflösung der individuellen Atome in der Wärme gemeinsamer Emotion ausgelöst durch die Identifikation mit der Mannschaft, die auf ihrem eigenen Territorium antritt. Weil da aber auch noch eine andere Mannschaft auf dem Platz ist, verlängert sich der Kampf auf dem Rasen auf die Ränge, wo sich der kleine „Gästeblock“ wie ein militärischer Brückenkopf in die Menge hineingedrängt hat und sich mit den heimischen Fans harte Gefechte um die Beherrschung des Schallraums liefert. Wie in einem Echo wird der Lärm der einen von den anderen verlängert und umgekehrt, und im Wettstreit der Sprechchöre kann sich die Temperatur der Emotionen derart erhitzen, dass Außenstehende manchmal wirklich den Eindruck haben können, dieser explosive Sud könnte jeden Augenblick über die Ränder der Schüssel schwappen.
Wie sich die Stimmung entwickelt und wie sie sich entlädt, hängt freilich davon ab, welche Zutaten vor und während des Spiels beigemengt wurden. Sind die Fans der Klubs verfeindet, ist „Nieder mit den Schweinen“ angesagt, sind sie miteinander befreundet, dann kann es auch heißen: „Scheißegal, wer gewinnt. Hauptsache, die Stimmung ist gut.“ Auch während des Spiels ist grundsätzlich eine Entwicklung der einmal entfachten Begeisterung nach zwei Seiten hin offen: Zur Atmosphäre des fröhlichen Festes, die sich in einem vollen Stadion in einer „La-Ola-Welle“ zeigt, die das Rund wie selbstverständlich mehrmals durchläuft; oder zu der des „Ersatzkrieges“, in der sich die Feindseligkeit wie eine dunkle Wolke drohend über dem Geschehen zusammenbraut. Grundsätzlich gilt freilich: Jeder, der ins Stadion geht, will teilhaben an der Emotion der Masse, und die besteht eben in der Hauptsache aus denen, die im Stadion „zu Hause“ sind.
Natürlich sind nicht alle Stadien gleich. Nicht nur volle oder leere Ränge unterscheiden sie, sondern auch die Spielbeteiligung des Publikums, das sich in ihnen versammelt. In diesem Sinne sind die Spielorte Ausdruck nationaler Charaktere – Sambaklänge und leidenschaftliche Begeisterung in Brasilien, inbrünstige Gesänge in England –, aber vor allem auch des Selbstverständnisses und des „Charakters“ der Anhänger eines bestimmten Klubs. Das Publikum kann lasch oder ausgelassen, besonders fair oder besonders feindselig sein. Manche Stadien sind dafür berühmt geworden, dass in ihnen die „Gäste“ von den Emotionen der Zuschauer schier erdrückt werden. Diese Atmosphäre der Einkesselung schuf Mythen wie den „Roar“ von Wembley (London) oder Hampden Park (Glasgow): Während im Londoner „Gästehaus“ der englischen Nationalmannschaft der unnachahmliche Schrei „England“ Gänsehaut verursachte, fürchteten die Engländer selbst nichts so sehr wie das Riesenstadion in Glasgow. Dort wurde, wie der ebenfalls zum Mythos gewordene Stanley Matthews einmal meinte, „der Enthusiasmus der Menge in die Adern der schottischen Spieler eingespritzt“.
Zumindest einmal wurde der Hampden Park aber auch zum Synonym nicht für Kriegsgeschrei, sondern für ein fröhliches Fußballfest. „Das Stadion bot einen überwältigenden Anblick. Die Stimmung war großartig. Ein Jubelruf empfing die einlaufenden Mannschaften …“, begann der Journalist Peter Berger seinen Bericht über das Endspiel des Europapokals der Landesmeister 1960. Das große Real Madrid traf auf den Außenseiter Eintracht Frankfurt, der sich mit zwei tollen Halbfinal-Siegen gegen die Glasgow Rangers (6:1 und 6:3) gerade in Schottland viel Respekt verschafft hatte. Frankfurt zeigt auch gegen den Weltklassegeg ner im Finale zunächst keinerlei Hemmungen und erspielt sich Chancen gleich reihenweise. Dann geschieht, womit keiner gerechnet hat. „Es sind knapp 20 Minuten vergangen im Hampden-Park, da donnert der Beifall der weit über 100.000 Menschen für Eintracht Frankfurt los. Die Mannschaft aus Frankfurt am Main führt 1:0!“ Doch jetzt kommt Real und zündet ein Feuerwerk: di Stefano 1:1; di Stefano 1:2; Puskas 1:3. Pausenpfiff. Eintracht müht sich weiter, wieder gibt es einige Chancen, doch kein Tor. Die begeisterten schottischen Zuschauer feuern die tapferen Frankfurter immer wieder an. Doch alle Ermunterung nützt nichts. Real kontert, Gento wird im Strafraum gefoult, Puskas verwandelt zum 1:4. Das Spiel ist entschieden, aber Madrid fängt jetzt erst so richtig mit dem Spielen an. Es gibt technische Zaubereien und Traumkombinationen en masse. Es fällt das 1:5 durch Puskas, das 1:6, wieder durch Puskas. Die Frankfurter dürfen auch ein bisschen mitmachen, 2:6 durch Stein. Di Stefano ist sauer, schnappt sich vom Anstoß weg den Ball, dribbelt sich zum Frankfurt Tor durch, zieht ab – 2:7. Es folgt noch ein Geschenk der unaufmerksamen spanischen Abwehr, das Stein zum 3:7 nutzt. Als der Schiedsrichter abpfeift, bricht ein Beifallssturm los. Er steigert sich zum Orkan, als die Frankfurter Spieler klatschend Spalier bilden, um den großartigen Siegern Anerkennung zu zollen.
Normal ist solch eine allgemeine Begeisterung natürlich nicht. Normal war allerdings auch nicht das damalige außergewöhnlich schöne Spiel, und normal sind auch nicht Mannschaften wie das große Real. Fußball-Alltag ist vielmehr das aggressive Zelebrieren von Parteilichkeit für eher durchschnittliche Mannschaften. In der Bundesliga sind vor allem die „reinen“ Fußballstadien gefürchtet, in denen die Ränge bis ans Spielfeld reichen. In solchen Stadien werden die Spieler des Gegners von der aufgeladenen Stimmung schier erdrückt. In Dortmund etwa können die Fans auf der Südtribüne mit ihrer Mannschaft manchmal zu einer schier unüberwindbaren psychischen Einheit verwachsen. Als es in England noch die „Ends“ und „Kurven“ gab, die mit nie versiegender Energie ihrer Mannschaft Power und dem Gegner weiche Knie verschafften, waren weniger die Stadien als solche, sondern bestimmte Bereiche in ihnen gefürchtet: Da war der Name Stretford End mindestens genauso bekannt wie der Name Old Trafford (Manchester United), und während manche nicht wissen, dass der FC Liverpool an der Anfield Road antritt, kennt jeder Fußballfan den Namen einiger Quadratmeter in diesem Stadion: „The (Spion) Kop“. Auf diesem nach einer besonders engen britischen Stellung im Burenkrieg benannten Fanblock standen die Fans einst so nahe beieinander, dass die Arme immer nach oben gereckt bleiben mussten, und wenn sie ihre „Reds“ klatschend anfeuerten, soll der Rasen gezittert haben. Man kann sich vorstellen, dass sich vor solcher Kulisse die Spieler eines Heimteams fühlen mögen, als ob ihnen zwei weitere Beine wüchsen.
Nicht immer funktioniert allerdings der Heimvorteil in die richtige Richtung. Manchmal kann es selbst in den größten Hochburgen der parteiischen Emotionen zu extremen Umkehrungen der Zuschauerwirkung kommen. Der wohl berühmteste Fall ist das entscheidende WM-Spiel am 16. Juli 1950, bei dem elf Kicker aus Uruguay nicht nur gegen eine brasilianische Supermannschaft, sondern auch noch gegen die Weltrekordzahl von 203.849 Zuschauern im Maracana-Stadion von Rio de Janeiro anzuspielen hatten. Erst nach dem Spiel konnte Uruguays Torwart Maspoli gelassen erklären: „Wir wussten, dass diese Kulisse Himmel und Hölle zugleich sein könnte. Sie wünschte Brasilien den Sieg, aber sie würde dieser Mannschaft auch kaum einen Fehler verzeihen.“ Als nach dem 1:1-Ausgleich „plötzliche Kühle auf den Rängen“ herrschte, will Maspoli gesehen haben, wie sich im Gesicht eines jeden Brasilianers „unglaublicher Schrecken“ spiegelte. Und nachdem sich das Stadion von seiner tiefen Depression wieder erholt hatte und das Dröhnen der Anfeuerung wieder auf Touren gekommen war, verstummte es kurz vor Schluss mit einem Schlag – Uruguays Ghiggia hatte ein unwiderstehliches Solo mit einem Schuss aus spitzem Winkel ins kurze Eck abgeschlossen. Während Torwart Barbosa geschlagen am Boden lag, herrschte lähmendes Entsetzen in dem Stadion, das als Fußball-Tempel errichtet worden war und sich nun in ein Leichenschauhaus verwandelt hatte. Später, als die grenzenlos erschütterten Trauergäste immer noch weinten, schlich der verhinderte Triumphator, Brasiliens Trainer Flavio Costa, als Kindermädchen verkleidet, von dannen. Vorher hätten alle nur von der großen Feier gesprochen, jammerte der geknickte Torwart Barbosa. „Das war ein gravierender Fehler und hat uns letztendlich das Genick gebrochen.“ Jahre später fand der Schütze des entscheidenden Tores, Alcide Eduardo Ghiggia, große Worte zur Umschreibung des denkwürdigen Ereignisses: „Es hat nur drei Personen gegeben, die das vollbesetzte Maracana-Stadion zum Schweigen bringen konnten: Frank Sinatra, Papst Johannes Paul II. und ich.“ Aber es war wohl mehr als nur ein schlichtes Schweigen. Für die Brasilianer waren es, wie der Journalist Carlos Maranhao schrieb, die „Augenblicke finsterster Stille seit der Ankunft der Portugiesen 1565“.
Im normalen Fan-Leben geht es nicht ganz so spektakulär zu, weder auf dem Rasen noch auf den Rängen. Aber auch hier gibt es Erlebnisse, die man nie vergisst. Heute noch bin ich beeindruckt vom Finale der Zweitligasaison 1984/85. Mein Verein, der 1. FC Nürnberg, war wieder einmal abgestiegen. Es gab eine Runderneuerung: neues Präsidium, neuer Manager, zwölf neue Spieler. Aber alles nützte nichts, der Saisonstart war verkorkst. Es kam zur „Oktoberrevolution“ gegen Trainer Höher und zur Entlassung von sechs Profis. Im folgenden Auswärtsspiel in Aachen trat der „Club“ mit einer „Kinder-Mannschaft“ (Durchschnittsalter unter 21 Jahre) an und verlor ehrenvoll mit 1:2. Danach waren die „Kinder“ nicht mehr zu stoppen. Das junge Team mit Eckstein, Grahammer, Reuter, Dorfner eilte in der Rückrunde mit begeisterndem Fußball von Sieg zu Sieg, errang 27:9 Punkte. Am letzten Spieltag gab es ein „Endspiel um den Aufstieg“ gegen Hessen Kassel. Ich hatte nur noch einen ganz schlechten Platz bekommen, auf Höhe der Eckfahne in der Südkurve. Egal, Hauptsache, ich bin dabei. Eine Stunde lang Anspannung. Endlich erzielt Eckstein das 1:0. Mein Herz pumpt, Kassel drängt auf den Ausgleich. Kurz vor Schluss schnappt sich Thomas Brunner noch in der eigenen Hälfte den Ball und startet durch. Allein strebt er dem Kasseler Tor zu. Die Zeit bleibt stehen, das Stadion hält den Atem an. Tor! Aufstieg! Tränen kullern über Wangen.
„Alles, wirklich alles wäre möglich gewesen, wenn diese Mannschaft damals zusammengeblieben wäre“, sagt Hans Dorfner noch heute. Sie tat es nicht. Und so wurden die Freuden wieder spärlicher. Aber dankbare Anhänger auf den Rängen gab es immer noch. Unvergessen bleibt mir jener Moment, als ich nach einem der selten gewordenen „Club“-Siege gerade nach Hause gehen wollte und vor dem Ausgang des Blockes einen alten Mann weinend am Boden kauern sah; überwältigt vom Glück, dabei von seiner Frau streichelnd getröstet, konnte er nur eines stammelnd immer wieder von sich geben: „Dass ich das noch erleben darf, dass ich das noch erleben darf …“
Ich glaube, es war ein Spiel gegen Wattenscheid 09.