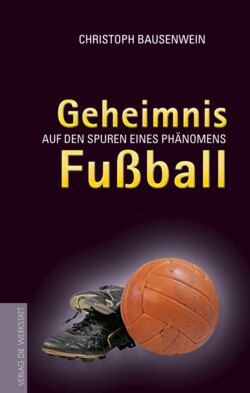Читать книгу Geheimnis Fussball - Christoph Bausenwein - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTEMPO
In der Analyse des Raumes hat sich bereits angedeutet, dass auch die Zeit beim Fußball eine große Rolle spielt. Das beste Abspiel nützt nichts, wenn es nicht zum richtigen Zeitpunkt stattfindet. Kommt es zu früh, ist der Raum noch nicht von einem Mitspieler besetzt, kommt es zu spät, ist er unter Umständen schon ins Abseits gelaufen. Die Kunst, den Ball im richtigen Augenblick an die richtige Stelle zu befördern, nennt man Timing. Eine Flanke oder ein Pass sind nur dann „gut getimet“ und gelungen, wenn sie so geschlagen werden, dass sie der mitgelaufene Spieler auch noch erreichen kann. Besonders schwierig ist das Timing beim Doppelpass, denn hier muss der Ball nicht nur beim Abspiel, sondern auch beim unmittelbaren Zurückprallen in den Lauf des Mitspielers punktgenau serviert werden.
Für das exakte Platzieren eines Balles zum richtigen Zeitpunkt bleibt beim Fußball nicht viel Zeit. Im Gegensatz zu dem, der eine Fußballstrategie entwirft, kann der Spieler auf dem Platz nicht lange über den richtigen Spielzug nachdenken. Spieler müssen in der Lage sein, schnell Entscheidungen zu treffen. Sie müssen in jedem Augenblick intuitiv das Richtige tun. Nicht umsonst kritisieren viele Trainer Spieler, die „zu viel“ denken. Solche „Vieldenker“ neigen dazu, den richtigen Zeitpunkt für den aussichtsreichen Abschluss einer Aktion zu verpassen. Erfolgreiche Spieler handeln schnell: Von „Bimbo“ Binder, in den 1930er Jahren Torschützenkönig in Diensten von Rapid Wien, hieß es, dass der Torwart oft noch auf seinen Schuss gewartet habe, während der Ball schon längst im Tor lag. Ganz anders dagegen Cyrille Makanaky, Nationalspieler Kameruns, der zu einer ausgelassenen Tormöglichkeit im Spiel gegen Argentinien (WM 1990) bemerkte: „Ich habe zu lange überlegt, ob ich schießen oder abspielen soll. Und als ich dann schoss, hatte ich mich eigentlich entschieden abzugeben.“ Wie dieses Beispiel zeigt, schlummert im Fußball ein dezisionistisches Element, was heißt: Es ist in jedem Falle besser, sich überhaupt zu entscheiden und schnell irgendetwas zu tun, als sich gar nicht zu entscheiden und eine Gelegenheit tatenlos vorüberziehen zu lassen.
Wer blitzartig handeln kann, hat im Fußball große Vorteile. Kreative Spieler können ein Spiel so „lesen“, dass zwischen dem Erkennen der entscheidenden Situation und dem Spielen des für den Gegner „tödlichen“ Passes nicht mehr als ein Wimpernschlag liegt. Weil sie besser und schneller Möglichkeiten erfassen können als andere, bleiben solchen Spielern auch in scheinbar aussichtslosen Situationen noch Handlungsspielräume offen. Dass gerade die zentralen Schaltpositionen einer Mannschaft auffallend häufig von älteren Spielern besetzt sind, zeigt, wie wichtig für das Erkennen des richtigen Augenblicks die Erfahrung vieler Spiele ist. Es macht darüber hinaus deutlich, dass auch langsame Spieler ein Spiel schnell machen können, sofern sie mit den entsprechenden technischen Fertigkeiten ausgestattet sind, um den Ball in einem Atemzug stoppen, kontrollieren und punktgenau weiterleiten zu können. Denn Schnelligkeit heißt im Fußball weniger, mit dem Ball zu rennen, es bedeutet vielmehr schnelles Handeln im Umschalten von Verteidigung auf Angriff, vom langsamen Kurzpassspiel in die Breite auf einen schnellen Pass in die Tiefe. Beim Fußball geht es weniger um physische Schnelligkeit denn um „Spielhandlungsschnelligkeit“.
Wichtig ist vor allem ein sofortiges Umschalten bei Balleroberung, um den Augenblick zu nutzen, in dem sich der Gegner noch nicht sortiert hat. Wer den Ball bereits im vordersten Drittel erobert, erhöht seine Torchancen deutlich. Die meisten Tore fallen heute durch das schnelle Ausnutzen von Ballverlusten, vier von fünf Toren gehen nicht mehr als fünf Ballkontakte voran. Früher dauerte es relativ lange, da der Ball erst von einem der technisch meist limitierten Verteidiger zum Spielmacher weitergegeben werden musste, der ihn dann verteilte. Heute erledigt der Mann im zentralen defensiven Mittelfeld die Aufgabe in einem Zug. Beim Angriff des Gegners schließt er die Lücken; kommt er in Ballbesitz, leitet er sofort den eigenen Angriff ein. Ein Geheimnis der nach wie vor erfolgreichen Brasilianer liegt genau in diesem prompten Umschalten bei der Balleroberung; ein eher unauffälliger, aber dennoch enorm wichtiger Spieler wie Emerson versteht es, die für einen Augenblick in der Formation des Gegners entstandenen Lücken sofort für den Gegenangriff zu nutzen.
Im Fußball braucht es auch Spieler, die in der Lage sind, weit und scharf geschlagene Pässe zu erlaufen – Spieler, wie etwa den legendären „russischen Pfeil“ Oleg Blochin – wichtiger als die reine Laufgeschwindigkeit ist allerdings die Schnelligkeit in der Reaktion. Beim Kampf um den Ball können Hundertstelsekunden entscheidend sein, nur wer auf den ersten Metern schnell antreten kann, gewinnt oder behält den Ball. Viele große Spieler waren in diesem Sinne schnell. So wussten die Gegenspieler Garrinchas zwar alle, dass er fast immer eine Bewegung nach links antäuschte, um dann rechts mit dem Ball davonzulaufen; aber die Blitzartigkeit von vorgetäuschter und vollzogener Bewegung machte jeden Störungsversuch illusorisch. Desgleichen ist der Gegner machtlos, wenn ein Angreifer antrittsschnell den Abwehrriegel durchbricht; düpiert zeigen sich reaktionslahme Verteidiger nach einem plötzlichen Pass; hilflos ist eine ganze Mannschaft, wenn die gegnerischen Spieler den Ball in atemberaubendem Tempo hin- und herflitzen lassen. Verblüfft sind aber auch oft die Schützen eines herrlichen Tores, wie der ehemalige Trainer Dietrich Weise wusste: „Die Zeit zwischen Entschluss und Erfolg entzieht sich der Berechnung.“
Die Mannschaft, die den Ball mit dem größten Tempo in ihren Reihen zu bewegen vermag, hat zumeist auch die größten Chancen auf den Sieg. Ob und wie häufig das dazu nötige Timing im Passspiel gelingt, hängt wiederum sehr stark davon ab, wie eingespielt eine Mannschaft ist und ob sie während eines Spiels zu ihrem Rhythmus findet. Spieler, die sich gut kennen, „wissen“, wie ihre Mannschaftskameraden sich bewegen und handeln werden, auch ohne dass man vorher eine Verabredung getroffen hätte. In manchen Teams sind die „inneren Uhren“ der Spieler so aufeinander abgestimmt sind, dass der Ball wie ein Weberschiffchen vom einen zum anderen läuft. Eine besondere Feinabstimmung und damit besonders intensives und langes Training erfordern plötzliche Rhythmuswechsel. Hat eine Mannschaft einmal diese Fähigkeit erworben, besitzt sie damit ein besonders wirkungsvolles Mittel zur Überrumpelung des Gegners. Sie kann abwarten, das Spiel langsam machen, den Gegner aus der Abwehr herauslocken oder einschläfern, um dann urplötzlich das Tempo zu wechseln. Tempowechsel und Variationen im Spielrhythmus können wesentlich erfolgreicher und für den Zuschauer auch viel unterhaltsamer sein als ein relativ stupides Anrennen gegen das Tor des Gegners, wie es traditionell die Engländer praktizieren.
„Schnelligkeit“ – in den Beinen und im Kopf – war 1954 eines der Mittel, auf die Sepp Herberger vertraute, um die langsameren Ungarn zu schlagen. Die Temposteigerung, so bemerkte Hennes Weisweiler schon vor Jahren, sei ein grundsätzliches Merkmal der Fußballentwicklung: „Im Droschkenzeitalter vor 50 Jahren spielte man nach der heutigen Auffassung aus dem Stand, im Motorenzeitalter vor dem Krieg mit beachtlicher Geschwindigkeit und im Zeitalter der Düse Düsenfußball.“ Im heutigen Computer-Zeitalter, so lässt sich ergänzen, spielt man Gigahertz-Fußball. Ganz früher standen Leute wie Garrincha und Matthews lange Zeit nur herum. Zu Netzers Zeiten, von denen Weisweiler spricht, lief ein Mittelfeldspieler kaum einmal mehr als fünf Kilometer; heute muss er das Doppelte herunterspulen.
Heute ist zudem eine bessere Technik gefordert, da der Ball oft unter Bedrängnis verarbeitet werden muss. Je stärker Athletik und Kondition geworden sind, desto weniger Zeit haben die Spieler bei der Annahme des Balles; immer ist schon jemand da, der ihnen auf den Füßen steht. Credo des modernen Spiels – dort, wo gerade der Ball ist, in Überzahl kommen, gleichgültig, ob nun in der Defensive oder in der Offensive – erfordert ununterbrochene Laufarbeit, um die Wege zum Ball möglichst kurz zu halten. Auf dem Platz findet inzwischen eine Art Wettrennen zweier gut organisierter Einheiten statt. Dennoch ist nicht immer gesagt, dass die am perfektesten funktionierende und am schnellsten reagierende Organisation gewinnt. Im Endspiel des Confed-Cups 2005 konnten die Argentinier ihr Defensivnetz gar nicht so schnell aufbauen, wie die Brasilianer kombinierten. Ihrem Tempo war nicht zu folgen. Und sie ließen nicht nur den Ball laufen. Wenn einer beim Dribbling den Ball verlor, kam aus seinem Schatten sofort ein zweiter, um den verlorenen Ball sofort wieder zurückzuerobern.
Kollektiv agierende Teams mit hohen individuellen Qualitäten, die sich permanent in Bewegung finden und ihre Kurzpass-Kombinationen schnell und sicher vortragen, geben heute den Ton an. Zu schlagen sind sie nur, wenn sie psychisch und vor allem physisch schwächeln. Bei der WM 2002 und bei der EM 2004 wirkten die bis dahin so dominanten Franzosen ausgelaugt. Stattdessen taten sich mit Fitness, Laufstärke und Disziplin Außenseiter-Teams wie die USA und Südkorea hervor. Es zeigte sich: Gerade bei großen Turnieren können sich ausgeruhte und gut aufeinander eingespielte Mannschaften hervortun und sich Vorteile erarbeiten gegenüber den Favoriten, deren Spieler durch eine lange Saison überbeansprucht sind. Und der von dem deutschen Erfolgstrainer Otto Rehhagel betreute krasse Außenseiter Griechenland zeigte bei der Europameisterschaft 2004 sogar, dass man immer noch einen Angreifer sich „totlaufen“ lassen kann, um dann in klassischer Konter-Art über die Außenpositionen per Flanke nach innen zum Erfolg zu kommen.
Selbst wenn die Behauptung zutreffen sollte, dass durch die Temposteigerung zum spielerischen Raffinement immer weniger Zeit bleibt, würde ein langsameres Spiel die an solches Tempo nun gewöhnten Zuschauer vermutlich nur langweilen. In heutigen Spielen erfolgen die Ballkontakte im Sekundenrhythmus. Das Fußball-Tempo liegt damit genau in einem Bereich, dem das Auge noch folgen kann, ohne überfordert zu sein. Läge die Quote höher, würde die Aufmerksamkeit der Zuschauer während des Spiels nachlassen (was zum Teil beim Eishockey der Fall ist); läge sie niedriger, würden die Gedanken der Zuschauer aus Langeweile abschweifen. Die Verdoppelung des Spieltempos und die gestiegene räumliche Komplexität der Abläufe verlangt den Zuschauern mittlerweile allerdings doppelte Aufmerksamkeit ab, wenn sie das Geschehen wirklich verstehen wollen.
Eine weitere Besonderheit des Fußballs gegenüber manchen anderen Sportarten ist darüber hinaus der nahezu ununterbrochene Zeitfluss. Während andere Sportarten immer wieder abbrechen und neu anfangen – beim Football formieren sich die Mannschaften bei jedem Spielzug neu, beim Handball und beim Basketball sind die Unterbrechungen Folge der Vielzahl der Tore – könnte ein Fußballspiel zumindest theoretisch pro Halbzeit 45 Minuten lang nonstop ablaufen. Zwar beträgt die gesamte Realspielzeit im Durchschnitt nicht mehr als 60 bis 70 Minuten, aber das ist im Vergleich zu anderen Spielen immer noch eine sehr hohe Quote. Unterbrechungen gibt es nur, wenn der Ball aus dem Feld geschlagen wird, bei Fouls und Toren sowie zur Halbzeit. Bei Spielen mit permanenten Unterbrechungen und Auswechslungen wäre undenkbar, dass sich eine Mannschaft in einen Rausch spielt.
Aber selbst dann, wenn das Spiel äußerst einseitig scheint, darf der Zuschauer keine Sekunde in seiner Aufmerksamkeit nachlassen. Selbst in den einfachsten Situationen kann urplötzlich etwas völlig Überraschendes passieren: Ein Torwart lässt einen harmlosen Schuss abprallen, oder ein Verteidiger stolpert unverhofft über den Ball, und schon eröffnet sich für den Stürmer eine Chance; ein Angriff misslingt, weil der Ball verspringt, schon verlagert sich das Spiel wieder blitzschnell auf jenes Tor, das gerade noch keinerlei Bedrohung ausgesetzt war. „Kleine Situazione entscheiden große Spiele”, lautet ein Credo des Trainers Giovanni Trapattoni. In jedem Moment muss jeder Spieler aufmerksam sein, um solche „Situazione“ gewinnbringend zu nutzen. Und jeder Zuschauer hat immer mit allem zu rechnen: Alles ist im Fluss, alles kann gelingen oder schief gehen, nie kann man sich sicher sein, was der nächste Augenblick bringen wird. Beim Fußball „springt“ die Zeit gleichsam von Gegenwart zu Gegenwart, und weil jedes Tor schon die Entscheidung bringen kann – aber eben auch nicht muss –, wechseln Hoffnung und Verzweiflung pausenlos einander ab. Bei kaum einem anderen Sport entstehen derart abrupt gänzlich neue Situationen, und so darf man wohl annehmen, dass genau dies viel beiträgt zu der Erregung, die man als Zuschauer beim Fußball empfinden kann.
Beim American Football hingegen beruht das gesamte Spiel auf im Training auswendig gelernten Spielzügen, von denen auf ein Zeichen hin diejenigen abgerufen werden, die eine hinreichend große Erfolgswahrscheinlichkeit garantieren. In anderen Spielen und Sportarten – vor allem bei den Laufdisziplinen in der Leichtathletik – können zeitliche Abläufe vorstrukturiert und geplant werden. Nicht so beim Fußball. Der schnelle Bewegungsfluss und das ununterbrochene Vor-und Zurückwogen der Kontrahenten machen ein Fußballspiel letztlich unberechenbar. Zwar kann ein Trainer taktische Anweisungen geben, zwar können Spielzüge im Training so oft wiederholt werden, bis die Spieler wie im Schlaf kombinieren – am Tag des Spiels wird das alles zur Makulatur, wenn der Gegner, der Verlauf des Spiels oder der Zufall es anders wollen. Einzig bei den Standardsituationen (Freistöße, Eckstöße) sind vorab lang und intensiv trainierte Varianten abrufbar.
Natürlich wird beim Fußball versucht, strategische Züge bis zu einem gewissen Grad vorauszuplanen. Viele Kommentatoren haben daher das Fußball- mit dem Schachspiel verglichen. Der Trainer Felix Magath, selbst ein begeisterter Schachspieler, meinte einmal: „Da und dort spielen zwei Teams auf begrenztem Feld. Die Ziele stehen in der Mitte, der König und das Tor.“ Die Fähigkeiten des österreichischen Fußballheros Matthias Sindelar wurden in einem Nachruf denen von Schach-Großmeistern gleichgesetzt, weil er wie diese mit weiter gedanklicher Konzeption, Züge und Gegenzüge vorausberechnend, unter allen Varianten stets die aussichtsreichste gewählt habe: „Er hatte sozusagen Geist in den Beinen, es fiel ihnen, im Laufen, eine Menge Überraschendes, Plötzliches ein, und Sindelars Schuss ins Tor traf wie eine glänzende Pointe, von der aus erst der meisterliche Aufbau der Geschichte, deren Krönung sie bildete, recht zu verstehen und zu würdigen war.“
Der Versuch, die Abfolge der Spielzüge nach Art eines Schachspiels im Vorhinein zu entwickeln, muss jedoch nicht nur an der Eigenwilligkeit des Balles, sondern vor allem an der Vielzahl von Entwicklungsmöglichkeiten scheitern, in denen das Bewegungsspiel Fußball das Brettspiel Schach noch übertrifft. „Wollte eine Fußballmannschaft vor einem Spiel allen (!) bevorstehenden Spielzügen einen und nur einen Ort in ihrem Gesamtplan zuweisen“, schreibt Winfried Uesseler in einer Besprechung der Fußballtheorie Jean Paul Sartres, „sie würde kein vernünftiges Spiel zustande bringen und verlieren.“
Selbst wenn also im Fußball spielstrategische Entwürfe möglich sind und man daher sagen kann, dass das Spiel einer Mannschaft einer „inneren Rationalität“ (Arnold Gehlen) folgt, so entsteht die Faszination dieses Sports doch nicht aus programmierten Entwürfen, sondern aus den in ihm angelegten Entwicklungsdynamiken. Jedes Spiel „lebt“ vom Unerwarteten, vom harterkämpften „Wenden des Blatts“, von urplötzlichen Umschwüngen und von jenen unvergesslichen Augenblicken, die nicht kopiert werden können. „Jede Sekunde ist einmalig“, meint Günter Netzer, und so ist es für den Zuschauer vollkommen unmöglich, schon vor dem Anstoß zu wissen, welcher spontanen Dramaturgie ein Spiel folgen wird. Fehler, Unberechenbarkeiten und plötzliche Intuition können alle Spekulationen über den Haufen werfen.
Tore können schnell fallen und dann den weiteren Verlauf eines Spiels bestimmen: Der Türke Hakan Sükür benötigte bei der WM 2002 im Spiel gegen Südkorea vom Anpfiff weg ganze elf Sekunden. Tore können „psychologisch wichtig“ sein, wenn man sie kurz vor der Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit erzielt. Tore können aber auch lange auf sich warten lassen. Selbst dann, wenn eine Mannschaft ein Spiel 80 Minuten lang überlegen gestaltet, dabei aber das Toreschießen „vergessen“ hat, kann die eigentlich unterlegene Mannschaft in zehn Minuten den Spielverlauf noch „auf den Kopf stellen“. Manchmal reicht sogar die Nachspielzeit. Im Champions-League-Finale 1999 erreichte Manchester United nach 0:1-Rückstand durch zwei nach der 90. Minute erzielte Tore doch noch den Titel. Es muss nicht immer die bessere Mannschaft sein, die gewinnt, denn nicht die Spielkunst zählt am Ende, sondern das entscheidende Tor. Und das kann, kurz vor dem Abpfiff, manchmal sogar ein Eigentor sein: So zum Beispiel im Europapokal-Halbfinale Roter Stern Belgrad - FC Bayern München am 24. April 1991, als Augenthaler seinen Torwart Aumann überraschte.
Gegen Ende eines Spiels kommt die Spannung meist auf den Höhepunkt, denn in den meisten aller Fälle liegen die Kontrahenten nur um einen Treffer auseinander. Die Mannschaft, die in Führung liegt, klammert sich an ihren dünnen Vorsprung und versucht, das Spiel „über die Zeit zu retten“, indem sie „auf Zeit“ spielt und das Spiel langsam macht. Der Elf, die im Rückstand ist, läuft währenddessen die Zeit davon, also macht sie das Spiel schnell, um den Ball noch möglichst häufig gefährlich vor das Tor des Gegners zu bringen. Da sich so gegen Ende des Spiels die Anstrengungen der Spieler erhöhen, gleichzeitig aber ihre Konzentration nachgelassen hat, ist es kein Wunder, dass sich die Anzahl der in der letzten Viertelstunde erzielten Treffer signifikant erhöht. Laut „Kicker“-Statistiken fallen in Bundesligaspielen in den ersten 15 Minuten nur etwa halb so viel Tore wie in der Schlussviertelstunde. Oft bleibt freilich auch die Schlussattacke ohne Erfolg. Dann rächt sich die lasche Einstellung zu Beginn, durch die man wertvolle Zeit vergeudet hat. Wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat, bleibt nur noch das jammervolle Nachkarten: „Wir haben zu spät ins Spiel gefunden.“
Ein Spiel kann durch mehrere schnell genutzte Chancen manchmal sehr rasch entschieden sein: Im Jahr 1973 erzielte Indepediente Buenos Aires im Spiel gegen Gimnasia y Esgrima zu Beginn der zweiten Halbzeit innerhalb von einer Minute und 50 Sekunden drei Tore. Einerseits. Andererseits ist eine Wende aber grundsätzlich fast immer möglich. Ältere Fußballfreunde erinnern sich an besonders „wahnwitzige“ Spiele, in denen ein 1:4 durch einen plötzlich „wie ein Irrwisch über den Platz fegenden“ Seppl Pirrung im Nu in ein 7:4 verwandelt werden (1. FC Kaiserslautern - Bayern München, Saison 1973/74), oder in einem „Wunder an der Weser“ aus einem 0:3 noch ein 5:3 wird (Werder Bremen - RSC Anderlecht, 1993).
Ein Fußballspiel bedeutet Hoffnung und Spannung vom Anstoß bis zum Abpfiff: Hoffnung auf den noch möglichen Ausgleich, Hoffnung, dass die eigene Mannschaft den Vorsprung halten kann, und Spannung, weil die Zeit davonläuft, weil ein einziges Tor schon entscheidend sein kann, weil man nie weiß, wann der Schiedsrichter einen Elfmeter pfeift. Erwarten kann man beim Fußball gar nichts, nicht einmal, dass nach 90 Minuten abgepfiffen wird – so kann noch in der „Nachspielzeit“ ein Unentschieden gerettet oder der Sieg errungen werden –, und auch, dass überhaupt eine Mannschaft den Platz als Sieger verlässt, ist im Liga-Alltag nicht garantiert. Deswegen lag der Humorist Karl Valentin nicht richtig, als er nach dem Besuch eines Spiels feststellte: „Enden tat das Spiel mit dem Sieg der einen Partei. Die andere hatte den Sieg verloren. Es war vorauszusehen, dass es so kam.“ Auch ein 0:0 wäre ja möglich gewesen, und das Spiel hätte deswegen an Spannung nicht verlieren müssen – denn bis zum Schlusspfiff hat ja keiner gewusst, dass es so enden würde.