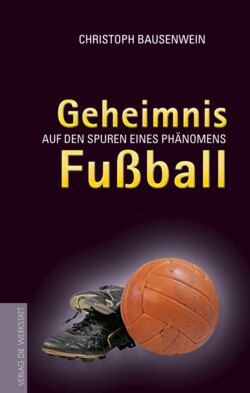Читать книгу Geheimnis Fussball - Christoph Bausenwein - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеTORE
Klaus Fischer brachte das, worum es beim Fußball geht, knapp auf den Punkt: „Tore sind das Salz in der Suppe.“ Die anderen nicht zu Potte kommen lassen und selber Tore schießen, allein das ist es, worauf’s ankommt. Den Bundesliga-Rekord von 101 Treffer in einer Saison hält Bayern München (1971/72). Den offiziellen Weltrekord in einem internationalen Spiel hält Australien mit einem 31:0 über Amerikanisch Samoa, erzielt am 11. April 2001 während der Qualifikation zur WM 2002. Nahezu unglaublich sind die Rekorde von Gerd Müller: In der Bundesliga schoss er für Bayern München 365 Tore (0,84 pro Spiel), die Bundesligasaison 1971/72 beendete er, bei 34 Spieltagen, mit 40 Treffern, und bei 62 Auftritten in der deutschen Nationalelf brachte er es auf 68 Tore. Müller war eine wahre „Torfabrik“. Den Rekord für die meisten Tore in Folge hält allerdings nicht Müller, sondern der Kölner Thomas Allofs: Er schaffte 1984 14 Tore in zehn aufeinander folgenden Spielen.
Ein weiterer Rekord geht zugleich auf einen Kölner und einen Müller. Keiner schoss in der Bundesliga so viele Tore in einem Spiel wie Dieter Müller vom 1. FC Köln. Sechsmal brachte er den Ball 1977 im Kasten von Werder Bremen unter. Spieler, die einen Hattrick schafften – drei Tore hintereinander in einem Spiel – gibt es einige. Das Kunststück eines doppelten Hattricks gelang aber nur einem. Elder Hadzimehmedovic, bosnischer Fußballprofi, schoss im Jahr 2003 beim 6:0 von Lyn Oslo gegen NSI Ruvnavik (Faröer), einem Qualifikationsspiel zum UEFA-Pokal, alle sechs Tore, je drei in einer Halbzeit. Fehlen noch die Eigentore, die gar nicht so selten vorkommen. Ein Mannschaftskamerad von Gerd Müller, Franz Beckenbauer, traf immer wieder mal ins eigene Netz. Ein Kunststück wie Nikolce Noveski gelang ihm dabei allerdings nicht: Der Mainzer fälschte den Ball im November 2005 im Spiel gegen Frankfurt innerhalb von vier Minuten zweimal so ab, dass er den Weg ins eigene Tor fand. Anschließend traf er noch einmal ins richtige, also in das des Gegners.
Um die fußballspezifische Qualität des Tores und die Leistungen von Müller, Müller & all den anderen auch richtig würdigen zu können, muss man wissen, dass der Fußball-Treffer innerhalb der Gattung der Treffer und Punkte, die bei einem Ballspiel zählen und es entscheiden, eine besondere und vor allem besonders rare Spezies ist. Beim Football und beim Rugby tritt an die Stelle der einfachen Torwertung eine komplizierte Punktrechnung verschiedener Arten von Zählern, und bei anderen Ballsportarten gibt es in der Regel eine derartige Unmenge von Toren, dass ein gelungener Versuch in keiner Weise mehr ein besonderes Ereignis darstellt. Die Fußballregeln dagegen sind so eingerichtet, dass nur äußerst wenige Tore fallen. In den 43 Spielzeiten der Bundesliga von 1963/64 bis 2004/05 fielen insgesamt 30.848 Tore in 12.794 Spielen. Das entspricht einem Schnitt von 3,11 Toren pro Spiel. Eine Entwicklung von mehr zu weniger oder von weniger zu mehr Toren ist dabei nicht zu erkennen. Die torreichste Saison gab es 1983/84 (3,58 Tore im Schnitt), die torärmste 1989/90 (2,58 Tore im Schnitt). Trotz dieser Konstanz kann es an jedem Bundesliga-Spieltag zu starken Ausschlägen nach oben oder unten kommen. Die Gesamtzahl der Treffer schwankte zwischen 11 Toren (20. Spieltag 1998/99) und 53 Toren (32. Spieltag 1983/84). Bei der Torquote gibt es demnach keine signifikanten Entwicklungen, allenfalls bei den Torschützen. Klassische Mittelstürmer à la Müller gibt es nicht mehr, heute gehören oft Mittelfeldspieler – 2004/05 etwa Mintal, Marcelinho, Ballack – zu den torgefährlichsten Leuten. In der heutigen (Straf-)Raumenge ist die Aufgabe der Stürmer nicht mehr nur die Verwertung von Vorlagen, sondern ebenso sehr auch das Sichern und Ablegen von Zuspielen, wie es etwa Dortmunds Jan Koller vorbildhaft praktiziert.
Dem Durchschnitt von drei Treffern pro Spiel entspricht das 2:1 als wahrscheinlichstes Spielergebnis (auch wenn laut einer FIFA-Statistik von 2004 das 1:0 noch etwas häufiger vorkommt). Statistisch gesehen hat damit jede Mannschaft pro Spiel mindestens eine „sichere“ Trefferchance. Ein einziges Tor kann zwar eine Partie entscheiden, aber solange sie keinen zweiten Treffer drauflegt, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der Gegner zum Ausgleich kommt und damit in der Chance, doch noch den Sieg zu erringen, gleichzieht. Beim Fußball sind Treffer demnach Höhepunkte, auf die hin die gesamte Dramaturgie des Spiels sich zusammenzieht. Aus dem Minus der Anzahl wird ein Plus der Spannung. Zwar kann es auch bei den „Vieltrefferspielen“ Handball und Basketball zu dramatischen Endphasen kommen, in der Regel aber sind die Spiele in diesen Sportarten schon lange vor dem Schlusspfiff entschieden, weil sich eine Mannschaft bereits einen uneinholbaren Vorsprung herausgespielt hat.
Die Seltenheit des Fußballtores lässt die Behauptung gerechtfertigt erscheinen, dass es eine ähnliche Qualität hat wie der K.o. im Boxen. Oder, etwas genauer ausgedrückt: Ein Tor im Fußball entspricht einem Wirkungstreffer, nach dem ein Boxer angezählt wird; der Kampf geht weiter, und vielleicht ist der angeschlagene Boxer nun erst richtig wachgerüttelt, um seinerseits die Entscheidung zu suchen. Aber bevor man weiter darüber philosophiert, wie treffend dieser Vergleich ist – klar ist allemal, dass beide Sportarten besonders spannend sind, weil in jedem Augenblick ein Schlag oder Schuss die endgültige Entscheidung bringen kann.
Fußballästheten wie der Schriftsteller Peter Handke behaupten, dass ein Spiel auch eine Augenweide sein kann, „ohne dass es zählbare Treffer gibt“. Tatsache ist jedoch, dass zum Beispiel das 0:0 im WM-Endspiel 1994 zwischen den Klasseteams aus Brasilien und Italien eher etwas für die Liebhaber von Strategie-Seminaren war. Und im Normalfall entspricht der Verlauf des typischen 0:0 eher dem des Spiels Bundesrepublik - England bei der WM 1982, das die „Welt“ so kommentierte: „Das Unentschieden gegen die Engländer war nicht mehr als ein Gleichgewicht der Ohnmacht, kein Ergebnis hätte der kärglichen Kickerei besser gerecht werden können als ein 0:0. Null Tore, null Mut, null Selbstvertrauen, null Kraft, null Stärke. Für Mathematiker null Periode, beliebig fortsetzbar also – Nulldiät oder Nullwachstum.“
Viele meinen daher, ein Fußballspiel werde nur dann interessant, wenn möglichst viele Treffer fallen. Folgerichtig fordern sie eine Reform des Fußballspiels – zum Beispiel größere Tore –, die zu einer Erhöhung der Trefferzahl führen würde. Die Ansicht, dass ein Spiel durch viele Treffer schön wird, ist sicherlich richtig, aber auch Handke liegt prinzipiell nicht falsch, denn tatsächlich kann bei einem Spiel, das 0:0 endet, interessanter und schöner Fußball geboten worden sein. Mit der bloßen Feststellung, dass ein 0:0 „auch“ unterhaltsam sein kann, und mit der kurzsichtigen Forderung nach „vielen Treffern“ kommt man jedoch nicht weiter, wenn man dem Geheimnis des Fußballtores auf die Spur kommen will.
Interessant kann ein trefferloses Spiel nur dann sein, wenn und solange beide Mannschaften über die gesamte Spielzeit hinweg versuchen, Tore zu erzielen. Spiele, bei denen nicht permanent ein Treffer droht, haben außer Langeweile kaum etwas zu bieten. Der misslungene Torschuss, der Treffer, der „in der Luft liegt“, aber doch nicht fällt, ist es, der selbst ein 0:0 spannend macht: Denn während des Spiels kennt ja noch keiner das Ergebnis. Auch die unbestreitbare Tatsache, dass gerade Spiele, in denen außergewöhnlich viele Tore fallen, später zu den „Sternstunden des Fußballs“ gerechnet werden, darf nicht zu der Annahme verleiten, dass mehr Tore zu mehr Fußball-Faszination führen würden. Kantersiege wie das berühmte 7:1 anno 1971 von Borussia Mönchengladbach über Inter Mailand sind zwar leckere Sahnehäubchen, aber wenig spannend.
Knapp entschiedene Spiele mit hoher Trefferquote, Spiele, die mit 3:4 und 4:5 enden – oder gar 5:6 wie Polen 1938 gegen Brasilien, Borussia Mönchengladbach 1969 gegen Werder Bremen oder der VfL Bochum 1976 gegen Bayern München – sind spannend, aber sehr selten. Solche Spiele sind ganz besondere Ereignisse, an die alle, die sie erlebt haben, gerne zurückdenken. Aber würden sie nicht den Appetit verderben, wenn man sie zu oft genießen kann? Wiederholung verhindert Außergewöhnlichkeit, und so sollte man dem unbekannten Dramaturgen des Fußballspiels dankbar sein, dass er „traumhafte“ Ergebnisse zwar gestattet, aber nicht zur Alltäglichkeit verkommen lässt.
„Jahrhundertspiele“ wie das 4:3 Italiens gegen Deutschland im Halbfinale der WM 1970 können nicht jedes Wochenende stattfinden. Im normalen Fußball-Alltag dürfen es ruhig auch mal ein paar Tore weniger sein. Diese Aussage hat nichts zu tun mit einem Faible des Autors für den so genannten „Betonfußball“. Denn die im Durchschnitt so geringe Trefferquote hat nicht primär damit etwas zu tun, dass Fußballspieler sich zu sehr auf das Verhindern von Toren konzentrieren würden. Da es ohne Tore keine Siege gibt, strebt jede Mannschaft normalerweise auch nach Toren. Erfolgsdenken heißt im Fußball immer „Denken in mehr geschossenen Toren“. Deswegen müssen und wollen ja auch letztlich alle Tore schießen, nur ist das eben beim Fußball besonders schwer. Zwar fallen Tore manchmal „wie aus heiterem Himmel“, sie werden aber einer Mannschaft in der Regel nicht geschenkt. Manche Mannschaften müssen sehr lange auf das nächste Tor warten. So der 1. FC Köln in der Saison 2001/02: genau 1.033 Minuten.
Das große Spielfeld, die große Anzahl der Spieler, die Schwierigkeit, den Ball sicher zu schießen – all das führt zu Vorteilen für die Abwehr. Laut verschiedener Statistiken endet beim Fußball nur ein Bruchteil aller Angriffsaktionen mit einem zählbaren Erfolg. Die geringe Trefferquote ist demzufolge weniger auf eine „Maurermentalität“ unter den Trainern zurückzuführen, als vielmehr auf die Struktur des Spieles selbst. Weil es leichter ist, Tore zu verhindern, als selbst welche zu schießen, ist der Erfolg in der Defensive besser zu planen, und so wäre es grob fahrlässig, sich in der Abwehrarbeit aufs Glück zu verlassen. Meisterschaften werden in der Regel durch die Zahl der Gegentreffer entschieden, nicht durch die Zahl der selbst erzielten Tore. Die Bundesliga-Saison 1992/93, in der Werder Bremen mit 63:30 Toren über die 74:45 Tore von Bayern München triumphierte, ist nur ein Beispiel unter vielen.
Viel von der Spannung eines Fußballspiels ist also der Tatsache zu verdanken, dass es so schwer ist, ein Tor zu erzielen. Was wäre ein Spiel ohne das Raunen des Publikums, ohne jene „AAAhs“ und „OOOhs“, die einen Schuss begleiten, der knapp am Gehäuse des Torwarts vorbeizieht, was wäre der „Sound“ eines Stadions ohne jenes Stöhnen und tiefe Durchatmen, wenn der Torwart einen „unhaltbaren“ Ball doch noch aus der Ecke fischt oder wenn der schon sicher geglaubte Treffer sich im letzten Moment als Lattenschuss oder Pfostenknaller entpuppt. Etwas zugespitzt könnte man also sagen: Viele Schüsse, die danebengehen, sorgen für mehr Spannung als eine Vielzahl von Treffern. Nur weil ihm eine Fatalität des Misslingens anhaftet, kann der Torschuss sich zum Drama entwickeln. Ein Stürmer kann sich die besten Chancen herausarbeiten und die Zuschauer von den Sitzen reißen – wenn er nicht trifft und der schon angestimmte Freudenschrei im Hals stecken bleibt, ist er ein Versager. Nicht gut hat es das Schicksal beispielsweise mit dem Kaiserslauterer Stefan Kuntz gemeint, als er in einem einzigen Spiel der Bundesliga-Hinrunde 1994 viermal hintereinander nur Pfosten oder Latte traf. Und doch würden auch zehn Fehlversuche nicht ausschließen, dass der elfte dann sitzt. Niemals aufgeben.
Für jedes Spiel gilt, dass sicher geglaubte Siege noch ins Wanken geraten, plötzliche Kontertore die Moral einer bis dahin im Sturm erfolglos wirbelnden Mannschaft vollkommen zerstören und den Spielverlauf „auf den Kopf stellen“ können. Weil der Erfolg im Fußball so wenig planbar ist, ist er auch so oft ungerecht. Eine Mannschaft kann 90 Minuten das Tor des Gegners berennen und ein Dutzend „hundertprozentiger“ Chancen herausspielen – alles ist umsonst, wenn kein Treffer gelingt und der Gegner durch einen zufällig abgefälschten Ball zum Erfolg kommt. Beim Fußball kann daher auch weniger als bei anderen Spielen die reine Tordifferenz als zuverlässiger Leistungsindikator angesehen werden. Nicht selten gewinnt die schlechtere Mannschaft, und vor dem Anpfiff kann sich selbst der größte Außenseiter eine berechtigte Chance ausrechnen. Und so liegt denn auch hier ein wesentlicher Reiz des Spiels: Ein Gegner mag übermächtig erscheinen, das Schicksal kann sich immer für den „Kleinen“ entscheiden.
Aus all dem ergibt sich das Resümee: Die Seltenheit der Treffer ist nicht als Torgeiz zu kritisieren, sondern als besonderer Torreiz zu begrüßen. In seiner Rarität ist der gelungene Torschuss eine Erfindung, um die alle anderen Sportarten den Fußball im Grunde nur beneiden können. Dass die Torquote beim Fußball genau in dem Bereich liegt, der die Spannung auf dem Gipfel halten kann, mag anfangs ein Zufall gewesen sein. Bedingt durch taktische Veränderungen hat es im Fußball immer wieder Phasen gegeben, in denen die Zahl der Treffer absank, gleichzeitig die der Unentschieden anstieg und damit die Spannung der Spiele nachließ. Meist konnte sich dann aber auch ohne größere Regeländerungen wieder eine Spannungsbalance einpendeln. Solange sich an den Regeln nichts Prinzipielles ändert, wird die „ideale“ Torquote von durchschnittlich drei Treffern pro Spiel die Richtschnur für spannenden Fußball bleiben.
Für die geringe Trefferquote beim Fußball sorgen vor allem die Wächter zwischen den Pfosten. Die spezielle Position des Torhüters wurde 1871 geschaffen, als man das bis dahin übliche Stoppen des Balles mit der Hand zum Privileg des „letzten Mannes“ machte. Seitdem ist der Torwart der einzige Spieler seines Teams, der, sofern er fehlerlos bleibt, eine Niederlage verhindern kann. Damit er überhaupt eine Chance hat, das „zu null“ für seine Mannschaft zu retten, gelten für ihn Sonderregeln. Er darf nicht nur seine Hände benutzen, er soll es auch, er muss es sogar. Wäre er bei seinen Abwehrversuchen allein auf Füße und Kopf angewiesen, hätte er kaum eine Chance, seine Aufgabe mit Erfolg zu erfüllen. Denn das Tor ist riesig: zwei Pfosten, je 2,44 Meter hoch, und ein Querbalken, 7,32 Meter breit. Die Trefferfläche, fast so groß wie die Seite eines Reisebusses und größer als manches Wohnzimmer, beträgt 18 Quadratmeter. In dieses Rechteck soll der Ball hinein. 300 Fußbälle könnte es aufnehmen. Das sind unendlich viele Einschussmöglichkeiten, die der Torwart ganz allein verhindern muss. Wie groß das Tor dem Gegner erscheint, hängt jedoch unmittelbar von dem Mann ab, der es bewacht. Manchmal ist es groß wie ein Scheunentor, ein anderes Mal erscheint es den Stürmern so, als müssten sie den Ball in einer Streichholzschachtel unterbringen – je nachdem, ob ein zitterndes Nervenbündel zwischen den Pfosten steht oder ein souveräner Supermann.
Der Torhüter ist immer die letzte Station auf dem Weg des Gegners zu einem Treffer. Dadurch wird er zum einzigen Spieler seines Teams, der ein Spiel ganz allein verlieren kann. Er kann eine hervorragende Partie liefern und ein Dutzend „Unhaltbare“ noch aus dem Eck fischen – wenn er beim 13. Schuss danebengreift, ist er dennoch der Depp. Jede gute Parade ist nur so gut wie die nächste gute Parade, denn gemessen wird der letzte Mann zuletzt nur daran, dass er keine Fehler macht. Das ist sein Schicksal, und nur selten wird er dafür gelobt, wenn er es meistert. Weil es die Tore sind, die ein Spiel entscheiden, werden verhinderte Tore kaum einmal erzählt. Im kollektiven Fußball-Gedächtnis sind in der Regel nur die Treffer verzeichnet, und an denen sind die Torhüter entweder nur als Statisten oder als Versager beteiligt. Oliver Kahn wurde bei der WM 2002 wegen seiner zahlreichen tollen Paraden zum besten Spieler des Turniers gewählt; man erinnert sich aber nicht an seine Glanztaten, sondern an seinen einzigen Fehler, mit dem er Ronaldo einen Treffer ermöglichte und damit die 0:2-Niederlage Deutschlands im Endspiel gegen Brasilien einleitete.
Auch der Titan Kahn musste also am Ende des Turniers erfahren, dass selbst der beste Torhüter dazu verdammt ist, irgendwann einmal einen Fehler zu machen. Und diese unaufhebbare Verletzlichkeit des Torhüters sorgt für den anhaltenden Reiz des Fußballspiels. Man weiß, dass der Ball irgendwann reingehen muss, vielleicht nicht bei diesem Schuss, aber möglicherweise beim nächsten oder übernächsten. Somit ist der Torhüter nicht nur der wichtigste Mann seiner Mannschaft, sondern die zentrale Komponente in der Konstruktion des Fußballspiels. Weil er die Hände benutzen darf, ist er gegenüber dem Schützen zwar stark im Vorteil, aber auch nicht so übermächtig, dass die Trefferchance gegen null geht. Der Torwart hält das Spiel insgesamt in der Waage; und zugleich ist er selbst in jedem Match – weil jeder seiner Fehler unmittelbar bestraft wird – das Zünglein an derselben. Torhüter können so gut sein, wie sie wollen, ihr Schicksal ist es, dass sie immer wieder bezwungen werden. Nur schwer werden sie zu Helden, sehr leicht zu Versagern. Aber gerade deswegen ruht auf den Schultern der letzten Männer die Verantwortung für das Gelingen des Fußballspiels. Im Positiven wie im Negativen, mit grandiosen Taten genauso wie im tragischen Versagen, sind sie die Garanten dafür, dass die „schönste Nebensache der Welt“ funktioniert.
Ganz offensichtlich ist die Größe des Tores derartig ideal auf das menschliche Vermögen ausgerichtet, einen mit dem Fuß getretenen oder aber einen „geköpften“ Ball zu fangen, dass Torerfolge zu Raritäten werden. Alles ist in der Relation zueinander so perfekt abgestimmt, dass Treffer jederzeit fallen können und zugleich selten genug bleiben, um höchst erregend zu wirken, wenn sie denn fallen. Niemand ist bislang auf die Idee gekommen, dem unbekannten Konstrukteur des Tores eine Hymne zu widmen. Es wäre nur zu berechtigt. Vielleicht ist die spannungsgeladene Torarmut aber nicht nur auf objektive Maße, sondern auch auf Psychologie zurückzuführen. Es ist nämlich anzunehmen, dass Stürmer immer dann, wenn sie ihren Blick zu sehr auf den Torwart und dessen Bewegungen richten, ungewollt diesen an- statt an ihm vorbei ins Tor hineinschießen. Soll der Torschuss gelingen, dann darf man sich von im Raum ausgezeichneten Punkten – wie eben dem Torwart, der listigerweise oft auch noch mit einem auffälligen Pullover ausgestattet ist – nicht ablenken lassen, sondern man muss cool und unberührt auf die „leeren“ Stellen zielen. Mit den Worten „Ich sah nur Loch!“ beschrieb einmal ein Schütze seinen Treffer und damit eine Kunst, die nur wenige beherrschen.
Die Ergebnisse dieser Gesamtanalyse des Fußballspiels berechtigen zu einem ersten und vorläufigen Versuch, die Frage nach dem „Geheimnis Fußball“ zu beantworten. Mit einer gewissen Verwegenheit kann behauptet werden, dass der Fußball deswegen so viele Menschen begeistert, weil er schlicht und einfach das beste aller Spiele ist: weil er einfach zugänglich und zu verstehen ist; weil er dennoch immer abwechslungsreich, komplex und anspruchsvoll in seinem Ablauf bleibt; weil der Ball in seiner Eigenbewegung den Spielverlauf mitbestimmt; weil durch die Unzulänglichkeit der Füße anspruchsvolle Kunstfertigkeit und klägliches Misslingen so nahe beieinander liegen; weil das Spielfeld von jeder Mannschaft systematisch gegliedert wird und dennoch Raum für vielfältigste spontane Aktionen bietet; weil der Ball immer frei bleibt und daher ständig umstritten ist; schließlich, weil das Tor eine Rarität ist, deren Wert man gar nicht überschätzen kann.
All dies braucht man nicht zu wissen, um nach dem entscheidenden Torschuss Freude und Beglückung oder Trauer und Niedergeschlagenheit zu empfinden, um die so lang angestaute Spannung zu entladen in grenzenlosem Jubel oder um sich in Tränen aufzulösen, die den ganzen Schmerz der Welt an die Oberfläche spülen. Es lässt sich kaum eine andere Sportart denken, in der ein einziges Tor eine nur annähernd vergleichbare Begeisterung – oder eben das Gegenteil – bewirken kann. Das deutsche Tor der Tore, jenes berühmte 3:2 gegen die hoch favorisierten, damals nahezu unschlagbar scheinenden Ungarn im Endspiel der WM von 1954, dieses Tor, das eine ganze Nation in einen Freudentaumel versetzte und noch 50 Jahre später in Deutschland eine Flut von Büchern und Feuilleton-Berichten verursachen und zum Thema eines großen Spielfilm werden sollte, dieses Tor konnte nur im Fußball fallen. Der große Held Helmut Rahn, der Schütze, erzählte hernach immer wieder in knappen Worten: „Ich zieh’ ab mit dem linken Fuß, und dat gibt so’n richtigen Aufsetzer. Wat dann passiert is, dat wisst ihr ja.“ So einfach kann man’s sehen. Man kann aber auch ein paar Worte mehr sagen.
In seinem Buch über den „Chef Sepp Herberger“ ließ sich dessen verlängerter Arm auf dem Spielfeld, der deutsche Kapitän Fritz Walter, etwas ausführlicher aus: „Der ungarische Verteidiger Budzansky holte sich eine Vorlage, die ich Hans Schäfer zugedacht hatte. Der Kölner im Zweikampf! Seine Zähigkeit machte sich bezahlt. Nicht Budzansky, sondern Schäfer zog mit dem Ball davon. Ein paar Schritte. Weich und wunderschön segelte seine Flanke gegen den gegnerischen Strafraum. Zwei ungarische Abwehrspieler sowie Morlock und Ottmar sprangen hoch. Keiner erwischte den Ball richtig. Er trudelte langsam vom gegnerischen Strafraum weg. Da stürmte mit seinen mächtigen Schritten der Boss herbei. Jetzt, jetzt – aus vollem Lauf heraus muss er schießen, dachten wir. Auch das Publikum wartete darauf. Die Verteidiger starrten wie hypnotisiert auf Helmuts rechten Fuß und warfen sich in die vermeintliche Schussbahn. Doch was machte Rahn, der links so gut wie rechts schießt? Im entscheidenden Sekundenbruchteil bremste er ab, nahm den Ball mit dem rechten Fuß an und zog ihn mit einer Körpertäuschung nach links. Er suchte sich eine Lücke aus und donnerte aus 17, 18 Metern mit dem linken Fuß in die linke untere Torecke. Keine Chance für Ungarns Schlussmann! Diesen flachen, scharfen Ball konnte er nicht erreichen. Grosits am Boden! Helmut am Boden! Mehrere Abwehrspieler am Boden! Das war die Sekunde, in der Rahn das Tor seiner Tore schoss, die Sekunde, in der es Herberger von der Bank hochriss. Die Sekunde, die die Ungarn wie ein Blitz traf, in der die Entscheidung fiel, in der Fußball-Deutschland in eine nie erlebte, unvergessliche Ekstase geriet. ‚Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland!‘, schrie heiser vor Erregung Rundfunk-Kommentator Herbert Zimmermann in sein Mikrofon.“
Zwei Minuten später rief Zimmermann fünfmal „Abseits!“, als es hinter Toni Turek eingeschlagen hatte. „Der Zufall wollte es“, so Zimmermann später, „dass zwischen Puskas und mir genau Linienrichter Griffith stand. Sein Winken war für mich zu erkennen, noch bevor Puskas schoss. So war mein Abseitsruf wohl eine Erlösung für alle Hörer. Dann noch zwei Minuten Daumendrücken, ein Flachschuss von Czibor, eine Parade von Turek, und aus war das Spiel.“
So war das also. Das heißt, nicht ganz. Denn neben der Freude der Deutschen gab es ja noch die andere Seite, die Trauer der Ungarn. Jenö Budzansky (bzw. Buzanszky) leidet bis heute unter dem von Fritz Walter verbreiteten Gerücht, er habe durch eine Nachlässigkeit Schäfers Flanke verursacht. Buzanszky war rechter Verteidiger. Links aber stand ein anderer: „Bozsik war’s, Bozsik“, musste sich Buzanszky noch als 80-Jähriger verteidigen. Und der Torwart, Grosits (bzw. Grosics)? In einem Interview im Juli 2005 sagte er: „Ich zähle nicht mehr, wie oft ich davon träume. Ich habe dieses Spiel hunderttausendmal gespielt, ich sehe Helmut Rahns Schuss zum 3:2 und meine Hand. Es kommen Millionen Variationen heraus, was wir besser hätten machen können. … Es ist hoffnungslos. … Es ist nie etwas gekommen, was mich über dieses 2:3 hätte hinwegtrösten können. Wir haben verloren, es schmerzt heute noch, und es wird immer wehtun.“
Es schmerzt, weil es eigentlich nicht zu begreifen ist, wie diese Mannschaft geschlagen werden konnte. Eine Mannschaft, die zuvor 34 Spiele lang ungeschlagen war und danach weitere 18 Spiele unbesiegt bleiben sollte. Nach dem verlorenen Spiel herrschte in Ungarn lange Zeit der Glaube, dass jene „goldene Mannschaft“ mit sauberen Mitteln unmöglich zu schlagen gewesen sei. Es wurde behauptet, dass die Spieler den Sieg verkauft und als „Judasgeld“ 50 Mercedes erhalten hätten. Torwart Grosics und Verteidiger Buzanszky wiesen solche Vorwürfe empört zurück. Gyula Grosics hält eine „Rache“ der Engländer für möglich. Zumindest hätten die Entscheidungen des englischen Schiedsrichters Ling das Spiel beeinflusst: „Nach unserer Meinung war das 3:3 durch Ferenc Puskas regulär, und vielleicht stand Max Morlock beim 1:2 im Abseits.“
Doch auch ohne Schiedsrichter-Schelte lassen sich Gründe für die ungarische Niederlage finden. Der verletzte Puskas konnte nicht so laufen, wie er wollte, die Spieler waren nach der 2:0-Führung sehr überheblich, und zudem funktionierte die Abstimmung in der zweiten Halbzeit nicht so wie gewohnt. Man sei sich, so Jenö Buzanszky, nach der Pause nicht mehr „einig“ gewesen. Der Sand im Getriebe der ungarischen Kombinationsmaschinerie öffnete die Lücken für Herbergers Schützlinge. Der „Weise von der Bergstraße“ hatte freilich schon vorab erkannt, dass sich auf der Seite von Bozsik Löcher auftaten, wenn dieser zu stürmisch nach vorne drängte. Alle drei deutschen Tore wurden über die linke ungarische Abwehrseite vorbereitet. Darüber hinaus hatten die Deutschen eine Menge Glück. Johann Schlüpers Rekonstruktion des Endspiel-Films macht erst so richtig deutlich, wie überlegen die Ungarn trotz allem waren.
Kurz: Man muss einfach zugeben, dass der deutsche Sieg weder zwingend war noch zwingend als „verdient“ bezeichnet werden muss. Aber hätten sich die Deutschen deswegen nicht freuen sollen? Und hatten sie umgekehrt zwölf Jahre später nicht alles Recht der Welt, sich zu beschweren, als sie das Endspiel diesmal völlig zu Unrecht verloren?
„Achtung, Achtung! Hei – nicht im Tor, kein Tor – oder doch? Jetzt, was entscheidet der Linienrichter? Tor!“ So kommentierte ARD-Reporter Rudi Michel die Situation in der 11. Minute der Verlängerung des WM-Finales 1966 zwischen England und Deutschland. Geoffrey Hurst hatte eine Flanke von Alan Ball aufgenommen und das Leder aus halbrechter Position auf Tilkowskis Kasten gewuchtet. Der Ball war an die Unterkante der Latte geknallt, von dort zurück auf den Rasen gesprungen, und der herbeigeeilte Weber hatte ihn über die Querlatte ins Toraus geköpft. Drin oder nicht drin? Das war die Frage, die damals alle Gemüter erhitzte und bis heute Diskussionen auslöst.
Natürlich sahen alle Engländer den Ball „drin“. Der englische Linksaußen Hunt riss sofort jubelnd die Arme hoch. Das war das 3:2 dachten alle Zuschauer, und das Wembley-Stadion erbebte nach einem Moment kollektiver Unsicherheit im Aufschrei der Freude. Weniger selbstverständlich war, dass der deutsche Bundespräsident Heinrich Lübke ein Tor sah. Weil er offensichtlich dem Gastgeber England gegenüber ein Verlierer mit Stil sei wollte, behauptete er sogar etwas, was keinesfalls geschehen sein konnte. Beim Empfang der am Ende mit 2:4 unterlegenen deutschen Nationalmannschaft in der Villa Hammerschmidt fand er gegenüber Helmut Haller folgende tröstende Worte: „Herr Haller, ärgern Sie sich nicht über das dritte Tor. Ich habe im Fernsehen genau gesehen, wie der Ball im Netz zappelte.“
Für den entscheidenden Mann auf dem Platz, den Schiedsrichter, war es kein Tor. Jedenfalls zunächst. In seiner ersten spontanen Reaktion gab der Schweizer Gottfried Dienst Eckball. Erst die tobende Menge im Stadion und die wild protestierenden Engländer veranlassten ihn, sich mit seinem Linienrichter zu beratschlagen. Eigentlich wäre es überflüssig gewesen. Denn der Linienrichter, ein Russe namens Tofik Bachramow, war nämlich stehen geblieben und nicht, wie es zum Zeichen eines Tores üblich ist, in Richtung Mittellinie gelaufen. Von daher war alles klar: Eckball von rechts für England. Dienst befragte Bachramow dennoch. Was geredet wurde, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Dienst äußerte, dass der Mann an der Seitenlinie auf die Frage, ob der Ball hinter der Linie gewesen sei, geantwortet habe: „Yes, behind the line.“ Bachramow selbst hat später in einem Interview erklärt, dass er nicht gesehen habe, ob der Ball hinter der Linie war. Doch habe er beobachtet, „wie der Engländer Hunt nach dem Schuss von Hurst seine Arme hochriss. Ich sah auch, dass der deutsche Torwart einen untröstlichen Eindruck machte. Deshalb muss es Tor gewesen sein.“ Hurst selbst, der zunächst jahrelang geschwiegen hatten, schrieb in seinem Buch „1966 and All That“: „Die Deutschen hatten das Gefühl, dass ihnen der angesehenste Preis im Weltfußball gestohlen worden war. Vielleicht war das geschehen“, räumte er ein. „Sie glaubten aufrichtig, dass der Ball die Linie nicht überschritten hatte, und es könnte sein, dass sie Recht haben. Nachdem ich jahrzehntelang alle Argumente gehört und die Wiederholungen Hunderte von Malen gesehen hatte, muss ich einräumen, dass es so aussieht, als habe der Ball nicht die Linie überschritten.“ Allerdings schränkte er ein: „Sofern nicht jemand das Gegenteil beweist, stimme ich mit den Herren Dienst und Bachramow jedoch überein.“
Jahre, Jahrzehnte lang wurde untersucht, ob der Ball nun drin war oder nicht. 1995 kam eine wissenschaftliche Untersuchung zweier Maschinenbau-Ingenieure von der Universität Oxford zu dem Ergebnis: nicht drin. Doch selbst nach diesem Ergebnis wird noch weiter gestritten. Dabei könnte man es sich doch so einfach machen. Wer die Fernsehaufnahmen vom Endspiel aufmerksam betrachtet, kann mühelos erkennen: In dem Moment, in dem der von der Latte zurückspringende Ball den Boden berührt, staubt es. Stauben aber kann es nur, wenn der Ball die mit Kreide markierte Torlinie berührt hat. Somit ist klar, dass er nicht hinter der Torlinie gelandet sein kann, jedenfalls nicht so, wie es die Regeln verlangen, nämlich mit vollem Umfang. Also bleibt nur der einzig mögliche Schluss: nicht drin.
Manche Kommentatoren wie der „Kicker“-Redakteur Robert Becker vermuteten hinter Bachramows Verhalten einen russischen Racheakt, denn immerhin hatte Deutschland die UdSSR im Halbfinale ausgeschaltet. Andere monierten, dass Dienst – unabhängig davon, ob der Ball nun drin war oder nicht – sich sowieso zwei Fehler habe zuschulden kommen lassen: Erstens hätte er seine erste Entscheidung nicht zurücknehmen, und zweitens hätte er nicht auf den Linienrichter hören dürfen. „Torentscheidungen“, so Carl Koppehel im damaligen Standard-Lehrbuch, „soll der Schiedsrichter immer nur aus eigener Wahrnehmung treffen und niemals den Linienrichter befragen, ob der Ball die Linie überschritt oder nicht.“
Bis die Seele des deutschen Fußballfans das „dritte Tor“ endgültig verdaut hat, wird wohl noch eine Weile vergehen. Als die „Bild“-Zeitung im Oktober 1995 ihre Leser fragte, was sie am liebsten täten, wenn sie denn eine Zeitreise machen könnten, antwortete ein Herr Maier aus Castrop-Rauxel: „Ich möchte Linienrichter beim Wembley-Tor sein … und dem Schweizer Schiedsrichter Dienst sagen, Hursts Schuss war kein Tor!“ Zeitreisen gibt es aber leider nicht, und so wird sich auch Herr Maier damit abfinden müssen, dass das „Wembley-Tor“ zählt. Für immer. Somit bleibt nur zu konstatieren: Im Fußball ist (fast) alles möglich. Manchmal kann, wie beim Finale 1954, der weniger Gute gewinnen. Und manchmal kann sogar ein Tor entscheidend sein, das eigentlich gar keines war.