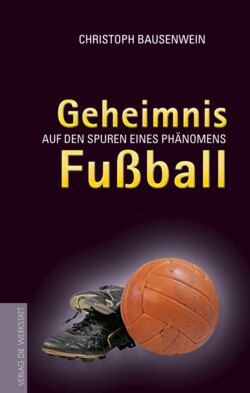Читать книгу Geheimnis Fussball - Christoph Bausenwein - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBÄLLE
„Das Geheimnis des Fußballs ist ja der Ball“, lautet ein berühmter Spruch von Uwe Seeler. Für ein spontanes Fußballspiel benötigt man aber im Prinzip gar keinen Ball. Schließlich kann man in jedem Schulhof beobachten, wie irgendein x-beliebiges Ding zu einem wilden und begeisterten Herumstoßen einlädt. Aber wenn man etwas zumindest Ballähnliches hat, macht das Spiel mehr Spaß. Der erste „Fußball“ war eine Schweineblase, die man mit Lungenkraft aufblies und an den Enden wie einen Luftballon verknotete. Mit einem solchen Spielgerät machte noch Klaus Theweleit, der bekannte Autor der „Männerphantasien“, in der bundesdeutschen Nachkriegszeit erste Kick-Erfahrungen. Mit Begeisterung beschrieb er ihre Eigenschaften: „Die Blase eiert beim Fliegen, taumelt und torkelt durch die Luft wie ein Luftballon. … Sie ist gerade schwer genug, ein paar Meter weit zu fliegen, wenn man kräftig gegen sie tritt und sie am günstigsten Punkt erwischt. Im Flug bremst sie sich durch geringes Gewicht und eine taumelnde Flugbahn. Sie scheitert am Luftwiderstand und an der eigenen Ballistik. Sie ist also ganz und gar kein Fußball, sie ist gerade so viel Ahnung eines Fußballs, dass sie an seiner statt benutzt werden kann – und gerade darin liegt das Wunderbare. Die Schweinsblase ebnet die Unterschiede zwischen den Spielern ein. Niemand kann einen satten Schuss mit ihr abgeben. Niemand kann elegant drei Gegenspieler umspielen und dann auflegen oder abziehen. Ihre geringe Gravitation und die Unberechenbarkeit ihrer Flugkurven lassen es nicht zu. Sie bleibt hängen, sie landet, wo sie will, beim Mitoder beim Gegenspieler. Sie gehorcht dem Fuß- oder Kopfballspiel der Kleinen genauso gut oder genauso wenig wie dem der Großen. Es ist ihren Launen überlassen, wer das Tor schießt.“
Der kleine Theweleit war aber dann doch froh, dass er sein Können irgendwann an einem zum Kicken weit besser geeigneten Plastikball erproben konnte. Aber auch der ist mit seinen unberechenbaren Flugeigenschaften nur ein mäßiger Ersatz für einen „richtigen“ Fußball. Dessen Geschichte begann, als Schuhmacher eine Lederhülle für die aufgeblasene Schweineblase ersannen. Da sie dabei die Form der Blase berücksichtigen mussten, waren die ersten Lederbälle pflaumenförmig, vielleicht runder als ein heutiger Rugby-Ball, aber sicher nicht kugelrund. Eine Revolution in der Ballgeschichte bedeutete daher die Erfindung des Lösungsmittels für Kautschuk durch den Engländer Mackintosh und die daraus sich ergebende Möglichkeit, Gummiblasen herzustellen. Seit 1862 wurden mit der „india rubber bladder“ runde Bälle produziert. Auch die waren allerdings noch nicht perfekt, da sie auf zwei Seiten einen „Knopf“ hatten, an dem die zusammentreffenden Lederstreifen vernäht wurden.
Im März 1866 wurde erstmals für das Spiel einer Auswahl aus Sheffield und London die Verwendung eines bestimmten Balles beschlossen: Es war der „Lillywhite’s No. 5“. Dieser Ball wurde dann zum Standardball beim 1871 eingeführten FA-Cup bestimmt. Gleichzeitig wurde eine einheitlichen Ballgröße festgelegt. Der Umfang solle nicht weniger als 27 und nicht mehr als 28 Inches betragen. Diese Festlegung entspricht dem bis heute üblichen Maß (der Umfang soll mindestens 68 und höchstens 70 Zentimeter betragen). Die Qualität der Bälle erfuhr eine weitere deutliche Verbesserung mit den „knopflosen“ Bällen, die seit den 1880er Jahren zum großen Verkaufsschlager auf dem wachsenden Markt für Fußball-Utensilien wurden. Ganz rund waren aber auch diese noch nicht, da sie mangels eines geeigneten Luftventils verschnürt werden mussten. Dieser „Knubbel“ am Lufteinlass konnte ein unrundes Rollverhalten verursachen und war zudem beim Kopfball-Kontakt nicht selten Ursache von Verletzungen.
Noch bei den ersten beiden Weltmeisterschaften in Uruguay und Italien verwendete man einen aus zwölf bzw. achtzehn Streifen gefertigten „Knubbel-Ball“. Kopfball-Tore waren dementsprechend ein recht außergewöhnliches Ereignis. Als bei der WM 1938 in Paris erstmals ein rundum glatter Ball mit Ventil verwendet wurde, hatte dies einen unmittelbaren Einfluss auf die Spielweise. Waren beim vorherigen Turnier nur zwei von 70 Treffern per Kopf erzielt worden, so waren es nun 17 von 84.
Die Abschaffung der harten und hinderlichen Verschnürung ist den Argentiniern Antonio Tossolini, Juan Valbonesi und Luis Polo zu verdanken, die im Jahr 1931 eine aufblasbare Gummiblase mit Ventil erfanden. Ob sie wirklich die Ersten waren, ist allerdings nicht ganz sicher. Denn mit einer ähnlichen Erfindung warteten etwa zur selben Zeit auch die Sportartikel-Fabrikanten Gutkind & Einstein aus Nürnberg auf, die bereits seit Anfang der 1920er Jahre Spitzenbälle produzierten. Der von der jüdischen Firma entwickelte und ausschließlich über den Verband deutscher Sportgeschäfte vertriebene „selbstschließende Ball ohne Verschnürung“ konnte jedoch nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten keine WM-Geschichte mehr schreiben.
Nach der Erfindung des Ventils war im Prinzip nur noch das Leder ein Problem. Denn die in der Regel aus 12 oder 18 Lederstreifen zusammengenähten Bälle konnte man soviel einfetten, wie man wollte – wenn es regnete, dann sogen sie sich unweigerlich mit Wasser voll und wurden im Verlauf des Spiels immer schwerer. Aus diesem Grund legte man fest, dass das Standardgewicht des Balles im trockenen Zustand, also zu Spielbeginn, zu ermitteln ist. Seit 1937 ist es auf mindestens 410 und höchstens 450 Gramm festgelegt. In den 1940er und 1950er Jahren waren in England vor allem zwei Modelle im Gebrauch: Im Winter benutzte man den teueren „Tugite“, da an diesem der Matsch nicht so festklebte, in der trockeneren Zeit ab März begnügte man sich mit dem billigeren Thomlinson „T“. Dieser nicht aus Streifen, sondern aus T-förmigen Teilen bestehende Ball war bei moderaten Verhältnissen ganz passabel, im Sommer allerdings, wenn der Boden knochenhart war, sprang er wie verrückt umher und war kaum zu kontrollieren. Um diesen Effekt zu verhindern, brachte man in den „T“ eine weitere Gummiblase ein und tauchte ihn über Nacht in Wasser. Dann war er nicht mehr leicht wie ein Luftballon und rollte wie eine Kugel. Pech hatte man aber, wenn dann Regen fiel. Der Ball dehnte sich aus und konnte, so heißt es, im Lauf eines Spieles durch die aufgesogene Nässe sein Gewicht verdoppeln.
Im Jahr 1963, als die Bälle immer noch schwer, unberechenbar und beim Kopfball schmerzhaft waren, begann die Firma Adidas mit der Produktion von Matchbällen. Bereits zur WM 1966 lieferte der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach 300 Bälle in den Farben orange, gelb und weiß. Offizielle WM-Bälle gibt es jedoch erst seit 1970, als die FIFA mit Adidas einen Vermarktungsvertrag schloss. Mit dem in Mexiko verwendeten „Telstar“ wurde die heutige Gestalt des Balles allgemeinen üblich. Der Ball war jetzt schwarz-weiß und wurde nicht mehr aus 18 Streifen, sondern aus 20 weißen Sechseck- und zwölf schwarzen Fünfeckteilen zusammengesetzt. Bei der WM 1986 wurde mit dem „Azteca“ erstmals ein komplett synthetischer Ball benutzt. Mit dem völligen Verzicht auf Leder wurde nicht nur die Widerstandsfähigkeit und Formbeständigkeit erhöht, sondern endlich auch das Nässeproblem gelöst. Problematisch blieben die zunächst aus Materialien wie Polyurethan und Neopren gefertigten Bälle aber dennoch. Vor allem von den Torhütern wurden sie wegen ihres unberechenbaren Flugverhaltens kritisiert. Die früher üblichen Lederbälle standen lange in der Luft, und nur deswegen bekam ein Torhüter die Zeit, sie in aller Ruhe abzugreifen. Die modernen Kunststoffobjekte hingegen zischten nun mit einem enormen Tempo heran, und darüber hinaus flogen sie nicht gerade, sondern „zappelten“ unberechenbar. Aber auch die Feldspieler stellten sie, vor allem in Kombination mit ungewohnten Rasenmischungen, vor ungewohnte Probleme. Während der WM 1994 meinte der Fernsehkommentator Heribert Faßbender, die hohe Quote technischer Fehler auf die für die Spieler ungewohnte Kombination von amerikanischem Rasen und neuem „Questra“ zurückführen zu können: „Ich glaube, dass der Ball ein anderes Abrollverhalten hat.“
Den perfekten Ball also scheint es nicht zu geben; er kann ja auch nie ganz rund sein, wie der Physiker weiß, höchstens beinahe. Moderne Kunststoffbälle werden in speziellen Testcentern stundenlang gerubbelt, in Wasser getaucht, zusammengestaucht, von Robotern getreten und an die Wand geschleudert. Und dennoch gibt es immer wieder Unzufriedene. Bei der WM 2002 schien der als revolutionäre Neuentwicklung vorgestellte „Fevernova“ vielen Spielern keineswegs perfekt. „Zu leicht“, „zu schnell“, „zu flatterhaft“ lautete das Urteil. Den WM-Ball 2006, den „Teamgeist“, stellte Adidas mit der Bemerkung vor, er sei so rund wie nie zuvor. Das Design ist völlig neu. Der Teamgeist besteht nicht mehr aus 32 Teilen, sondern nur noch aus 14 nahtlos miteinander verbundenen „Panels“, von denen sechs wie „Propeller“ (oder „Katzenzungen“) und acht wie „Turbinen“ geformt sind. Natürlich soll der Ball besser sein als alle zuvor: weniger Luft verlieren, weniger Wasser aufnehmen, er soll sich weniger verformen, ebenmäßiger sein und präzisere Schüsse erlauben. Auch dieser Ball hat dennoch seine Kritiker gefunden. Sicher ist nur eines: Er wird mit einem Druck von 0,6 bis 1,1 Atmosphären aufgepumpt und daher sehr flug- und sprungfähig sein.
Der Siegeszug des Fußballspiels begann mit der serienmäßigen Herstellung kugelförmiger Bälle. Zwar kann mit nahezu jedem Gegenstand kicken, doch es ist kaum vorstellbar, dass ein mit Würfeln oder Kartoffeln ausgetragenes Spiel im Stadion die Massen begeistern könnte. So lautet denn auch die größte aller Fußballweisheiten, die der Trainer-Legende Sepp Herberger zugeschrieben wird: „Der Ball ist rund.“ Rugby- und Footballspieler pflegen sich heftig zu wehren, wenn man ihr Spielgerät als „Ei“ bezeichnet und bestehen auf dem Namen „Ball“. Herbergers Weisheit können sie jedoch nicht für sich in Anspruch nehmen, und so muss man bei der Ergründung des Fußball-Geheimnisses bei der Kugelförmigkeit des Spielgeräts beginnen.
Nach jeder Seite hin geschlossen, fasziniert die Kugel durch ihre vollkommene geometrische Ordnung. Als ein Gegenstand, der kein „Oben“ und kein „Unten“, keine Vorder- und keine Rückseite, keinen Anfang und kein Ende hat, ist sie greifbares Sinnbild für die Dreidimensionalität des Raumes. Die Kugel fasziniert darüber hinaus durch ihre in sich selbst ruhende Spannung. Weil sie ihren Schwerpunkt in der Mitte hat, ist sie immer kurz davor, sich in Bewegung zu setzen. Schon durch den kleinsten Stoß beginnt die Kugel zu rollen und entwickelt ein Eigenleben. In sich stabil, aber zugleich labil, weil sie nie liegen bleiben will und den Vorzug einer Bewegungsrichtung oder Lage nicht kennt, wird sie zu einem Wunder an Beweglichkeit. Kein anderer Gegenstand ist so geeignet, zu einem natürlichen Spielpartner zu werden. Einmal in Bewegung versetzt, fordert die überraschende Eigenwilligkeit der Kugel sofort wieder eine Reaktion heraus, und so hat, ehe man sich versieht, ein Spiel begonnen, ein Hin und Her von Anstoß und Bewegung.
Jedes Spiel mit einem luftgefüllten Ball profitiert von diesen so wunderbaren wie wundersamen Eigenschaften der Kugel. Erst der flexible runde Ball kann jedoch – als eine Kugel, der gleichsam „auf die Sprünge geholfen“ wurde – nicht nur rollen, sondern er kann fliegen, als ob er von unsichtbaren Flügeln getragen würde, er kann große Sätze machen wie ein Känguru und so kleine Hüpfer, wie wenn ein Frosch drin säße. Erst der elastische Ball wird zu jenem tückischen Objekt, dessen Eigenbewegung nahezu unberechenbar wird. Weil der Ball sich so leicht – fast wie von selbst – bewegt, ist es nicht nur der Spieler, der mit dem Ball spielt, sondern der Ball selbst wird zu einem Gegenüber, das sich so verhält, als ob es einen eigenen Willen hätte. Deswegen ist der sinnlich erfahrbare, bewegliche, eigenwillige Ball das vollkommenste Spielgerät und für jedes Kind ein erster Freund.
All das gilt nicht für den beim Rugby und beim American Football üblichen elliptischen „Ball“. Zwar hat auch er bestimmte Qualitäten – so kann er wegen seiner „Handsamkeit“ leicht gegriffen und getragen werden und hält wegen seiner aerodynamischen Form beim Pass des Quarterbacks auch über weite Entfernungen eine stabile Flugbahn –, doch alle Qualitäten der Rundheit, vor allem die freie Beweglichkeit, gehen ihm ab. Auch andere, runde Bälle haben bestimmte Eigenschaften, die den spezifischen Spielzwecken entsprechen. So sind etwa Hockey- oder Golfbälle massive Kugeln, die mangels Elastizität kaum eine Eigendynamik entwickeln. Auch der größere Handball ist so hart, dass er zwar eine Geschwindigkeit wie eine Kanonenkugel entfalten kann, dabei jedoch äußerst starr und unbeweglich bleibt. Im Gegensatz dazu sind Volley- und Basketbälle zwar extrem sprungfreudig, können aber – die einen, weil sie zu leicht, die anderen, weil sie nicht stabil genug sind – kein hohes Tempo über weite Entfernungen entwickeln. Erst dem Fußball gelingt, obwohl er in keinem der genannten Aspekte Höchstwerte erreicht, eine Mischung aus Größe, Härte und Weichheit, in der sich die verschiedenen Eigenschaften anderer Bälle vereinigen. Und genau das verleiht ihm, wie gleich zu zeigen sein wird, eine überraschende Vielfältigkeit des Spielverhaltens.
Fußbälle können zwar ziemlich unterschiedlich sein – das zeigte die obige kurze Ballgeschichte –, aber das Grundlegende, nämlich rollen, können sie alle. Das Rollen ist die spezifische Differenz des Fußballs zu allen anderen, in Mannschaftssportarten verwendeten Spielgeräten. Während der Ball bei den mit der Hand geführten Sportarten von Spieler zu Spieler geworfen oder geschlagen wird, bleibt er nach einem vom Fuß erteilen Rollkommando zuerst einmal am Boden. Dort kann er dann, abhängig vom je verwendeten Material wie von der Beschaffenheit des Untergrunds, eine ziemliche Eigenwilligkeit entwickeln, die zu bändigen alle Spieler immer wieder vor größte Schwierigkeiten stellt.
Fußbällen werden aber auch noch ganz andere Aufgaben abgefordert: Sie müssen nicht nur rollen, sondern auch weit fliegen, springen, abprallen und durch die Luft zischen können. Im Gegensatz zu anderen Bällen braucht der Fußball nicht in irgendeiner einzelnen Funktion perfekt zu sein; seine wichtigste Eigenschaft besteht vielmehr darin, möglichst viele Eigenschaften in sich zu vereinigen. Der Fußballer benötigt einen Ball, der für alle Situationen taugt. Gleich, ob er ihn nur zart antupft oder locker über den Gegner lupft, ob er ihn weit in den Raum passt oder hoch in den Strafraum zieht, ob er ihn weich ins Tor schiebt oder hart in die Maschen drischt, ob er ihn sanft streichelt oder grob gegen ihn tritt – es ist immer derselbe Ball, der all das mit sich machen lassen muss. Um all diese vielfältigen Funktionen erfüllen zu können, darf sich der Ball weder zu schwerfällig noch zu springfreudig zeigen. Es ist ein Spielgerät vonnöten, das in Größe und Schwere sowie in Härte und Nachgiebigkeit die rechte Mitte findet. Vermutlich lässt sich viel von der Faszination des Fußballspiels durch die Vielseitigkeit des Balles erklären. Der Reichtum jedenfalls, den die Fußballersprache zur Beschreibung der Eigenbewegungen des Balles bereithält, ist unvergleichlich. Wo sonst spricht man davon, dass der Ball „wie ein Hase“ über den Acker hoppelt oder „wie auf einem Strich gezogen“ in die Maschen rauscht, plötzlich abdriftet und an die Latte knallt? Dass er als „Flatterball“ den Torwart verwirrt, dass er ins Netz trudelt oder eine Weile auf der Linie tanzt, um dann im letzten Moment doch noch am Tor vorbeizukullern?
Die Analyse des Fußballes zeigt, dass ihm im Vergleich zu anderen Bällen eine besonders ausgeprägte „Lebendigkeit“ zugeschrieben wird. Nur beim Fußball kann neben den Spielern auch der Ball selbst „laufen“, hat er „die beste Kondition“ und ist er widerborstig wie ein verzogenes Kind. Vor allem in Zeiten, als die per Hand gefertigten Bälle sich noch durch eine hohe Individualität auszeichneten und man bestrebt war, möglichst mit dem eigenen, gewohnten Ball zu spielen, hatten die Fußballer ein besonders intimes Verhältnis zu ihrem Spielgerät. So geht vom großen Fußballweisen Sepp Herberger die Mär, dass er schon am Klang eines aufspringenden Balles gehört habe, ob er „gut“ war oder „schlecht“: „Klang es dumpf und hohl, dann schüttelte er den Kopf: Der hat keine Seele, der ist leblos. Wie Recht er hatte“, so sein Musterschüler Fritz Walter, „spürten wir später. Der Ball spielte nicht mit, er sang nicht, er ließ sich nicht streicheln, er war nicht Kamerad und Freund des Spielers, sondern ein Fremder.“
Zu Lederball-Zeiten bestanden viele Teams darauf, nur mit ihrem gewohnten Ball zu spielen. So wurde etwa der 1. FC Nürnberg während einer Spanien-Tournee im Jahr 1923 von den Verantwortlichen des FC Irun „gezwungen“, mit einem ungewohnt großen „spanischen“ Ball zu spielen. Umgekehrt erging es den Engländern 1947 in Portugal. Da nämlich bestanden die Gastgeber auf einem kleinen Ball (Größe Nr. 4). Das Spiel begann dann mit einer normalen Nr. 5, doch nach dem ersten Tor wurde er durch einen kleineren ersetzt. Dass die Ballgröße allein nicht entscheidend ist, zeigen die Ergebnisse der Spiele: Nürnberg gewann 1923 mit 5:0, die Engländer siegten 1947 mit 10:0. Salomonisch war übrigens die Lösung beim WM-Finale 1930: Weil man sich vorher nicht hatte einigen können, tauschte man in der Halbzeit das Spielgerät. Nachdem die Argentinier mit „ihrem“ Ball bis zum Pausenpfiff mit 2:1 in Führung gegangen waren, hatten sie dann anschließend gegen den Ball der Uruguayer keine Chance mehr und verloren am Ende mit 2:4.
Selbst in Zeiten industriell gefertigter Normbälle hat noch so mancher Fußballer ein intensives Verhältnis zu seinem runden Liebling. So bekannte Günter Netzer, langhaariger „Rebell am Ball“ und Frauenschwarm, „ein sinnliches Verhältnis zu meinem Objekt“, und der argentinische Superstar Diego Maradona erkannte darin gar Frau und Mutter zugleich. Folgerichtig beschrieb Berti Vogts einmal in einer seiner gelungensten Formulierungen ein Jahrhundertspiel als eines, „in dem der Ball viele Liebhaber hatte“. Trotz Bertis Gruppensex-Phantasie muss der Preis für die größte ballphilosophische Tiefe dem fiktiven Mittelstürmer Bill Week zuerkannt werden. Der Held in Melchior Vischers Theaterstück „Fußballspieler und Indianer“ (1924) postulierte die totale Anverwandlung des Kickers an sein Spielgerät: „Wisst ihr, was das heißt: Fußball spielen? – Die eigene Seele wird zur Fußballseele, das Herz und die Haut zum Leder.“
So viel Ballyhoo braucht der durchschnittliche Feld-, Wald- und Wiesenkicker nicht zu treiben. Dennoch: Auch für ihn gilt, dass er den Ball nicht „knechten“ darf, sondern als Spielpartner ernst nehmen muss. Beim Handball mag es genügen, einfach nur den Ball zu spielen, der Fußballer jedoch muss mit dem Ball spielen. Er gehorcht nur dem, der sich auf seine Eigenbewegung einlässt, der bereit ist, seine „Seele“ nicht zu brechen, und der in der Lage ist, sie aufzufangen und zu bewahren.
Vielleicht liegt ja ein Geheimnis des Fußballs darin, dass er, wie es der Schriftsteller Jean Giraudoux ausdrückt, „die maximale Wirkung des Balles zur Geltung bringt“. Alles Runde und so natürlich auch der Ball gilt als Symbol für den unberechenbaren Zufall, und vielleicht liegt genau hierin die „gewisse philosophische Tiefe“, die dem berühmten Satz von Sepp Herberger zugesprochen wurde. „Der Ball ist rund“ – das heißt, dass der Ball oft nicht das macht, was der Spieler will, sondern das, was er selbst will. Nicht zuletzt deswegen – dies zur philosophischen Vertiefung – ist im Fußball „alles möglich“.