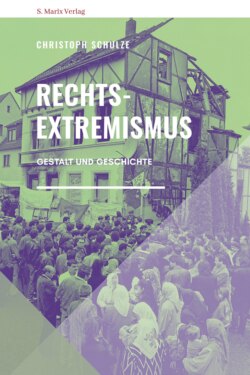Читать книгу Rechtsextremismus - Christoph Schulze - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Demokratie und Autoritarismus
ОглавлениеDie Kleinstpartei »Die Rechte« stellt sich in ihrem Programm an prominenter Stelle als eine entschieden demokratische Kraft dar: »vollinhaltlich und ohne jeden Vorbehalt« bekennt sich die Gruppierung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik und zum Grundgesetz. Tatsächlich aber hat »Die Rechte« – eine klar als neonazistisch einzuordnende Gruppe – mit Demokratie und Grundgesetz nichts am Hut. Wenn sie sich positiv auf solche Begriffe bezieht, geht es ihr darum, sich gegen drohende Repressionen oder ein Verbot abzusichern. Bekenntnisse zur Demokratie dienen Rechtsextremen häufig nur dazu, ihre wirklichen Ziele zu verschleiern. Nur eine Minderheit der Rechtsextremen lehnt Demokratie und Grundgesetz offen ab, wie etwa »Der III. Weg«, eine weitere Neonazipartei, die umstandslos das »Grundgesetz als Organisationsform der Fremdherrschaft« geißelt.
Jedoch ist das Verhältnis der extremen Rechten zur Demokratie komplexer, und nicht nur auf die Frage nach einer offenen oder verschleiernden Kommunikation ihrer politischen Ziele zu reduzieren. Manche der demokratiepolitischen Forderungen aus der extremen Rechten sind nicht ohne weiteres als antidemokratisch einzuordnen. Zu ihrem Arsenal gehört es, plebiszitäre Entscheidungsfindungen, also Elemente direkter Demokratie, zu befürworten. Die »Alternative für Deutschland« etwa legt nicht nur Wert darauf, sich als grundgesetz-treue Partei zu präsentieren, sondern will auch »Volksentscheide nach Schweizer Vorbild« einführen. Direktdemokratische Elemente werden sogar aus der neonazistischen Rechten gefordert. Zum vollständigen Langnamen von »Die Rechte« gehört der Beititel »Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz«. Diese Neonazigruppe nimmt also ebenfalls in Anspruch, direktdemokratische Volksabstimmungen fördern zu wollen. Dies trifft ebenso auf »Der III. Weg« zu und auch das Parteiprogramm der NPD sieht die »Stärkung der Gesetzgebung durch Volksentscheide auf allen Ebenen« vor. Ganz verwundern muss dies nicht, selbst im Nationalsozialismus fanden schließlich einige Wahlen statt und es wurden Volksbefragungen durchgeführt.
Die Unterstützung für direktdemokratische Elemente aus der extremen Rechten dient freilich nicht dazu, die Mitsprache von allen Gesellschaftsmitgliedern zu stärken. Rechtsextremes Denken ist immer Denken in Hierarchien. Dem Menschenbild des Rechtsextremismus zufolge sind in der Gesellschaft wenige zur Führung und Herrschaft prädestiniert, während die »Masse« nur für niedere Aufgaben geeignet seien. Daraus ergibt sich eine Logik von Autorität und Gehorsam, die alle gesellschaftlichen Fragen durchzieht und mit zeitgemäßen Vorstellungen von Demokratie nicht in Einklang zu bringen ist. Eine Gesellschaft aus mündigen, selbstbestimmten, gleichberechtigten und umfassend partizipierenden Bürgerinnen und Bürgern ist aus rechtsextremer Sicht – Lippenbekenntnissen zum Trotz – eine lebensfremde und gefährliche Utopie. Eine Elite soll herrschen, deren politische Legitimität an ihre Volksnähe und die Wahrung der »nationalen Interessen« zurückgekoppelt ist. Häufig wird ein präsidiales System vorgeschlagen, in dem das Staatsoberhaupt mit umfangreichen Befugnissen ausgestattet ist, um ohne Umwege und mit starker Hand regieren zu können. Der in einer rechten Interpretation des volonté générale (Jean-Jacques Rousseau) als tendenziell homogen gedachte Volkswille soll vom Staatsoberhaupt (oder einem kleinen Führungskreis) also erkannt und direkt umgesetzt werden. Was die Führung tut und was die Geführten wollen, wäre tendenziell ohnehin identisch.
Die extreme Rechte sieht sich dementsprechend als Anwältin des Volksinteresses. Diese Konstellation erklärt zum einen, warum die extreme Rechte in den allermeisten Erscheinungsformen einen populistischen Einschlag hat. Zum anderen begründet sich so ihre Stellung zur liberalen, repräsentativen Demokratie. Je nach Spektrum wird diese rundweg abgelehnt (etwa im Neonazismus) oder soll beschnitten und gezäumt werden (in den in dieser Hinsicht gemäßigteren Varianten). Staatlichen Institutionen tritt die extreme Rechte in ihrer Oppositionsrolle skeptisch oder ablehnend gegenüber, wenn diese aus ihrer Sicht das vermeintliche nationale Interesse nicht wahren oder ihm gar Schaden zufügen. Sie sollen geschwächt oder abgeschafft werden.
In Anlehnung an die Schriften des Staatsrechtlers Carl Schmitt argumentieren manche Rechtsextreme, dass es einen regelrechten Gegensatz zwischen Parlamentarismus und Demokratie gebe, da Demokratie ein hohes Maß an Homogenität brauche, die durch den parlamentarischen Pluralismus untergraben werde – »nötigenfalls« brauche Demokratie »die Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen«. Parteien sind aus Sicht von Rechtsextremen ein Inbegriff für Fehlstellungen im gegenwärtigen politischen System, da die Parteien volksfern agierten und eine ziellose Schwatzhaftigkeit kultiviert hätten. Die Parteiendemokratie wird von der extremen Rechten verdächtigt, den Staat handlungsunfähig zu machen. Korrupterweise hätten sich die Parteien den »Staat zur Beute gemacht« (eine gern zitierte Wendung von Hans Herbert von Arnim), dabei den Volkswillen verraten und seien nicht organisch. In der Bundesrepublik herrsche deshalb keine »wahre« Demokratie. Demokratie ist für den Rechtsextremismus zudem auf Grundlage eines ethnisch-identitären Volksbegriffes zu denken. Eine Teilhabe ist nur für die »Eigenen« vorgesehen, die anhand von Kultur und Geschichte, aber immer auch aufgrund der Herkunft definiert werden.
Viele rechtsextreme Formationen erheben in ihrer Praxis (natürlich sachlich begründbare) Forderungen wie die nach einer Verkleinerung des Bundestages oder der Einschränkung der Parteienfinanzierung. Auch die AfD kündigt in ihrem Programm an, »die Macht der Parteien beschränken« zu wollen. Je nach Spektrum soll der Parlamentarismus überwunden oder gezähmt werden. In qualitativer Hinsicht liegt hierin natürlich ein Unterschied, weswegen der Politikwissenschaftler Cas Mudde in seiner Konzeption der »far right« darum zwischen einem rundweg antidemokratischen Pol und einem Pol, der reformistisch auftritt und die liberale Parteiendemokratie in Richtung Illiberalität transformieren will, unterscheidet. Für viele Rechtsextreme sind autoritär geprägte, illiberale Demokratien wie in Russland oder Ungarn darum auch jenseits geostrategischer Überlegungen positive Bezugspunkte. Aus ihrer Sicht stehe dort das jeweilige nationale Interesse im Mittelpunkt der Politik. Öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland vehement als »Staatsfunk« und »Propaganda« zu kritisieren und gleichzeitig Propaganda und Einschränkungen der Pressefreiheit in illiberalen Staaten zu begrüßen, stellt für Rechtsextreme darum nicht unbedingt einen Widerspruch dar.