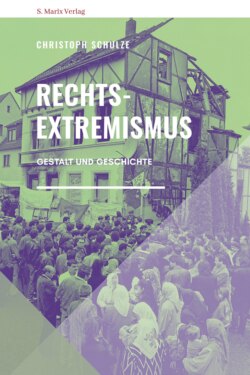Читать книгу Rechtsextremismus - Christoph Schulze - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Rassismus
ОглавлениеRassismus, so eine klassische Definition des französischen Soziologen Albert Memmi aus dem Jahr 1982, ist »die verallgemeinerte und verabsolutierte Wertung tatsächlicher oder fiktiver Unterschiede zum Vorteil des Anklägers und zum Nachteil seines Opfers, mit der seine Privilegien oder seine Aggressionen gerechtfertigt werden sollen«. Memmi argumentierte, dass Rassismus in drei Schritten vorgehe: Unterschiede zwischen Menschengruppen hebe er hervor oder konstruiere sie erst, dann folge eine Wertung und schließlich werde diese Wertung vom »Ankläger« für eigene Interessen gebraucht. Als fremd markierten Gruppen würden also (unabhängig von Staatsangehörigkeit und Sozialisation) bestimmte Eigenschaften zugeschrieben und daraus Schlüsse gezogen. Angehörige von Fremdgruppen werden, so Memmi, tendenziell auf eben ihre Gruppenzugehörigkeit reduziert und somit entindividualisiert. Klassisch berief sich der Rassismus vor allem auf vermeintliche biologische Merkmale. Forschende wie Stuart Hall oder Étienne Balibar haben seit dem Ende der 1980er-Jahre darauf hingewiesen, dass sich daneben auch ein »Rassismus ohne Rassen« entwickelt hat, der die Konstruktion des »Anderen« (was in der Fachdiskussion »othering« genannt wird, was sich grob als »Andersmachung« übersetzen lässt) vor allem über den Hinweis auf kulturelle Unterschiede vornehme. Dieser »Neo-Rassismus« komme teilweise ohne die Behauptung einer Überlegenheit bestimmter Gruppen gegenüber anderen aus. Er beschränke sich, so formuliert es Balibar, gegebenenfalls darauf, »die Schädlichkeit jeder Grenzverwischung und die Unvereinbarkeit der Lebensweise und Traditionen zu behaupten«. Rassismus stellt eine soziale Hierarchie her und nimmt so auf die Verteilung von sozialer Macht und Ressourcen Einfluss. Er ist nicht nur ein Vorurteil oder ein Einstellungsmuster im Denken von Individuen, sondern eine geschichtlich gewachsene Struktur, die etwa in die Kolonialzeit zurückreicht und die ganze Gesellschaft beispielsweise in Form von Wissensbeständen, Stereotypen und im Handeln von Menschen und Institutionen durchzieht.
Der rechtsextreme Rassismus ist auf vielfältige Art verwoben mit dem Rassismus, der allgemein in der Gesellschaft vorzufinden ist, er soll hier jedoch analytisch von diesem unterschieden werden. Rassismus als gesellschaftliches Machtverhältnis betrifft alle Angehörigen der deutschen Gesellschaft zu ihrem Vor- oder Nachteil und wirkt sich beispielsweise in Form von strukturellen und alltäglichen Diskriminierungen aus (etwa im Berufsleben oder auf dem Wohnungsmarkt). Im Rechtsextremismus ist Rassismus hingegen radikalisiert, ideologisiert und wird in politische Forderungen und Handlungen übersetzt. Der zugrundeliegende Gedanke der Ungleichheit der Menschen wird zum erhaltenswerten Naturzustand erklärt.
Schon der Nationalismus der extremen Rechten ist blutsgebunden und hat einen rassistischen Charakter. In ihrer Vorstellung ist die Nation vollständig oder weitestgehend ethnisch homogen. Dem Volk stehe demnach ein mehr oder minder exklusives Recht auf einen angestammten Lebensraum zu – Blut und Boden sind aneinander geknüpft. Die angestrebte, als harmonisches und organisches Zusammenspiel des Volkes konzipierte Gemeinschaft sei also nur zu erreichen oder abzusichern, wenn ein hohes Maß von ethnischer Homogenität bestehe. Diese Homogenität wird in der Regel als eine Homogenität im biologischen Sinn konkretisiert, weil sie streng auf der Abstammung, auf dem Blut basieren müsse (ius sanguinis). Dieses Denkprinzip wird manchmal von Rechtsextremen verleugnet, indem sie behaupten, dass es ihnen schlicht um Kultur und Identität gehe, deren Fortexistenz durch das Zäumen von Fremdeinflüssen gesichert werden müsse. Häufiger aber sind beide Prinzipien verkoppelt: Blut und Kultur bedingten einander auf die eine oder andere Art. Besonders nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 hat indes auch in Deutschland ein antimuslimischer Rassismus an Profil gewonnen, der im Rechtsextremismus verbreitet ist und die abzulehnende Andersartigkeit zuvorderst über ein kulturelles Merkmal – das der Religion – konstruiert. Parallel dazu leben andere Rassismen wie etwa Antiziganismus (gegen Sinti und Roma gerichtet) und der Antislawismus weiter. Zudem wird das geschichtliche Erbe des deutschen Kolonialismus kleingeredet, verharmlost oder als positive Episode verherrlicht.
Das moderne Verständnis von Staatsbürgerschaft, das ein Übermaß von oft als »Papierdeutschen« verunglimpften Bürgerinnen und Bürgern hervorbringe, wird von Rechtsextremen abgelehnt. Die Realitäten einer Zuwanderungsgesellschaft samt den Problemen und Möglichkeiten gesellschaftlicher Diversität werden von der extremen Rechten als Zerfallsprozesse beschrieben und beklagt. Millionen von Deutschen werden also exkludiert und ihre »wirkliche« Zugehörigkeit zum Land infrage gestellt oder verneint. Zur deutschen Nation gehörten nur Deutsche, und »Deutschtum« wird ethnisch, biologisch und kulturell starr gefasst.
Die zu wahrenden Identitäten seien aufzufinden auf der regionalen Ebene (etwa: Schwaben), auf der nationalen (Deutsche), aber auch auf darüber hinausreichenden Ebenen: Die Ordnung der Welt beruhe auf Großeinheiten, zu denen etwa das Abendland oder Europa gehöre. Europa sei ein weißer Kontinent, und die Vorherrschaft der Weißen müsse gesichert werden. Die damit verbundene rassistische Ausgrenzung und Abwertung betrifft vehement schwarze Menschen, während beispielsweise einem (selbstverständlich als weiß vorgestellten) Schweden durchaus die Möglichkeit zugestanden werden kann, qua Assimilierung deutsch zu werden. Abseits von Assimilation ist Deutschwerdung für Rechtsextreme kaum vorstellbar. Hybride, mehrgestaltige Identitäten, wie sie in modernen Gesellschaften an der Tagesordnung sind und von vielen gelebt werden, lehnen Rechtsextreme als letztlich substanzzerstörend ab oder behandeln sie als im Einzelfall duldbare Sonderfälle. Menschen sind aus rechtsextremer Sicht verpflichtet, vor allem Fortträger »ihrer« Gene und Kultur zu sein. Vermischungen und Aneignungen gelte es zu verhindern.
In ihren rassistischen Kampagnen nehmen Rechtsextreme den gesellschaftlichen Rassismus auf, versuchen die Kritik oder Ablehnung von Zuwanderung zuzuspitzen oder sich als Bollwerk zur Verteidigung der Vorrechte der Eingesessenen (Nativismus) in Szene zu setzen.