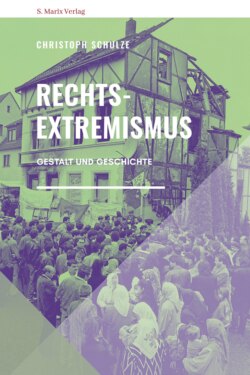Читать книгу Rechtsextremismus - Christoph Schulze - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitalismus und Anti-Kapitalismus
ОглавлениеZu den Fragen der sozialen Gerechtigkeit und zur Ablehnung oder Befürwortung des Kapitalismus sind in der extremen Rechten sehr unterschiedliche Positionen zu finden. Was sie eint, ist darum nur in allgemeinen Kategorien beschreibbar. Auch im ökonomischen und sozialen Bereich geht die extreme Rechte von einer natürlichen Ungleichheit der Menschen aus. Die Ausdifferenzierung der Gesellschaft muss und soll sich aus ihrer Sicht auch ökonomisch widerspiegeln. Auf diejenigen, denen fehlende Leistungsfähigkeit und -bereitschaft und »Schmarotzertum« vorgeworfen wird, blickt die extreme Rechte herab. Linke und sozialistische Modelle, die ein hohes Maß von sozialer Mobilität und eine größere oder völlige Überwindung sozialer Ungleichheit anstreben, lehnt die extreme Rechte ab. Klassischen Gewerkschaften wird regelmäßig »Klassenkampf« und ähnliches vorgeworfen, da sie gesellschaftliche Unruhe stifteten. Von »sozialer Ungleichheit« ist im Rechtsextremismus damit übereinstimmend nie die Rede, da aus seiner Sicht das Soziale ohnehin immer von Ungleichheit geprägt zu sein hat. Sehr wohl aber bezieht er sich positiv auf den Begriff der »sozialen Gerechtigkeit« – was genau als gerecht eingestuft werden kann, bleibt freilich strittig.
Der hauptsächliche Rahmen, auf den sich die extreme Rechte in ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik bezieht, ist die Nation. Sie stelle die Voraussetzungen bereit, die allen Angehörigen des Volkes erlaubten, hierarchisch gegliedert aber harmonisch aufeinander abgestimmt zu wirtschaften und zu arbeiten. Durch alle Spektren der extremen Rechten zieht sich eine Tendenz zur Ethnisierung der Sozialen Frage. Für soziale Probleme werden Migrantinnen und Migranten oder ausländische und internationale Einflüsse verantwortlich gemacht. Im Parteiprogramm der NPD heißt es beispielsweise: »Wir Deutschen müssen uns zwischen Sozialstaat und Einwanderungsstaat entscheiden«. Migrantinnen und Migranten wären unproduktiv, neigten zu Kriminalität, raubten Sozialleistungen, gefährdeten darum die nationalen Sicherungsnetze oder machten den Deutschen Arbeitsplätze streitig. Durch internationale Organisationen hingegen würden zum Nachteil der Nation hierzulande erarbeitete Güter mit ungenügenden Gegenleistungen ins Ausland transferiert und die nationale Souveränität angegriffen. Wo die extreme Rechte soziale Sicherungsmechanismen befürwortet, meint sie dies immer im Sinne einer exkludierenden Solidarität im nationalen Rahmen, von der sowohl »schmarotzende« Deutsche als auch Menschen, die in ihrem Verständnis nicht deutsch sind, tendenziell ausgeschlossen bleiben sollen.
Mit welcher Rhetorik diese Inhalte beschrieben werden und welche konkreten Maßnahmen umgesetzt werden sollen, wird in den verschiedenen Strömungen der extremen Rechten unterschiedlich gehandhabt. Wirtschafts- und sozialpolitische Forderungen sind dabei auch im Fluss und werden, je nachdem, wie es opportun erscheint, als flexibles Instrument zur Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen eingesetzt. Die Mittelschichten werden gemeinhin als wirtschaftliches Rückgrat der Nation umworben und etwa die Bekämpfung von ausufernder Bürokratie oder von mittelstandsfeindlicher, übertriebener Steuerbelastung versprochen. Wirtschaftseliten hingegen sind in der Geschichte der Bundesrepublik bisher nicht die hauptsächlichen Zielgruppen von Rechtsextremen gewesen. Bekannt gewordene Großspenden an entsprechende Organisationen illustrieren aber, dass es auch dort Sympathien für rechtsextreme Gruppierungen gibt. Insbesondere die Versprechen marktradikaler Rechtsextremer, Einmischungen des Staates in das Wirtschaftsleben zu minimieren, kommen der Interessenlage wirtschaftlicher Eliten entgegen.
Neben der Mittelstands-Rhetorik gibt es auch eine rechtsextreme Ansprache, in der erweiternd betont wird, die Interessen des »kleinen Manns« und des »hart arbeitenden Volkes« zu vertreten. Damit sind zum einen Mittelständlerinnen und Mittelständler gemeint, aber auch Anliegen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern werden von Rechtsextremen aufgenommen, ein Mindestlohn gefordert oder der Ausbau und der Schutz der Sozialsysteme in die Programme aufgenommen. Im Neonazismus wird die Soziale Frage sogar überwiegend aus der Perspektive des »einfachen Volkes« beantwortet und ein »Antikapitalismus von rechts« propagiert. Diese Selbstbezeichnung ist irreführend, weil keineswegs eine Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln und der auf Konkurrenz basierenden Marktwirtschaft beabsichtigt ist. Allerdings aber sind Arbeiterschaft oder das Handwerk die Hauptadressaten der Neonazipolitik. Durch einen starken und protektionistischen Staat sollen diese gestärkt werden. Als Feindbilder dienen Großkonzerne, sofern diese international auftreten, und der als nichtproduktiv kritisierte Finanzsektor. Das »schaffende« (und als »deutsch« gedachte) Kapital soll nach Vorstellung der Neonazis also gefördert und das »raffende« Kapital bekämpft werden. Hinter dieser Unterscheidung verbirgt sich ein Antisemitismus in nationalsozialistischer Tradition, wie er etwa beim NS-Wirtschaftstheoretiker Gottfried Feder zu finden war. Internationalismus, Schrankenlosigkeit, »Globalismus« und die damit einhergehende Zerstörung von Nation und tradierten Bindungen werden als »jüdisch« betrachtet. Neonazis verachten Sozialismus und Liberalismus als zwei Seiten derselben materialistischen, antinationalen und jüdischen Medaille, gegen die sie ihr Verständnis von nationalistischem Idealismus stellen. Die NPD nennt ihr Modell einer »harmonisch ausgewogenen« ökonomischen Ordnung »raum orientierte Volkswirtschaft«. Andere Rechtsextreme vertreten eine romantische Kapitalismuskritik, die ökonomisiertes und konsumorientiertes Denken als leere und oberflächliche Haltungen angreift und überwinden will. Dafür bedürfe es nur stellenweise einer Zähmung der Wirtschaft, vor allem aber müsse eine geistige Erneuerung bewirkt werden. Forderungen nach Arbeitszeitverkürzungen oder Lohnerhöhungen wird von diesen Rechtsextremen mit Skepsis begegnet, da sie ebenfalls ökonomistischem Denken entspringen würden und darum nur Scheinlösungen für ein anders gelagertes Problem seien.
In anderen Teilen der extremen Rechten wird hingegen auf den wirtschaftlichen Liberalismus positiv Bezug genommen und zuweilen werden offensiv Kapitalismus und Marktwirtschaft gepriesen. Das Konkurrenzprinzip im wirtschaftlichen Feld müsse sich frei entfalten können, um zum Wohle der Nation und im Sinne der sozialen Gerechtigkeit die Starken und die Leistungsfähigen zu ihrem Recht kommen zu lassen. Ein »ausufernder« Wohlfahrtsstaat führe zu einer Erschlaffung der Gesellschaft und letztlich zu ihrer Selbstauflösung. Soziale Sicherungssysteme werden darum manchmal abgelehnt oder nur als wohldosierte Befriedungs- und Sicherungsmaßnahmen des Staates befürwortet. Breiteren Partizipationsmöglichkeiten durch leicht zugängliche Bildung und Teilhabe steht dieses Spektrum mit der Begründung ablehnend gegenüber, dass so die natürlichen Prozesse der sozialen Selektion und der Elitenbildung aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Der Staat soll gleichermaßen schlank und stark sein, sich Eingriffen in das Wirtschaftsleben und sozialer Umverteilung enthalten, Regulationsmechanismen abbauen und lediglich mit harter Hand dafür sorgen, als notwendig erachtete Rahmenbedingungen aufrechtzuerhalten. Dazu gehören Homogenität in ethnischer und kultureller Hinsicht sowie eine Beschränkung von politischer Teilhabe und Pluralität. Rechtextreme dieser Couleur fürchten die Gefahren, die der Ordnung durch »funktionslose Unterschichten« im Volk und durch unqualifizierte Einwanderung drohten. Gegen die Bestürmung der Gesellschaft durch Parteien und Partikularinteressen habe der Staat sowohl sich selbst als auch die Wirtschaft zu schützen. Nicht selten wird der Politik der Bundesrepublik vorgeworfen, in Wahrheit eine sozialistische Gesellschaft schaffen zu wollen oder bereits geschaffen zu haben. Manche Elemente dieser rechtsextremen Sichtweisen auf Wirtschaftsund Sozialpolitik haben Berührungs- und Überschneidungspunkte mit dem Ordo- und Neoliberalismus; positiver Bezug wird beispielsweise auf die Theoretiker der sozialen Marktwirtschaft der Freiburger Schule genommen. In der AfD und in der ihnen nahestehenden Publizistik finden zudem Ansichten Resonanz, die etwa auf die österreichische Schule der Nationalökonomie (Friedrich August von Hayek, Ludwig Mises) oder auf Ideen der Chicagoer Schule (Milton Friedman) rekurrieren.