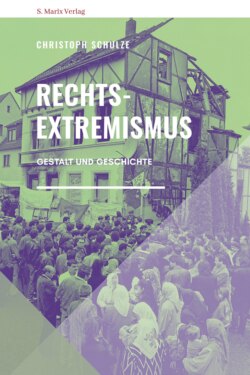Читать книгу Rechtsextremismus - Christoph Schulze - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Was ist Rechtsextremismus?
ОглавлениеKaum jemand bezeichnet sich selbst als »rechtsradikal« oder »rechtsextrem«. Sicherlich gibt es prominente Ausnahmen, wie das bis 2013 erschienene Magazin Hier & Jetzt, das sich an das NPD-Milieu wendete und den Claim »radikal rechte Zeitschrift« prominent im Untertitel führte. Die allermeisten Rechtsextremen hingegen weisen solche Einordnungen von sich und bestehen darauf, vielleicht seltener gewordene aber doch respektable, demokratische Inhalte zu vertreten. Schon die Rede von »Radikalität« wird von ihnen als aufgezwungener Platzanweiser in der politischen Landschaft verstanden. Selbst ihr Rechtssein weisen viele zurück und reklamieren stattdessen, einen soliden Konservatismus zu vertreten. Andere wollen für »gesunden Menschenverstand« jenseits von »rechts« und »links« und anderem »Schubladendenken« stehen. Durch die Geschichte der Bundesrepublik waren Eigenbezeichnungen wie »Nationale«, »nationales Lager«, »nationale Opposition« oder simpel »Patrioten« gängig und werden auch weiterhin verwendet.
Mit der »extremen Rechten« ist im Kern ein bestimmtes politisches Milieu gemeint. Es wird durch ein – manchmal enges, manchmal loseres – Wir-Gefühl zusammengehalten, das sich aus ideologischen und weltanschaulichen Grundüberzeugungen, aus der Geschichte und aus sozialen, personellen und organisatorischen Verbindungen nährt. Freilich grenzt die extreme Rechte an andere politische Milieus an und in bestimmten Bereichen sind Überlappungen zu finden. Manche Rechtextreme bewegen sich auch in nicht-rechtsextremen Organisationen. Obendrein ist rechtsextremes Denken als Einstellungsmuster in der Bevölkerung verbreitet, hat also auch eine unorganisierte und nicht notwendig mit konkreten Handlungen verknüpfte Dimension.
Folgt man dem italienischen Rechtsphilosophen Norberto Bobbio, dann können links und rechts als Pole verstanden werden, die einander entgegenstehende soziökonomische Vorstellungen betreffen. Der linke Pol des politischen Spektrums ist egalitär orientiert und strebt dementsprechend das Abfedern sozioökonomischer Schieflagen zwischen Menschengruppen oder gar das Erreichen sozialer Gleichheit an. Am rechten Pol wird die grundsätzliche Gleichheit von Menschen bestritten. Die Extremposition: Ungleichheit zwischen Menschen und Menschengruppen ist kein Unrecht und kein Produkt menschlichen Handelns, sondern ein Naturzustand, den es zu bejahen, zu bewahren und zu verwalten gilt. Für die Abbildung politischer Überzeugungen ist ergänzend zu diesen sozioökonomischen Polen eine zweite, politisch-kulturelle Achse hinzuzudenken. In der Frage nach den Grundvorstellungen bezüglich staatlicher und sozialer Ordnung bildet diese die Antagonismen Autoritarismus und Libertarismus ab, unterscheidet also zwischen strikter, pluralismusfeindlicher Herrschaft und größtmöglichen Handlungsfreiheiten.
Mit der extremen Rechten ist das politische Milieu gemeint, welches für eine scharfe Ablehnung des Gleichheitsgedankens einsteht und in aller Regel scharf autoritaristisch orientiert ist. Dabei ist es in politischen Einzelfragen, in ihren Strategien und sozial nuanciert. Generell aber will die extreme Rechte mit der Durchsetzung eines harten und ethnozentrischen Nationalismus dem Ungleichheitsgedanken in ihrer Weltanschauung die ihrer Ansicht nach gebührende politische Geltung verschaffen. Oft werden dafür die Ideen der Aufklärung und des Universalismus radikal verworfen, mindestens wird ihren Prämissen misstraut. Hierin liegt ein markanter Unterschied zwischen dem Rechtsextremismus und einem modernen, konstitutionellen und aufgeklärten Konservatismus.
Die grundsätzlich unterschiedlichen Menschen könnten laut den rechtsextremen Ideen ihr Potenzial zum Wohle der nationalen Gemeinschaft am besten entfalten, wenn diese an den ihnen qua Natur (oder: qua göttlichem Willen) zustehenden Positionen in der Gesellschaft lebten und arbeiteten. Eine soziale Mobilität der Volksangehörigen ist nur in einem geringen Maße vorgesehen. Ein Arbeiter ist Arbeiter und sollte Arbeiter bleiben. Identität ist hergebracht, den Individuen eingeschrieben und nur ihre Aufrechterhaltung und Entfaltung verspricht, die Ordnung zu bewahren. Staat und Gesellschaft werden oft als ganzheitliche Körper beschrieben, deren Fortexistenz davon abhänge, dass ihre Gliedmaßen die jeweiligen Funktionen erfüllen können und »Wucherungen« nicht zugelassen werden. Wenn alle Volksangehörigen an ihrem Platz wirkten, werde Harmonie erreicht. Ambivalenzen und gesellschaftlichen Interessenkonflikten wird tendenziell die Legitimität abgesprochen. Um den nötigen Zusammenhalt zu gewährleisten, seien Staat und Gesellschaft auf eine hierarchische Gliederung angewiesen, in der sich die Ungleichheit der Menschen organisch abbilde. Legitimen Anspruch auf Gleichheit gebe es nur unter Gleichrangigen – die sozialen Bindungskräfte, etwa bei der Pflichterfüllung im Militärdienst, gelten als kameradschaftliche Tugend. Dieses Grundprinzip von Ungleichheit und Hierarchie erstreckt sich auf die meisten gesellschaftlichen Felder, von der Arbeitswelt über das Geschlechterverhältnis bis hin zu politischen Mitspracherechten. Verbunden mit dem völkischen Nationalismus steht im Rechtsextremismus darum das Ansinnen im Zentrum, »Ordnungen der Ungleichheit« (so Stefan Breuer über die deutsche radikale Rechte von 1871 bis 1945) zu schaffen und zu sichern. Häufig blickt die extreme Rechte mit Bewunderung auf ausgewählte ältere und archaische Gesellschaften, von denen sie zu wissen glaubt, dass in ihnen eine »natürliche Ordnung« gewahrt war. Aus Sicht des Rechtsextremismus ist die eigene Politik gewissermaßen eine Art angewandte Anthropologie. Was den Menschen (bzw.: die Völker oder die »Rassen«) ausmacht, ist entweder unabänderlich oder das zu bewahrende und zu respektierende Produkt von gigantischen Werdungsprozessen. Aufgabe von Politik ist in diesem Verständnis weniger die Gestaltung von Gesellschaft, sondern eher die Gerechtigkeit gegenüber dem ohnehin Gegebenen. Die NPD etwa behauptet von sich, ein »lebensrichtiges Menschenbild« zu vertreten, das »auf der Natur des Menschen« aufbaue und die Naturgesetze in das politische Handeln einbeziehe. Das Menschenbild des Rechtsextremismus neigt zu einem starken Bezug auf vermeintlich verhaltensbiologisch bedingte Konstanten. Instinkte und Konkurrenzempfinden trieben menschliches Handeln an und Kampf und Auseinandersetzung seien darum zu bejahen. Sozialdarwinistisch wird das Recht des Stärkeren affirmiert: »Leben ist Kampf«, und wer sich durchsetzt, hat Recht.
Den hauptsächlichen Bezugsrahmen bildet für die extreme Rechte das Begriffspaar von Nation und Volk, verstanden als staatliche Formgebung bzw. als ethnisch weitgehend homogene Einheit. Wer sich zum Volk zählen darf, wird mit einer Mischung aus essenzialistisch-kulturellen und biologisch-rassistischen Argumenten begründet. Veränderungen und Verschiebungen, welche die vermeintliche Einheit des Volkes betreffen, werden von Rechtsextremen abgelehnt oder nur mit großer Trägheit und Verzögerung akzeptiert – das Deutschsein der Nachfahrinnen und Nachfahren der polnischen Einwanderung ins Ruhrgebiet im 19. Jahrhunderts wird auch von heutigen Rechtsextremen nicht mehr in Zweifel gezogen.
Rechtsextreme vertreten in Übereinstimmung mit ihren Ungleichheitsvorstellungen auf kultureller Ebene in aller Regel eine drastische Gegenwartskritik. Die von ihr als natürlich angesehene Ordnung sei aus den Fugen geraten und müsse darum restauriert werden – anders könne dem von ihr beständig diagnostizierten »Verfall« kein Einhalt geboten werden. Dass ausgerechnet die Nation das Fundament ist, auf der die vermeintlich natürliche Ordnung der Gesellschaft aufgebaut werden soll, ist eigentlich ein Paradoxon. Denn natürlich ist die Idee der Nation selbst keine übergeschichtliche Konstante, sondern ein vergleichsweise junges Produkt menschlichen Denkens und Handelns. Die heutigen Vorstellungen von Nationalstaatlichkeit sind erst im 18. Jahrhundert entstanden. Somit ist die extreme Rechte selbst ein modernes Phänomen – trotz ihrer Sehnsucht nach der Wiederherstellung alter Zustände. Im »Reichs«- und »Abendland«-Denken vieler Rechtsextremer gehen Nationalismus, idealistisch-mythische Vorstellungen und imperiale und auch kolonialistische Ideen ineinander über. Das Verhältnis von Rechtsextremen zur Moderne ist generell ambivalent. Bestimmte »Exzesse« bekämpft sie. Oft versteht sie ihr Tun selbst als »reaktionär«, als Verteidigung gegen die Zumutungen der heutigen Zeit. Nur in obskureren Varianten aber will sie alle Erscheinungen der Moderne wieder abschaffen. In gewisser Hinsicht ist die extreme Rechte sogar eine Meisterin in der Nutzung neuer Möglichkeiten – moderne Kommunikationstechnologie in der Propaganda werden von ihr nicht verschmäht, sondern vorbehaltlos eingesetzt.
In der öffentlichen und auch wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Themenfeld ist eine ausgesprochene Vielfalt von unterschiedlichen Bezeichnungen anzutreffen, die für Verwirrung sorgen kann. Heißt es nun Rechtsextremismus? Rechtsradikalismus? Wie steht es um andere Bezeichnungen wie Rechtspopulismus oder Neofaschismus? Meinen diese dasselbe Phänomen? Es lohnt, diese Fragen knapp zu diskutieren, da die Begriffe eine jeweils eigene Geschichte haben und ihre Verwendung Akzente setzen kann. Zunächst ist festzuhalten, dass diese Begriffe in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen und somit auch in unterschiedlichen Bedeutungszusammenhängen angewendet werden. Zu nennen ist der Gebrauch zur Markierung der Illegitimität von Positionen in öffentlichen Debatten, der Gebrauch im staatlich-administrativen Bereich sowie, drittens, der Gebrauch in den Sozialwissenschaften.
Erstens ist die öffentliche Debatte zu beachten. Wenn von Rechtsextremismus oder Rechtsradikalismus die Rede ist, werden in der Regel Grenzen des Hinnehmbaren markiert. Hier geht es um die Assoziation zum geschichtlichen Erbe des historischen Nationalsozialismus, zu dem sich die Gesellschaft positionieren und mit dem sie sich kritisch auseinandersetzen sollte – je nachdem, wohin die Debatte pendelt, mittels Repression und Abgrenzung oder Dialog und Integration. Demzufolge handelt es sich um politische Begriffe, da mit ihnen die Legitimität eines politischen Akteurs bewertet wird. In ihren Diskursstrategien versuchen Rechtsextreme durch Provokationen und die ständige Wiederholung von Parolen, einerseits ihre Sichtweisen in die gesellschaftliche Diskussion einzubringen und so zu normalisieren (also: die Grenzen des »Sagbaren« und »Machbaren« zu ihren Gunsten zu erweitern). Andererseits betreiben sie, wenn es in der öffentlichen Selbstdarstellung als opportun erscheint, eine »Mimikry« (so der Rechtsextreme Karlheinz Weißmann) bzw. eine »Selbstverharmlosung« (Götz Kubitschek) und stellen sich selbst und ihre Forderungen als moderater dar, als sie tatsächlich sind. Der Einsatz solcher Mittel dient dem Zweck, einer Etikettierung als rechtsextrem in öffentlichen Debatten zu entkommen. Zudem versuchen Rechtsextreme mit gleicher Intention, Begriffe aufzuweichen, um sie zu entwerten. Etwa durch Retorsionen, das heißt vergeltende Erwiderungen: Kritikerinnen und Kritikern wird vorgeworfen, wie eine »SAntifa« zu agieren, oder die kritische Thematisierung von Rassismus wird als eigentlicher oder »antideutscher« Rassismus zu brandmarken versucht.
Zweitens handelt es sich um behördliche Termini. Als sich in der jungen Bundesrepublik Rechtsextreme wieder organisierten und zur Tat schritten, wurde 1952 die »Sozialistische Reichspartei« (SRP) durch das Bundesverfassungsgericht verboten. Das Gericht definierte in der Urteilsfindung die »freiheitlich-demokratische Grundordnung«, gegen dessen Feinde sich der Staat durch Verbote zur Wehr setzen dürfe. In Abkehr von der ursprünglichen »antifaschistisch-demokratischen Politik« der Alliierten wurde in diesem Zuge ein »antitotalitärer Grundkonsens« zur Norm. Als »wehrhafte Demokratie« müsse sich die Bundesrepublik gegen den Radikalismus sowohl von links als auch von rechts verteidigen. 1956 wurde die »Kommunistische Partei Deutschlands« (KPD) verboten. Ausführlich begründete das Bundesverfassungsbericht in diesem Urteil, dass für ein Parteienverbot eine Ablehnung der »freiheitlich-demokratischen Grundordnung« (»verfassungsfeindlich«) nicht genüge, sondern auch, dass diese Ablehnung mit einer konkreten, »aktiv kämpferischen, aggressiven Haltung« einhergehen müsse (»verfassungswidrig«). Unterdessen gab es bisher nur die beiden genannten Verbote von Parteien in der Bundesrepublik. Zwei Verbotsverfahren gegen die NPD (2001–2003 und 2013–2017) wurden eingestellt. Das erste ausgerechnet aufgrund der hohen Durchsetzung der Partei mit V-Leuten des Verfassungsschutzes, das zweite mit der bemerkenswerten Begründung, dass diese Partei zwar verfassungswidrige Ziele verfolge, aber organisatorisch nicht in der Lage sei, diese umzusetzen. Auch Verbote gegen andere Gruppierungen wie etwa Vereine werden nicht häufig ausgesprochen, was aus der Perspektive politischer Grundrechte durchaus begrüßenswert sein kann. Dies heißt jedoch auch: Rechtsextremismus und auch Rassismus oder Nationalismus sind in der Bundesrepublik grundsätzlich keineswegs verboten. Entsprechende Bestrebungen sind gegebenenfalls lediglich unter Beobachtung gestellt. Die Geheimdienste, unter anderem die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, sprachen zur Bezeichnung ihrer Beobachtungsobjekte bis in die 1970er-Jahre von »Radikalismus« und schwenkten dann auf den Extremismusbegriff um. Sie unterscheiden dabei vorrangig Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus und »extremistische Bestrebungen von Ausländern«, die allesamt in fundamentalem Widerspruch zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung stünden.
Der Begriff »Radikalismus« wird in den Publikationen des Verfassungsschutzes kaum mehr verwendet. Wenn doch, dann dient er als Bezeichnung für die Randbereiche des prinzipiell mit dem Grundgesetz vereinbaren politischen Spektrums, das also (noch) nicht extremistisch sei und darum nicht Beobachtungsgegenstand der Behörden sein darf. Zur praktischen Bestimmung der Aufgabenbereiche eines Geheimdienstes mag die Orientierung am Verhältnis der fraglichen politischen Erscheinungen zum Grundgesetz und diese Unterteilung in Teilbereiche Vorteile haben. Analytisch ergeben sich jedoch Leerstellen. Die Vorstellung etwa, dass es einen »Ausländerextremismus« gebe, wird der Realität nicht gerecht. Tatsächlich werden in dieser Rubrik Gruppierungen kategorisiert, die in ideologischer Hinsicht unterschiedlicher kaum sein könnten und von der kurdischen PKK bis zur rechtsextremen türkischen Ülkücü-Bewegung reichen. Bei großen Teilen der jeweiligen Anhängerschaft handelt es sich zudem mitnichten um »Ausländer«, sondern um deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mit Migrationsgeschichte.
Drittens gibt es – in den letzten Jahren verstärkt – eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Themenfeld. Hier ist die Begriffsvielfalt besonders ausgeprägt. Auch durch seine Verbreitung in den Sicherheitsbehörden und seine öffentliche Nutzung ist »Rechtsextremismus« am häufigsten anzutreffen. Eine allgemein anerkannte Definition existiert aber nicht. Große Akzeptanz hat gleichwohl die Definition des Politikwissenschaftlers Hans-Gerd Jaschke aus dem Jahr 1994 gefunden, die weitgehend mit den eingangs angestellten Betrachtungen korrespondiert:
»Unter ›Rechtsextremismus‹ verstehen wir die Gesamtheit von Einstellungen, Verhaltensweisen und Aktionen, organisiert oder nicht, die von der rassisch oder ethnisch bedingten sozialen Ungleichheit der Menschheit ausgehen, nach ethnischer Homogenität von Völkern verlangen und das Gleichheitsgebot der Menschenrechts-Deklarationen ablehnen, die den Vorrang der Gemeinschaft vor dem Individuum betonen, von der Unterordnung des Bürgers unter die Staatsräson ausgehen und die den Wertepluralismus einer liberalen Demokratie ablehnen und Demokratisierung rückgängig machen wollen.«
Daran schließt eine weitere, 2001 von elf Sozialforscherinnen und Sozialforschern erarbeitete Definition an, die etwas weniger sperrig formuliert ist und den Fokus auf Einstellungsmuster legt:
»Der Rechtsextremismus ist ein Einstellungsmuster, dessen verbindendes Kennzeichen Ungleichwertigkeitsvorstellungen darstellen. Diese äußern sich im politischen Bereich in der Affinität zu diktatorischen Regierungsformen, chauvinistischen Einstellungen und einer Verharmlosung bzw. Rechtfertigung des Nationalsozialismus. Im sozialen Bereich sind sie gekennzeichnet durch antisemitische, fremdenfeindliche und sozialdarwinistische Einstellungen.«
Mithilfe solcher Definitionen lässt sich das Phänomen für die empirische Forschung hinreichend eingrenzen. Sie eint, dass sie im Rechtsextremismus eine Kombination verschiedener Teilelemente sehen – diesen also als Syndrom verstehen. Welche Teilelemente im Zentrum stehen, ist Gegenstand von anhaltenden Debatten über diesen – manchmal etwas flapsig als »shopping list approach« kritisierten – Ansatz. Der niederländische Politikwissenschaftler Cas Mudde zählte schon in der Mitte der 1990er-Jahre 26 Definitionen in der Forschungsliteratur, in denen insgesamt 58 verschiedene Teilelemente vorkamen.
Anders konstruiert ist das Modell, das von der generischen Extremismusforschung vorgeschlagen wird. Dieser kommt durch ihre Nähe zum und ihre Funktion für den staatlichen Sicherheitsapparat eine besondere Deutungsmacht zu. Die generische Extremismusforschung geht von der Existenz eines politischen Extremismus aus, der sich in verschiedene, miteinander konkurrierende Subspektren unterteilen lasse. Die Extremismen seien durch bestimmte übereinstimmende Merkmale gekennzeichnet, etwa dadurch, dass sie sich jenseits des normativen Rahmens der freiheitlich demokratischen Grundordnung befänden, einen Wahrheitsanspruch der eigenen Ideologie behaupten und Mehrdeutigkeiten nicht zuließen. Ein besonders in früheren Jahren häufig bemühtes Bild: Wie die Enden eines Hufeisens befänden sich die extremistischen Ränder der Gesellschaft nahe beieinander und in recht großer Distanz zur Mitte. Links- und Rechtsextremismus stünden zwar in Konkurrenz zueinander, seien sich aber in wichtigen Punkten strukturell ähnlich. Extremistisch seien, so der Politologe Steffen Kailitz, alle Bestrebungen, »die auf die Bewahrung oder Errichtung einer autoritären oder totalitären Diktatur zielen« und die sich in Gegnerschaft zu den Ideen des demokratischen Verfassungsstaats befinden, also »Kernmerkmale der Demokratie« wie freie Wahlen, Gewaltenteilung, den Rechtsstaat oder die Menschenrechte angreifen.
Kritisiert wird an der generischen Extremismusforschung, dass ihre Konzeption normsetzend und künstlich sei. Die Phänomene, die sie unter Extremismus subsummiert, seien in der Realität weit voneinander entfernt und verfolgten völlig entgegengesetzte Ziele. Ein radikaler linker Antikapitalismus und der Neonazismus beispielsweise haben kaum etwas gemein. Die einen beklagen, dass das Gleichheitsversprechen in liberalen kapitalistischen Systemen nicht eingelöst werde, während die anderen die Gleichheit als solche verneinen. Kaum zu bestreiten ist hingegen, dass gewisse Ideologeme sowohl bei radikalen Linken als auch bei Rechtsextremen zu finden sind – beispielsweise gibt es nicht nur rechten, sondern auch linken Antisemitismus. Aber mit dieser Feststellung ist – so die Kritik –, noch nichts über den Charakter, die Herkunft, Verbreitung und Wirkung des jeweiligen Antisemitismus gesagt und auch nicht darüber, wo Antisemitismus in der Gesellschaft jenseits von Linken und Rechten aufzufinden ist. Solche Probleme externalisiere die generische Extremismusforschung und erkläre sie zu Randerscheinungen, während die Mitte von ihnen freigesprochen werde. Als ein Hinweis auf die Stichhaltigkeit der generischen Extremismusforschung kann der Umstand gelten, dass es Beispiele für Menschen gibt, die von einem radikalen Lager ins andere wechselten. Tatsächlich sind Biografien wie die von Horst Mahler und seine Wandlung vom RAF-Mitglied zum neonazistischen Holocaustleugner erklärungsbedürftig. Andererseits sind solche Wechsel eher Ausnahmen. Viel mehr Rechtsextreme haben ihr politisches Engagement in demokratischen Organisationen begonnen. Frank Schwerdt, eine Schlüsselfigur im Neonaziumfeld der Terrorgruppe »Nationalsozialistischer Untergrund«, war über ein Jahrzehnt lang CDU-Funktionär, bevor er sich rechtsextremen Gruppen anschloss.
Es gibt in den Sozialwissenschaften somit zwei Hauptinterpretationen von »Rechtsextremismus«: das insgesamt breiter anerkannte, welches Rechtsextremismus als Syndrom verschiedener antiegalitärer Ideologeme in den Blick nimmt, und jenes der generischen Extremismusforschung, das näher an der Behördenpraxis ist. Teilweise werden in der ersteren Forschungsrichtung sprachliche Hilfskonstruktionen wie »extrem rechts« verwendet, um eine Abgrenzung zur generischen Extremismusforschung zu unterstreichen.
Gegen die Verwendung von »Rechtsradikalismus« wird eingewandt, dass dieses Wort fälschlicherweise impliziere, dass das besagte politische Spektrum gesellschaftliche Probleme grundsätzlich und von der Wurzel her lösen wolle, während es tatsächlich Probleme zuspitze und verschärfe. Der lateinische Wortstamm »radix« bedeutet »Wurzel«. Der marxistische Philosoph Ernst Bloch befand darum, dass die Rede von Rechtsradikalismus ein »Unding« sei: »radikal ist links«. Das Radikale am Rechtsradikalismus, so lässt sich der Begriff gegen diesen Einwand verteidigen, ist jedoch nicht in seiner Problemlösungskompetenz zu finden, sondern in seiner fundamentalen Verneinung des Gleichheitsgedankens. In der deutschsprachigen Forschung und auch international werden »Rechtsradikalismus« und »Rechtsextremismus« teilweise ergänzend zueinander genutzt. Der in den USA forschende Politikwissenschaftler Cas Mudde etwa schlägt den Übergriff »far right« (in etwa: »Äußere Rechte«) vor, die in die nicht vollständig systemfeindliche »radical right« und die offen demokratiefeindliche »extreme right« zu unterteilen sei. Der Politikwissenschaftler Michael Minkenberg wiederum sieht den Rechtsextremismus als besonders aggressive und demokratiefeindliche Variante des für ihn als Überbegriff fungierenden Rechtsradikalismus. Eine Beschränkung auf den Superlativ »Rechtsextremismus« erschwere es, die unterschiedlichen ideologischen Härtegrade und eingesetzten Mittel des politischen Kampfes im fraglichen Spektrum erfassen zu können.
Mit dem Rechtspopulismus kursiert derweil ein weiterer Begriff in den öffentlichen Diskussionen zum Themenfeld. Auch hier gibt es keinen Konsens über seine Bedeutung. Populismus kennzeichne allgemein, so definiert die große Mehrheit der Forschung das Minimalkriterium, dass er eine Kluft zwischen der herrschenden Politik und dem Volk beschwöre und abzuschaffen verspricht: »Die da oben tun nicht (mehr), was die Menschen wollen und brauchen.« Dazu gehört die – der komplexen und von Interessenkonflikten durchzogenen Realität der Gegenwart widersprechende – Idee eines »eigentlichen«, eines essenziellen Volkswillens. Populismus reklamiert für gewöhnlich für sich, demokratisch zu sein, da er die als korrupt dargestellten Eliten entmachten und den vorgestellten Volkswillen umsetzen wolle. Umstritten ist, ob die Existenz einer charismatischen Führungsfigur nötig ist, um von Populismus zu sprechen. Bei einigen unter dem Populismusparadigma diskutierten Erscheinungen liegt dies vor (etwa bei der Politik Geert Wilders in den Niederlanden), bei anderen scheint dies zu fehlen – je nachdem, wie Charisma definiert wird.
Teilweise wird in öffentlichen Debatten »Rechtspopulismus« gleichbedeutend mit »Rechtsextremismus« oder »Rechtsradikalismus« genutzt. Andere nutzen ihn als Scharnierbegriff, also als Bezeichnung für das Feld zwischen demokratischen Kräften und dem antidemokratischen Rechtsextremismus, etwa wenn die AfD nicht als rechtsextrem, aber als mit dem Rechtsextremismus in Berührung stehend porträtiert wird. Rechtspopulismus ist in diesem Verständnis eine Art Rechtsextremismus light.
In der Forschung sind zwei Strömungen in der Analyse des Populismus auszumachen. Einerseits wird in der »Wir gegen die da oben«-Logik des Populismus eine eigene Ideologie gesehen, die für sich genommen jedoch »schwach« oder »dünn« sei (»thin ideology«) und sich darum unweigerlich mit anderen Ideologien verbinden müsse. Spielarten des Populismus seien links und rechts zu finden: »Die Politik steht im Dienst der Banken und vernachlässigt das Volk« (Linkspopulismus) oder »Die Politik überschwemmt uns mit Einwanderern, obwohl dies dem Volk schadet« (Rechtspopulismus). Andererseits wird von anderen Forschenden infrage gestellt, ob es sich beim Populismus um eine eigene Ideologie handele. Stattdessen wäre Populismus ein kommunikativer Stil bzw. eine Strategie, eine Methode in der politischen Reklame. Mit populistischer Rhetorik ließen sich fast alle Inhalte verpacken, egal, wo sie auf einer Rechts-Links-Skala einzuordnen sind. Auch wirtschaftsliberale Positionen könnten populistisch beworben werden: »Die Regierung gängelt uns, weil sie uns überhöhte Steuern abpresst.« Das Verständnis von Populismus als Stil ermöglicht eine Differenzierung zwischen Ideologie bzw. Inhalten sowie dem öffentlichen Auftreten von politischen Akteurinnen und Akteuren. Auch die neonazistische Weltanschauungspartei NPD setzt schlichte und populistische Parolen in ihrer Wahlwerbung ein. Populismus sei in der gesamten Historie rechtextremer Politik zu finden und darum sogar als »genuiner Kernbestandteil des Rechtsextremismus« zu verstehen, so die Einschätzung des Politikwissenschaftlers Richard Stöss. Nicht selten sind inzwischen auch Varianten anzutreffen, in denen verschiedene Begriffe kombiniert werden, wenn beispielsweise von einer »populist radical right« gesprochen wird.
Faschismus (oder für Nachkriegserscheinungen: Neofaschismus) ist derweil ein weiterer Begriff, der in den gegenwärtigen Diskussionen anzutreffen ist. Von der marxistisch-leninistischen Lesart, die im Faschismus ein Instrument der Bourgeoise und einen durch Krisen zugespitzten Kapitalismus sieht, hat sich der Terminus dabei größtenteils gelöst. Manchmal wird Faschismus auf die konkrete historische Bewegung unter Benito Mussolini in Italien reduziert. Häufiger werden darunter verschiedene internationale Bewegungen gefasst, die ihren Anfang in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts hatten. Der Nationalsozialismus kann als eine deutsche Spielart des Faschismus aufgefasst werden, der sich durch das Spezifikum eines besonders radikalen und eliminatorischen Antisemitismus auszeichnete. Der britische Historiker und Faschismusforscher Roger Griffin sieht es als gerechtfertigt an, einen generischen Faschismusbegriff zu nutzen. Faschismus sei eine populistische und antiliberale Ideologie, die nach einer Palingenese (Neugeburt) der Nation strebe und sich dabei revolutionärer Mittel bediene. Die Nation werde, so Griffin, mythisch überhöht und als organische Einheit betrachtet. Faschismus und Neofaschismus eignen sich begrifflich, um eine Subkategorie des aktuellen Rechtsextremismus zu bestimmen. Dies trifft beispielsweise auf Gruppierungen zu, die sich auf den historischen Nationalsozialismus beziehen, ist aber auch auf einige weitere rechtsextreme Spektren anwendbar. So kann es in Anbetracht seiner palingenetischen Äußerungen nicht nur im juristischem Sinne legal, sondern auch analytisch sinnvoll sein, den AfD-Politiker Björn Höcke einen »Faschisten« zu nennen. Am Faschismusbegriff Griffins wird zuweilen kritisiert, zu sehr den sakralen Charakter des Faschismus (»politische Religion«) zu betonen und Ideologieelemente wie Rassismus zu wenig zu berücksichtigen.