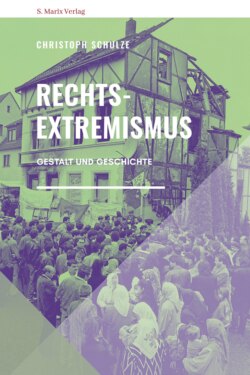Читать книгу Rechtsextremismus - Christoph Schulze - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EIN SOMMER IN DEUTSCHLAND
Оглавление»Widerstand! Widerstand!«, hallt es durch die Straßen von Chemnitz. Es herrscht ein mildes Wetter an diesem 1. September 2018, aber die Stimmung auf der Demonstration in der sächsischen Großstadt ist aufgeheizt.
Seit 2015, also seit drei Jahren, befindet sich die extreme Rechte republikweit im Kampagnenmodus. Mit aggressiver Rhetorik, wütenden Demonstrationen und flankiert von Gewalttaten macht das Spektrum mobil. Es geht gegen die Aufnahme von Flüchtlingen, denen pauschal und abwertend ein Hang zur Kriminalität und invasorische Absichten unterstellt werden. An den Aufmärschen sind besonders am Anfang Menschen beteiligt, die vielleicht nur eine Unsicherheit angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen verspüren oder konkretere rassistische Ressentiments pflegen, die jedoch keine geschlossene rechtsextreme Ideologie vertreten. Später vereindeutigt sich das Bild: Die Proteste werden immer radikaler. Es gebe einen sinisteren Plan, ausgedacht von dunklen, volksfeindlichen Mächten, von der Merkel-Regierung: Mit dem »großen Austausch«, so die rechtsextreme Propaganda, soll mithilfe der Flüchtlinge die Abschaffung des deutschen Volkes erreicht werden. Diese Erzählung über eine deutschenfeindliche Verschwörung ist wirksam. Wer das apokalyptische Szenario für realistisch hält, sieht sich als befugt an, zu drastischen Gegenmaßnahmen zu greifen.
Der Ruf nach »Widerstand« steht im Rahmen der flüchtlingsfeindlichen Kampagne seit 2015 in einer politischen Tradition. Ab 1970 mobilisierte in der alten Bundesrepublik das rechtsextreme Milieu zur »Aktion Widerstand«, einem wichtigen Markstein auf dem Weg zum neueren rechten Terrorismus. Damals ging es noch nicht gegen Flüchtlinge, sondern gegen die Ostpolitik der Bundesregierung von Kanzler Willy Brandt, dem von rechts der Verrat an deutschen Interessen vorgeworfen wurde.
Bei einem gut besuchten Stadtfest in Chemnitz am 25. August 2018 kommt es wegen einer Nichtigkeit zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei wird Daniel H. mit einem Messer tödlich verletzt. Der schnell ermittelte und festgenommene Hauptverdächtige ist ein syrischer Flüchtling. Rechtsextreme Gruppen nutzen dieses Tötungsdelikt als willkommenen Anlass, um ihre Antiflüchtlings-Kampagne zu einem neuen Höhepunkt zu treiben. In den Sozialen Medien werden schon Stunden nach der Tat absurde Gerüchte und Lügen über das Geschehene verbreitet, wodurch die Stimmung in der Stadt angeheizt wird. Rechte Hooligans schreiten voran – hunderte marschieren am 26. August durch die Stadt: »Wir sind die Krieger, wir sind die Fans, Adolf-Hitler-Hooligans«. Menschen, die für Flüchtlinge gehalten werden, werden aus der Demonstration heraus verfolgt und angegriffen. Auch Polizeikräfte werden attackiert. Am nächsten Tag kommt es zu einem neuen Aufmarsch, etliche weitere sollten folgen. Abends wird das einzige jüdische Restaurant der Stadt unter antisemitischen Parolen überfallen und der Inhaber verletzt. Der Ehrenvorsitzende der AfD, Alexander Gauland, erklärt die Ausschreitungen bei den Protesten ausdrücklich für normal: »Wenn eine solche Tötungstat passiert, ist es normal, dass Menschen ausrasten.«
Die Appelle der Familie des Erstochenen Daniel H., den Tod ihres Angehörigen nicht für rassistische Mobilmachung zu missbrauchen, interessieren die Rechtsextremen nicht. Daniel H., ein Deutschkubaner, war zu Lebzeiten selbst Rassismus ausgesetzt. Ein Justizbeamter verstößt derweil gegen seine professionellen Pflichten und stellt den Haftbefehl gegen den Hauptverdächtigen online. Weitere rechtsextreme Gruppen beginnen, nach Chemnitz zu mobilisieren und beteiligen sich an den Demonstrationen.
Am 1. September ziehen dann tausende Rechtsextreme durch Chemnitz, intensiv begleitet von den Kameras und Mikrofonen der ihnen nahestehenden »alternativen« Presseorgane. Zu diesem Aufmarsch haben Landesverbände der AfD, »Pegida« aus Dresden und »Pro Chemnitz« aufgerufen. Vorne stehen AfD-Funktionäre wie Björn Höcke und Andreas Kalbitz, weiter hinten versammeln sich die militanten Neonazis. Mit dabei ist der spätere Mörder des Kasseler CDU-Politikers Walter Lübcke. Nach dieser Demonstration, so der Attentäter später, »stand fest, dass wir das machen«. Auch die Gruppe »Revolution Chemnitz«, deren Mitglieder später wegen der Planung terroristischer Anschläge verurteilt werden, ist mit dabei. Erneut werden Menschen gejagt. Ein von Vermummten verprügelter Afghane muss im Krankenhaus behandelt werden. Aufgrund einer Blockade durch einen Gegenprotest kommt die Demonstration zwischendurch zum Stehen. Die Neonazis werden noch aggressiver – der Aufzug endet in Chaos und Randalen.
Die Gegenbewegung zu den rassistischen Aufmärschen wächst schließlich an und beginnt sich Tage später durchzusetzen. Am Konzert »Wir sind mehr« mit Bands wie den Toten Hosen und der Chemnitzer Band Kraftklub nehmen am 3. September Zehntausende teil, um gegen die rechtsextreme Eskalation Stellung zu beziehen. Derweil sorgen Äußerungen des amtierenden Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen für Irritationen, als er sich trotz der vielfachen und wohldokumentierten Gewalt festlegt, dass es in Chemnitz keine »Hetzjagden« gegeben habe. Schließlich wird der CDU-Mann in den einstweiligen Ruhestand versetzt.
Auch wenn seit den Ereignissen von Chemnitz mittlerweile einige Zeit vergangen ist: Was sich in diesen Tagen im Sommer 2018 abspielte, wirft Licht auf wichtige Facetten des gegenwärtigen Rechtsextremismus in Deutschland. Rechtsextremismus ist eine gewachsene, vielgestaltige und ausdifferenzierte politische Erscheinung. In immer wieder aufflammenden, mal machtvolleren und mal fehlschlagenden Kampagnen greift die extreme Rechte gesellschaftliche Entwicklungen und Diskussionen auf, und versucht so, die politischen Verhältnisse und die Regeln des sozialen Zusammenlebens zu beeinflussen und letztendlich zu kippen. Dem Rechtsextremismus stehen eigene oder mit ihm zumindest verbundene Medien und Mobilisierungskanäle zur Verfügung. Die Möglichkeiten des Internets allgemein und speziell die Stimmungsmache in Sozialen Medien werden massentauglich eingesetzt. Rechtsextremismus erscheint in Gestalt von politischen Parteien, in Straßenbewegungen, im Netz. Bei Anlässen wie in Chemnitz agieren Rechtsextreme gemeinsam, auch wenn sie sonst häufig genug über Fragen der Haltung, der Strategie und des Programms zerstritten sind. Ein radikaler, exkludierender Nationalismus und Rassismus sind die weltanschaulichen Säulen, und immer wieder tritt ein aggressiver Antisemitismus zutage. Rechtsextreme beschwören Krisenszenarien, rufen zur Tat, verherrlichen die Durchsetzungskraft – darum kommt es aus ihren Reihen heraus zur Anwendung von Gewalt, ja sogar zum Terrorismus. In seiner jahrzehntelangen Geschichte hat der Rechtsextremismus in der Bundesrepublik eigene Traditionen entwickelt, die sich regelmäßig bemerkbar machen: In Chemnitz verwiesen die »Widerstands«-Rufe auf die »Aktion Widerstand« von 1970, also auf eine fast 50 Jahre alte Episode der eigenen Bewegung. Solche Traditionen werden aufrechterhalten, auch wenn sich der Rechtsextremismus in einer sich wandelnden Gesellschaft immer wieder selbst hat wandeln müssen. Viele Phänomene, die mit dem deutschen Rechtsextremismus verbunden sind, lassen sich auch in anderen europäischen und westlichen Ländern übereinstimmend oder in Varianten auffinden. Doch mit der Vergangenheit des Nationalsozialismus und dessen millionenhaftem Morden hat er im Land der Täterinnen und Täter besondere Bedingungen: Nach den konkreten Erfahrungen der deutschen Geschichte haben radikaler Nationalismus und Rassismus eigentlich doch jede legitimatorische Grundlage verloren.
Wie stark sich Rechtsextreme entfalten können, hängt von den politischen Gelegenheiten ab, die sich ihnen bieten, und auch davon, ob sie in der Lage sind, diese auszunutzen. Rechtsextreme agieren nicht in einem Vakuum, sondern sind in die Gesellschaft eingebettet. Ihnen schlägt vielfältiger Widerstand entgegen, der sich sozial, kulturell und politisch in Form von Gegenmaßnahmen und Gegendemonstrationen äußert und der ihre Handlungsoptionen begrenzt. Zu anderen politischen Strömungen hält er Kontakt und kann sich in seiner Agitation auf ein Reservoir an Vorurteilen und Diskriminierungsmustern in Teilen der Bevölkerung stützen. Der Staat wird durch den Rechtsextremismus herausgefordert, hat auf ihn zu reagieren und ihm Grenzen zu setzen. Allerdings gibt es auch – konstant über die Jahrzehnte – in den Behörden Trägerinnen und Träger rechtsextremer Ideen, Verharmlosungen oder sogar Mittun.
Der deutsche Rechtsextremismus hat einen Doppelcharakter. Er stellt einerseits ein zersplittertes, minoritäres Lager dar, das oft stark auf sich selbst bezogen ist und sich seit 1945 in der Opposition befindet. Andererseits ist das entsprechende Denken in vielen Teilen der Bevölkerung zu finden, zumindest in Fragmenten. Das rechtsextreme Lager vermochte es, sich am Leben zu halten und immer wieder Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. In der AfD hat es in den vergangenen Jahren wie bisher nie zuvor eine Partei gefunden, mit der Wahlerfolge erstritten werden und durch die es Einfluss und Finanzkraft generieren kann.
Weiter gehen vom Rechtsextremismus Gefahren für das gesellschaftliche Zusammenleben und die Demokratie aus – und, weniger abstrakt, sind durch ihn Freiheit, Leib und Leben von Menschen gefährdet.
Ein solides Wissen ist ein Rüstzeug, um den Gefahren des Rechtsextremismus begegnen zu können. Zu diesem Zweck bietet dieses Buch einen Überblick zur Gestalt und Geschichte dieses politischen Lagers. Es ist in drei Hauptkapitel gegliedert. Zunächst wird das Begriffsinstrumentarium diskutiert (»Begriffe und Dimensionen«). Die gängigen Definitionsansätze des Rechtsextremismus (bzw.: Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus und ähnliches) werden besprochen und zudem werden die damit verbundenen Inhalte und Hauptideen skizziert.
Zweitens werden im Kapitel »Geschichte und Erscheinungen« das Gewirr der rechtsextremen Organisationen entknotet und die wichtigen Formationen genannt und eingeordnet – ob sie nun regelmäßiger Gegenstand von Presseberichterstattung sind oder weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit existieren. Die Perspektive, die dieses Kapitel einnimmt, betont also die Akteursebene und stellt somit die extreme Rechte und ihre Kampagnen selbst zentral. Die Parteien werden gemeinsam behandelt, ebenso Milieuorganisationen oder die subkulturellen Phänomene. Um ein vollständiges Bild anbieten zu können und um die Wirkmöglichkeiten der extremen Rechten verstehen zu können, müssen auch Übergangsbereiche beachtet werden. Darum wird der Blick – zumindest kursorisch – auch auf die rechtsextremen Anteile in Milieus und Organisationen gerichtet, die für sich genommen nicht oder nicht vollständig rechtsextrem sind. Genauso werden rechtsextreme Tendenzen, wie sie in staatlichen Institutionen vorkommen, eingeordnet. Derweil ist vieles, was in der Berichterstattung zum Rechtsextremismus als Neuigkeit erscheint, keinesfalls beispiellos. Darum werden die gegenwärtigen Phänomene historisch informiert anhand ihrer Entstehung und ihrer Entwicklung in der Zeitgeschichte Deutschlands ab 1945 dargestellt und hergeleitet. Als ein Fallbeispiel für das konkrete Agieren von Rechtsextremen wird die sogenannte »Neue Rechte« und deren jüngste Inkarnation in der »Identitären Bewegung« vorgestellt.
Im dritten Hauptkapitel »Verbreitung und Ursachen« wird der Blick von der Akteursebene gelöst und auf die Rahmenbedingungen gerichtet. Einerseits werden die Erkenntnisse zur Verbreitung rechtsextremer Einstellungen in der Bevölkerung – also die potenzielle Nachfrage zu den Angeboten, die die extreme Rechte macht – diskutiert. Andererseits werden mehrere Ansätze dargestellt, die die Ursachen für den Rechtsextremismus identifizieren.
Als Quellen dienen Dokumente aus der extremen Rechten selbst, aber vor allem schöpfen sich die hier versammelten Informationen aus wissenschaftlicher und journalistischer Literatur über und gegen die extreme Rechte. Auch wenn dieses Buch nicht den Anspruch hat, einen vollständigen Verweisapparat anzubieten, werden einige der Forscherinnen und Forscher, die die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus prägten, genannt und wichtige Publikationen im Anhang aufgeführt.
Dieses Buch spiegelt notwendigerweise den Stand des Wissens zum Thema und kann darum nicht geeignet sein, bestehende Schwächen zu überwinden und Lücken zu schließen. Es handelt sich um ein Überblickswerk zum deutschen Rechtsextremismus, der in den hiesigen Traditionslinien des rechten deutschen Nationalismus steht. Darum ist es nicht leistbar, denjenigen Rechtextremismus in Deutschland, der sich primär auf den Nationalismus in anderen Ländern bezieht, erschöpfend einzubeziehen. Beispielsweise können die Präsenz der »Grauen Wölfe« in türkischstämmigen Communitys in Deutschland oder Gruppen, die mit der faschistischen Ustaša-Bewegung in Kroatien sympathisieren, hier nicht mitbehandelt werden. Ebenso wenig können andere Phänomene wie der islamistische Fundamentalismus – der mit dem Rechtsextremismus einige Gemeinsamkeiten teilt – diskutiert werden.