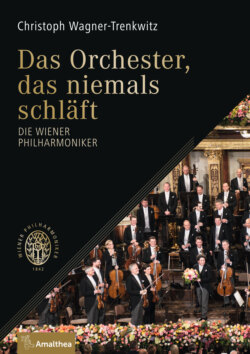Читать книгу Das Orchester, das niemals schläft - Christoph Wagner-Trenkwitz - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Kärntnertor-Theater – heute Wiens berühmtestes Hotel
ОглавлениеHinter der Oper verläuft die Philharmonikerstraße, die 1942, zum 100-Jahr-Jubiläum des Orchesters, so benannt wurde. Überqueren wir sie, stehen wir vor dem weltberühmten Hotel Sacher. Seinen Beinamen als »musikalischstes Hotel Wiens« erwarb es sich nicht nur durch die Unzahl an Gästen »von nebenan«, sondern auch seiner genauen geografischen Lage wegen: An dieser Stelle erhob sich zwischen 1709 und 1870 das »k. u. k. Hofoperntheater nächst dem Kärntnerthore«, das Vorgängergebäude der Oper am Ring. Im Kärntnertor-Theater kamen (wenn wir nur die Jahrzehnte vor der Gründung der Wiener Philharmoniker überfliegen) unter anderem eine Schauspielmusik und ein Klavierkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart, Opern von Joseph Haydn, Antonio Salieri, Conradin Kreutzer, Carl Maria von Weber und Franz Schubert zur Uraufführung. Auch Schuberts Lied Der Erlkönig erklang hier erstmals 1821, und acht Jahre später feierte Frédéric Chopin im Kärntnertor-Theater sein Wiener Debüt als Pianist.
Die bedeutendsten Momente der Geschichte des Hauses sind mit dem Namen Ludwig van Beethoven verbunden: Die Uraufführung der Endfassung des Fidelio fand am 23. Mai 1814, jene der 9. Symphonie am 7. Mai 1824 statt. Beide wurden sie von den Mitgliedern des Orchesters gespielt, aus dem die Wiener Philharmoniker hervorgehen sollten. So groß war die Bindung der Wiener Bevölkerung an diesen musischen Ort, dass dem Hotel Sacher bei seiner Errichtung an derselben Stelle schriftlich verboten wurde, Opernaufführungen abzuhalten …
Wir könnten die Fortsetzung der Philharmonikerstraße, die Walfischgasse, nach rechts wandern (dort, auf Nummer 13, befand sich einst das Café Parsifal, das von Opernmitarbeitern und -besuchern gleichermaßen frequentiert wurde), doch wir flanieren die Kärntner Straße hinauf. Am Ende des Blocks liegt links die Maysedergasse, benannt nach dem Violinvirtuosen Joseph Mayseder, der auch »Konzert- und Solospieler« am Hofoperntheater war. Zwar wurde er niemals Mitglied der Philharmoniker, trat jedoch beim ersten Konzert des Orchesters als Solist in Erscheinung.
Wir biegen rechts in die Annagasse ein, an deren Anfang uns ein Gedenkstern für Arturo Toscanini grüßt. Der italienische »Maestrissimo« prägte die Geschichte unseres Orchesters nur wenige Jahre: Im Oktober 1933 markierte sein Debüt den Beginn des Gastdirigentensystems bei den Philharmonikern; schon Anfang 1938 entschloss sich der glühende Demokrat, das dem Deutschen Reich angeschlossene Österreich und sein Spitzenorchester zu meiden.