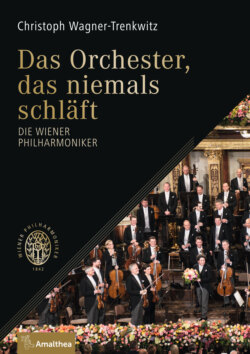Читать книгу Das Orchester, das niemals schläft - Christoph Wagner-Trenkwitz - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAlte und neue Heimat
Gründung und Etablierung des Orchesters (1842–1870)
Nach dem Rundgang durch das Wien der Gegenwart reisen wir nun in die Geschichte unseres Orchesters, um dabei manche Vorahnungen auf das Heute aufzufinden. Kaum mehr nachvollziehbar ist allerdings die Tatsache, dass im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts in Wien kein professionelles Konzertorchester existierte. Für die Aufführung seiner Symphonien musste auch Ludwig van Beethoven auf Amateur-Formationen zurückgreifen.
Die erste »Neunte« und der »Künstler-Verein«
Die Uraufführung von Beethovens 9. Symphonie im Mai 1824 war in mancherlei Hinsicht ein erstes Aufflammen der philharmonischen Idee. Sie fand im Kärntnertor-Theater statt und wurde von den Musikern des Hauses, verstärkt durch das Orchester der Gesellschaft der Musikfreunde, gespielt. Wir denken an den berühmten Ausspruch des philharmonischen Oboisten und Vorstandes Alexander Wunderer: »Wir sind die Nachkommen derer, die von Beethoven erzogen wurden.« Das Ereignis, das neben dem vollständig ertaubten Beethoven noch zwei weitere musikalische Leiter aufzuweisen hatte, krankte allerdings daran, dass dem anspruchsvollen Werk nicht mehr als zwei Gesamtproben zugestanden worden waren.
Der erste Versuch, in Wien ein professionelles Konzertorchester zu etablieren, geht auf Franz Lachner zurück. Er war – wie Otto Nicolai, dem die dauerhafte Gründung neun Jahre später gelang – Komponist und Opernkapellmeister. Der von Lachner ins Leben gerufene, aus Mitgliedern des Opernorchesters bestehende »Künstler-Verein« gab im Jänner 1833 vier Abonnementkonzerte – leider erwies sich die Unternehmung wegen mangelhafter Vorbereitung als wirtschaftlicher Flop.
»Kreuzdonnerwetter – Schwerenoth! Aufgewacht!«
Erst Nicolai verstand es, mit Fleiß und visionärer Beharrlichkeit (die diktatorische Züge annehmen konnte) der Idee eines Profi-Orchesters Leben einzuhauchen. Zwar existiert kein Protokoll der ersten Orchesterversammlung, aber das wie durch ein Wunder bewahrte »Gründungsdekret« aus der Feder Nicolais. Es hebt wie ein in aufgekratzter Laune zu Papier gebrachtes Faschingsmanifest an: »Trin tin tin! Hört! Hört! Es ist die Zeit da, daß die Musiker nicht mehr blos schlafen, oder im Bett geigen wollen! Die Söhne Apollo’s allzusammen, vereint, wollen einmal Hand an’s Werk legen, zu etwas Großem! Kreuzdonnerwetter – Schwerenoth! Aufgewacht!«
Dann kommt Nicolai zur Sache: »Also das sämmtliche Orchester-Personal des k. k. Hofoperntheaters n[ächst] d[em] Kärntnerthor, seinen braven Director Hrn Georg Hellmesberger* an der Spitze hat sich vereinigt, um unter Kapellmeister N[icolai]’s Direction ein Konzert zu geben, das in den Annalen der Wiener Concerte seines Gleichen sucht.« Auf einen Programmentwurf folgt der selbstbewusste Schlussparagraf: »Bravo Nicolai! Und möge das Publikum dich in diesem Unternehmen ermuthigen, damit aus diesem Keim vielleicht ein schöner Baum erblühe!«
Der im preußischen Königsberg geborene Nicolai war – nach einem kurzen Intermezzo 1837/38 – im Jahre 1841 zum zweiten Mal Kapellmeister am k. k. Hofoperntheater geworden. Sein »Comeback« feierte er im Mai 1841 mit einer umjubelten Produktion seiner Oper Il Templario. (Im Salzburger Festspielsommer 2016 entsann man sich dieser Opernrarität und erntete begeisterte Kritiken.) Eine neue Oper sollte er laut Vertrag nun in Wien herausbringen, doch dazu kam es nicht. Der selbstbewusste, alles gebende, aber auch alles fordernde Künstler verließ die Stadt 1847 im Streit mit Intendanz und Orchester; seine Lustigen Weiber von Windsor kamen am 9. März 1849 unter seiner Leitung in Berlin zur Uraufführung, wo Nicolai zwei Monate später auch starb. Wien konnte dem gebürtigen Preußen durch nichts ersetzt werden, wie er seinem Tagebuch anvertraute: »In Berlin ist wohl mehr Ordnung, die ich in Wien erst so schwer vermißte – aber der Wiener hat mehr musikalisches Blut […] Im Süden hat’s halt mehr Talent!«