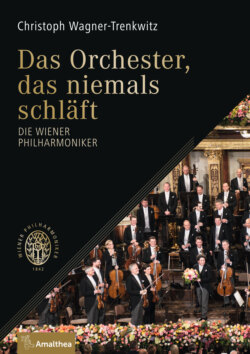Читать книгу Das Orchester, das niemals schläft - Christoph Wagner-Trenkwitz - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie Gründertrias …
… der Philharmoniker bestand neben Nicolai aus dem Wiener Literaten und Journalisten August Schmidt (1808–1891) und dem aus Manchester gebürtigen Deutschen Alfred Julius Becher (1803–1848). Schmidt war unter anderem Mitbegründer der Allgemeinen Wiener Musik-Zeitung (1841), des Wiener Männergesang-Vereins (1843) und der Wiener Singakademie (1858). Ihm verdanken wir die Niederschrift des Mottos, das die Philharmoniker bis heute beseelt, nämlich »in Wien philharmonische Konzerte zu geben, welche sich die Aufgabe stellen sollten, mit den besten Kräften das Beste auf die beste Weise zur Aufführung zu bringen«. Das Leben und tragische Ende des Dr. Becher zeigt, dass die philharmonische Gründung als vorrevolutionäres demokratisches Experiment auch eine politische Dimension hatte: Der Komponist und Dirigent geriet in den Strudel der revolutionären Ereignisse 1848, exponierte sich als Gründer der Zeitung Der Radikale und wurde am 23. November des Jahres in Wien »kriegsrechtlich erschossen«.
Die philharmonische Idee wurde dem Opernorchester wohlgemerkt nicht aufgepflanzt, sondern wuchs aus dem Kollektiv hervor, das sich durch ein Komitee vertreten ließ. Bei dieser Gründung griffen künstlerische Notwendigkeit (die Konzertliteratur, vor allem die Wiener Klassiker Haydn, Mozart und Beethoven, auf hohem Niveau zu pflegen) und wirtschaftliche Notlage ineinander: Das Orchester des Kärntnertor-Theaters war trotz seiner großen Beanspruchung im Theater finanziell keineswegs solide gestellt und sozial kaum abgesichert, von einer Pensionsvorsorge konnte keine Rede sein. Das Einkommen eines Orchestermusikers rangierte laut Clemens Hellsberg hinter dem eines Mittelschullehrers, Büropraktikanten oder eines gut bezahlten Industriearbeiters.
Weg und Mittel zur Orchestergründung lassen sich in einem Begriff zusammenfassen: Autonomie. Die Eigenverantwortlichkeit und damit einhergehende Flexibilität in künstlerischen und wirtschaftlichen Fragen sind Ideale, denen die Philharmoniker bis heute treu geblieben sind. Ebenfalls bis zum heutigen Tage gilt auch die Doppelgleisigkeit der Aufgaben im Opern- und Konzertbetrieb, die zueinander oft genug im Widerspruch stehen. Arbeitnehmer im Opernhaus, Unternehmer in der Konzertwelt, schöpften und schöpfen die Orchestermitglieder gerade aus dieser Spannung die Kraft zu künstlerischen Höchstleistungen.
Die ersten Konzerte
Das Opernorchester des Jahres 1842 zählte nicht einmal halb so viele Mitglieder wie das heutige. Während die Staatsoper anno 2017 über 148 Planstellen verfügt, betrug der Stand in der Nicolai-Zeit gerade einmal 64 Musiker, 31 davon Streicher. Nicolai musste sich also mit »Substituten« (Aushilfen) aus Burgtheater und Hofmusikkapelle behelfen, um im Großen Redoutensaal der Hofburg reüssieren zu können.
Am Beginn des Programmes, das »Am Ostermontag den 28. März 1842, Mittags um halb 1 Uhr« (mit Rücksicht auf den Opernbetrieb konnte das Orchester nur mittags an probenfreien Sonn- und Feiertagen konzertieren) vom »sämmtliche[n] Orchester-Personal des k. k. Hof-Operntheaters« gegeben wurde, stand Ludwig van Beethovens 7. Symphonie. Dieser Klangkörper ist »entstanden, um Beethovens symphonisches Vermächtnis zu erfüllen«, wie schon Hans Weigel feststellte. Außerdem wurde die 1. Leonoren-Ouvertüre des Meisters gespielt – nicht die 3., wie auf dem Programmzettel vermerkt ist. Mit der 3., der »großen«, Leonoren-Ouvertüre hatte Nicolai bereits im Jahr davor Furore gemacht: Er ließ sie zwischen den beiden Fidelio-Akten aufführen. »Jetzt darf man den Fidelio gar nicht mehr ohne dieselbe geben«, vermerkte er stolz in seinem Tagebuch.
Mit der Präsenz von Sängerinnen und Sängern des Operntheaters (sie sangen Mozart und Cherubini) und dem Cellovirtuosen Adrien-François Servais glich dieses erste »Philharmonische« (das freilich noch nicht so hieß) den damals üblichen Orchester-»Akademien«, Konzerten mit langen Mischprogrammen. Der Erfolg des Konzertes war jedenfalls beträchtlich, sowohl in künstlerischer als auch in pekuniärer Hinsicht. Er brachte »einen Neben-Gewinst« ein, »dessen der größte Theil der Orchester-Mitglieder bedürftig ist«, wie Nicolai an Operndirektor Carlo Balochino schrieb.
Nicolai setzte seinen Weg als Leiter der neuen Konzertunternehmung unbeirrt fort und lud am 27. November 1842 zum »zweite[n] Philharmonische[n] Konzert« (der Name war gefunden, wurde aber noch lange nicht auf das Orchester übertragen) in den Redoutensaal. Auf Orchester- und Vokalwerke von Mozart und Louis Spohr folgte zum Abschluss Beethovens 5. Symphonie. Der Mitbegründer der Philharmoniker Dr. Alfred Becher fand prophetische Worte: »… es kann nicht fehlen, daß bei fortgesetztem Streben das Wiener Orchester den besten der Welt angereiht, vielleicht sogar allen übrigen vorgesetzt werden wird.«