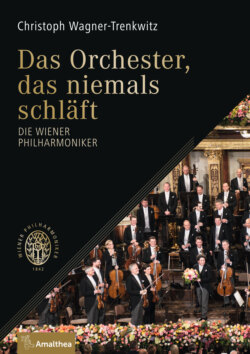Читать книгу Das Orchester, das niemals schläft - Christoph Wagner-Trenkwitz - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Haus der Musik
ОглавлениеWir schlendern die Annagasse hinunter (vorbei am Ristorante Sole, wo Künstler und Publikum gerne nach Staatsopernvorstellungen einkehren), an deren Ende das Haus der Musik liegt. Hier sind wir dem Gründungsmoment der Wiener Philharmoniker aufregend nahe gekommen: Der Komponist und Dirigent Otto Nicolai wohnte in diesem Gebäude während seines Dienstes als Wiener Hofopernkapellmeister. Eine 1942 (zum 100-Jahr-Jubiläum seiner Jahrhundertidee, aus dem Opernorchester ein Konzertensemble zu formen) angebrachte Gedenktafel mit Nicolais Porträt, den Daten seines allzu kurzen Lebens (1810–1849) und dem des ersten von ihm geleiteten Konzertes (das Datum 28. März 1842 werden wir nicht so schnell vergessen!) erinnert an diesen musikhistorischen Markstein.
Der Text auf dem Haus an der Seilerstätte vis-à-vis ist wesentlich blumiger ausgefallen; die Marmortafel gilt der legendären Tänzerin Fanny Elßler, Nicolais Jahrgangskollegin, aber erst 1884 verstorben, deren Ruhm in geradezu mythische Gefilde aufstieg. Davon zeugt die Inschrift »Sie ist das Lächeln ihres Jahrhunderts gewesen, eines der seltenen Meisterwerke, die der Schöpfer viele Menschenalter in seinen Händen wägt, ehe er sie zum Leben entlässt.« Die meistgespielte Vorstellung der Saison 1823/24 im Kärntnertor-Theater war das Zauberballett Die Fee und der Ritter – der Aufführungsrekord verdankt sich niemand anderem als der Hauptdarstellerin Fanny Elßler.
Kehren wir ein in das Haus der Musik, das ehemalige »Palais Erzherzog Carl« an der Seilerstätte. Es beherbergt unter anderem das Historische Archiv des Orchesters sowie im Museum der Wiener Philharmoniker einige öffentlich zugängliche Erinnerungsstücke aus der reichen Orchestergeschichte.
Im ersten Stock passiert man zunächst Schautafeln, die der Geschichte der Wiener Staatsoper gewidmet sind, bevor man in den Raum eintritt, der über die Geschichte der weltberühmten Neujahrskonzerte der Wiener Philharmoniker Auskunft gibt. Nach rechts führt der Weg in einen imaginären Konzertsaal, wo Besucher die Höhepunkte des letzten Neujahrskonzertes sowie des Sommernachtskonzertes der Philharmoniker auf großen Screens erleben können. Nach links geht es in den historischen Spiegelsaal. Hier werden Konzertreisen und Ehrungen, der Ball der Wiener Philharmoniker sowie deren künstlerische Zusammenarbeit mit den Komponisten Johannes Brahms, Anton Bruckner, Gustav Mahler, Richard Strauss, Hans Pfitzner, Franz Schmidt und Alban Berg anhand von Originalexponaten dokumentiert.
Der Blick fällt auch auf Dirigentenstäbe zahlreicher prominenter Orchesterleiter – jener von Toscanini wirkt beim ersten Hinsehen genauso lang wie die anderen. Entsinnen wir uns jedoch, dass der italienische Maestro mit einem besonders langen Stab zu dirigieren pflegte, schauen wir näher hin – tatsächlich, der Stab ist abgebrochen. Dies wird wohl im Zuge eines der legendären Wutanfälle seines Besitzers passiert sein …
Der angrenzende Nicolai-Raum zeigt ein besonderes Dokument österreichischer Kulturgeschichte: das Gründungsdekret der Wiener Philharmoniker (Abb. S. 27). Ferner das erste Foto des Orchesters (1864) und Bilder von Otto Nicolai, der Geiger Georg und Joseph Hellmesberger und anderer. Und, nicht zuletzt, das Programm des ersten Philharmonischen Konzertes … Sie erinnern sich sicher noch des Datums!