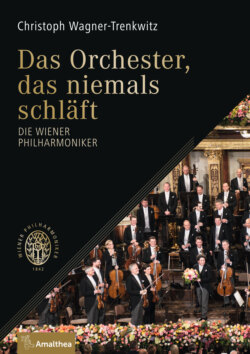Читать книгу Das Orchester, das niemals schläft - Christoph Wagner-Trenkwitz - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1842 – Was für ein Jahr!
ОглавлениеWir könnten nun weiterwandern in die Singerstraße; dort stand einst das Gasthaus »Zum Amor«, wo laut einem verklärten Bericht die Gründungsstunde des Orchesters geschlagen haben soll; dann um die Ecke in die Grünangergasse, wo (in der Redaktionsstube der Allgemeinen Musik-Zeitung) tatsächlich der Plan gefasst wurde, den ersten professionellen Klangkörper Wiens zur Konzertpflege ins Leben zu rufen … Doch es ist Zeit zum Innehalten. Nehmen wir jenes mythische 1842 unter die Lupe, erweist es sich als musikalisch überaus bedeutsames Jahr. Greifen wir die wichtigsten Daten heraus:
Am 3. März findet im Leipziger Gewandhaus die Uraufführung der 3. (Schottischen) Symphonie von Felix Mendelssohn Bartholdy unter der Leitung des Komponisten statt. Nur eine knappe Woche später, am 9. März, erblickt Giuseppe Verdis erster Welterfolg das Licht der Bühne, Nabucco, am Teatro alla Scala in Mailand. Verdi war in doppeltem Sinne eine Schicksalsfigur für Otto Nicolai. Zum einen hatte dieser auf das seiner Meinung nach inferiore Nabucco-Libretto verzichtet (weil »ein ewiges Wüten, Blutvergießen, Schimpfen, Schlagen und Morden kein Sujet für mich« war) und damit dem jüngeren Italiener den Weg zum Weltruhm geebnet. Zum anderen wurde Nicolais größter Opernerfolg, Die lustigen Weiber von Windsor, über 40 Jahre später von Verdis letzter Meisteroper auf denselben Stoff, Falstaff, übertroffen und – zu Unrecht – in den Schatten gestellt. Es überrascht uns nicht, dass Nicolai die Musik des Italieners auf den Tod nicht ausstehen konnte: »Er instrumentiert wie ein Narr […] muss ein Herz wie ein Esel haben und ist wirklich in meinen Augen ein erbärmlicher, verachtungswerter Kompositeur.«
Der knapp 30-jährige Verdi besuchte Wien im April 1843 und leitete seinen Nabucco am Wiener Kärntnertor-Theater – mit den Musikern des Philharmonischen Orchesters. Schon 1842, am 19. Mai, hatten sie die Uraufführung von Gaetano Donizettis Linda di Chamounix gespielt. Es ist bemerkenswert, dass der Wiener »Rossini-Taumel« vom Beginn der 1820er-Jahre, also die Begeisterung für den Komponisten des Barbier von Sevilla, zwei Jahrzehnte später mit Donizetti eine Neuauflage fand. Die deutsche Opernkunst spielte damals in Wien die zweite Geige, wenngleich der Großmeister schon vor der Tür stand: Am 20. Oktober 1842 wird am Königlichen Hoftheater Dresden Richard Wagners Rienzi herausgebracht. Erst am 30. Mai 1871, bereits im »neuen« Haus am Ring, erlebte das Werk seine österreichische Erstaufführung. Weitere herausragende Novitäten anno 1842 sind Michail Glinkas Ruslan und Ljudmila (9. Dezember in Sankt Petersburg) und schließlich, am letzten Tag des Jahres, Albert Lortzings Der Wildschütz am Stadttheater Leipzig.
Arrigo Boito, der italienische Komponist und Librettist (unter anderem von Verdis letzten Opern Otello und Falstaff), wird am 24. Februar 1842 geboren, die Operettenkomponisten Carl Millöcker, Arthur Sullivan und Carl Zeller am 29. April, 13. Mai und 19. Juni. Mit Letzteren hatte unser Orchester kaum Berührungspunkte, mehr dagegen mit den Werken des Franzosen Jules Massenet, der am 12. Mai zur Welt kommt: So spielten sie etwa die Uraufführung seines Werther 1892 in der Wiener Hofoper.
Der Geburtstag einer Schwester-Institution, der auf den 2. April 1842 fällt, sei ebenfalls erwähnt: Die »Philharmonic Symphony Society of New York« wird gegründet, damit sind die New Yorker nur wenige Tage jünger als die Wiener Philharmoniker und das älteste Symphonieorchester der USA. Zwei Todestage mögen diesen musikalischen Streifzug 1842 abrunden: Mozarts Witwe Constanze verstirbt (knapp 51 Jahre nach ihrem Mann!) am 6. März in Salzburg, und der seinerzeit hochberühmte Komponist Luigi Cherubini am 15. März in Paris. Als die Wiener Philharmoniker, noch unter der Bezeichnung »Orchesterpersonal des k. k. Hof-Operntheaters«, erstmals konzertierten, nahmen sie auch zwei Stücke des jüngst Verstorbenen in ihr Programm auf.
Im Nicolai-Raum des Hauses der Musik sind wir der Gründung der Philharmoniker geradezu physisch nahe gekommen. Und können kaum glauben, dass einstmals auch andere Gründungsdaten kursierten als jenes Jahr 1842 … doch mehr darüber im nächsten Kapitel.