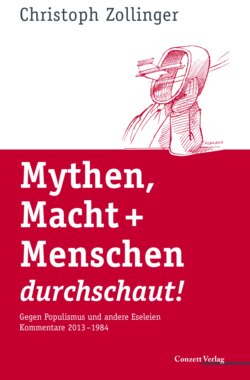Читать книгу Mythen, Macht + Menschen durchschaut! - Christoph Zollinger - Страница 6
ОглавлениеVorwort
I. Persönliche Agenda
Gesucht
Die abenteuerliche Idee, einen Teil meiner in den letzten 30 Jahren publizierten Artikel in einem kleinen, harmlosen Buch zusammenzufassen, ist natürlich ein gewagtes Unternehmen. Kritikern sei, bevor sie die Stirne runzeln, versichert: Wer sich getroffen fühlt, der ist gemeint! Ja, es kommt noch besser. Leserinnen und Lesern – sofern sie überhaupt weiterblättern – sei offenbart: In Tat und Wahrheit entfaltet sich auf den nächsten 367 Seiten auch eine Art subversiver Streitschrift. Das an sich für konservative Geister schon schwer nachvollziehbare Ziel, statt vergangene Mythen zu beschwören, latente gesellschaftliche Trends aufzuspüren und damit zukünftige Szenarien zu malen, ist vordergründig durch Kommentare, Zwischenrufe und Fragen getarnt. Doch hinter der Fassade – durchschaut! – verbreiten sich, in bester Tradition eines Stéphane Hessel, Thesen eines Bürgers, der sich unablässig mit der Zukunft der Gesellschaft auseinandersetzt. Dieses wertvolle Bürgerrecht nehme ich mir heraus. Weil ich es gleichsetze mit herausfordernder Bürgerverantwortung. Ich gestatte mir ab und zu, mich zu empören. Und ich freue mich unverhohlen, wenn sich heute so etwas wie ein Epochaler Neubeginn abzeichnet. Alle Versuche der Machterhaltung sind doch à la longue zum Scheitern verurteilt, wo sie auf Unrecht, überholten Privilegien, wirtschaftlichen Missverständnissen oder sturen, politischen Denkweisen beruhen.
Meine Suche richtet sich immer auf die großen Zusammenhänge. Weniger Einzelereignisse als die gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Prozesse in ihrer Gesamtwirkung faszinieren mich. Schon immer, aber in Zeiten der digitalen Transformation erst recht, blieb und bleibt keine noch so kluge Einzellösung ohne unbedachte Nebenwirkungen. Zu oft werden diese erst im Nachhinein sichtbar.
Gefragt
Viele meiner Sätze enden mit Fragezeichen. Damit bezwecke ich zweierlei. Fragen, schon bei unseren Kleinen, sind unendlich viel mehr wert als vorschnelle Antworten, besonders jener Erwachsenen, die immer schon alles wussten. Dass unser Wissen sich gelegentlich als Scheinwissen entpuppt – das zu beweisen, darin war Sokrates, gemäß mündlicher Überlieferung, unser aller Meister –, ist eine Tatsache, die man über die Jahre immer eindrücklicher erkennt. Auch jene, dass Denken ohne zu handeln uns nicht viel weiterbringt. Der Wert des vernünftigen und dialektischen Denkens – sei es auch nur in der leisen Form des Selbstgesprächs – ist eine wichtige menschliche Tätigkeit. Es würde mich freuen, wenn meine Kolumnen zum Nachdenken anregen könnten.
Gehört
Ich entwickelte die hier ausgewählten Beiträge über den Zeitraum von 1984–2013. Wenn ich mich über scheinbare Gewissheiten, gut getarnte, letztlich dennoch vergängliche Ideologien und rationales, vermeintliches Wissen wunderte oder amüsierte, dann vorerst aus dem einleuchtenden Grund, dass ich da zu oft nicht zustimmen mochte. Der Anspruch, die richtigen Lösungen der drängenden Probleme unserer Zeit zu kennen, liegt mir fern. Der missionarische Eifer, die Nichtwissenden aufzuklären, ist meiner Familie vor Generationen abhandengekommen. Über die Jahre habe ich – gerade weil ich mich brennend für die liberalen eher als konservativen Ideen zu begeistern vermag – eine gelassene Strategie entwickelt. »Ich weiß es nicht« ist heute eine meiner bevorzugten Antworten. Andere wissen es zwar auch nicht, aber sie wissen es nicht. Oder sie wissen nicht, was sie nicht wissen.
Gelesen
Meine gelegentlichen Seitenhiebe gegen einen Teil der Medien sind gut begründet: Immer mehr instrumentalisieren sie Personen und Vorkommnisse, indem sie daraus Skandale, Verschwörungen oder Betrügereien konstruieren. Natürlich las schon mein Großvater mit Akribie die damalige Zeitungsrückseite »Unglücksfälle und Verbrechen«. Widerspiegelte sie dannzumal vorwiegend das lokale und regionale Umfeld, ist daraus mittlerweile kontinentale und globale Aufgeregtheit entstanden: Das in unseren Köpfen medial vermittelte Weltbild entspricht nur zu einem verschwindenden Teil dem, was tatsächlich wichtig wäre.
Auch in der Wirtschaft sind charismatisch nicht unbegabte Übermenschen anzutreffen. Die Entwicklung der internationalen Finanzindustrie in den letzten 25 Jahren ist geprägt vom Wahn-Sinn jener rund 10’000 Individuen, die an der Spitze der globalisierten Finanzelite ein Inselleben führen, das für den Rest der Welt brandgefährlich ist. Auf ihren persönlichen, materiellen Vorteil fixiert, blenden sie die verheerenden, gesellschaftlichen Folgen ihrer Aktivität aus. Der entstehende Flurschaden dieses in höchstem Maße polarisierenden Verhaltens tritt mit Verzögerung ein. 2007 erschütterte die weltweite Finanz- und Bankenkrise unser naives Verständnis. In der Folge mussten die Steuerzahler weltweit einspringen, um einige eben dieser vornehmen Bankhäuser vor dem Kollaps zu retten. In der Schweiz die UBS.
Gedacht
Liberale Ideen, und was darunter aus meiner Sicht zu verstehen ist, möchte ich auch gleich vor- und klarstellen. Freiheit, ohne die Qualitäten Transparenz und Ganzheit ehrlich einzuschließen, ist nicht liberal. Heute ist der Staat nicht à priori Widersacher der persönlichen, freien Entfaltung. Schweizer Tradition und freiheitliche Ideen nur auf der Basis der Privatautonomie zu erforschen, ist mir zu eng. Offene Märkte ja, aber nicht immer und überall. Liberalismus ist freiheitliche Verantwortung. Verantwortung ist nur ganzheitlich verstanden liberal. Dann bin ich einverstanden.
Ganz offensichtlich, ja geradezu penetrant beharrlich, versuche ich seit Jahren, einen Beitrag zur rechtzeitigen Veränderung meiner Heimat vor dem Hintergrund zukünftiger Veränderungszwänge zu leisten. Dieser Drang entstammt wohl der Idee, dass die Welt nicht stillsteht. »Wer verharrt, verfällt«, meinte einst Jean Gebser. Da werden zwar nicht alle einverstanden sein, doch für mich stimmt das. Vorausschauen, antizipieren, projektieren, handeln. Was verändert werden soll? Wirtschaftliche Konzepte, politische Strukturen, gesellschaftliche Usanzen.
Verändern zu wollen heißt auch kritisieren. Dies wiederum hat nichts damit zu tun, dass ich die Schweiz schlecht machen will. Das Gegenteil trifft zu. Doch, nochmals: Was gut bleiben soll, muss sich rechtzeitig verändern. Und schließlich war auch Albert Einstein überzeugt: »Ich gedenke, in der Zukunft zu leben.«
Gehandelt
Während 40 Jahren war ich an vorderster Front im Food-Detailhandel involviert bei der Veränderung dieser Landschaft. In den Führungsetagen bei Denner (1. Discounter der Schweiz), Metro (1. Cash+Carry Europas), Jelmoli (1. Warenhaus mit Food-Center) pflügten wir in diesen Pionierfirmen eine ganze Branche radikal um (1961–1981). Als selbständiger Unternehmensberater habe ich in der Folge – oft auch gegen Widerstände von Firmeninhabern, sogenannten Patriarchen – als Erster in der Schweiz neue Verkaufsformen eingeführt (1981–2001), über deren Rentabilität sich meine Auftraggeber nicht zu beklagen hatten und die langfristig Erfolge generierten. Diese modernen Konzepte (Autobahnshops, Tankstellenshops, Hotelshops, Bahnhofshops APERTO, Globus DELICATESSA etc.) waren ihrer Zeit voraus.
Als Gemeinderat (Exekutive) meines Wohnorts Kilchberg handelte ich (1994–2002), nachdem ich mich vorgängig als politischer Schreibtischtäter nicht nur beliebt gemacht hatte (Pseudonym »Libero«). Und siehe da: Entgegen der landläufigen Meinung, sie, die Politik, bewege sich kaum, ließ sie sich durchaus bewegen: So gründete ich – als Sozialvorstand – den Jugendverein, den Jugendtreff, die Kinderkrippe, den Mittagstisch für Schülerinnen und Schüler, den regionalen »Runden Tisch« für Altersfragen.
Was die Gesellschaft betrifft, habe ich aktiv die Idee verfolgt, dass politische Mitwirkung nicht parteigebunden sein muss. 10 Jahre (2002–2012) koordinierte ich motivierte Kilchbergerinnen und Kilchberger bei ihrer Arbeit in Behörden und Kommissionen der Gemeinde (Vereinigung der Parteilosen, Kilchberg).
Engagierte Menschen aus der Bevölkerung in politischen Ämtern aktiv werden zu lassen, ohne vorgängig Parteikarriere gemacht zu haben, hat sich zu einem Erfolgsmodell entwickelt; die Parteilosen in Kilchberg sind inzwischen klar die zweitstärkste politische Kraft. Ja, sie sind, seit 2011, vielleicht so etwas wie ein Musterbeispiel für die Entwicklung der Parteilosenidee auf nationaler Ebene.
Die Suche nach dem roten Faden über die nächsten Seiten will ich nicht erschweren. Schon bald wird ja eine mehr oder weniger versteckte Absicht offensichtlich: Ich bin dezidiert gegen polarisierende Elemente in Politik und Wirtschaft. Mit Elementen sind »wichtige« Menschen und Machtträger gemeint. Die Brandstifter links und rechts außen auf der Politskala verhindern zu oft tragfähige und sinnvolle Lösungen. Diese Personen mögen ideologisch verblendet oder finanziell zu gut gepolstert sein. Ihr Gehabe entspringt einer perfektionierten, sektoriellen Wahrnehmungsfähigkeit. Das heißt im Klartext: Wer nur die eine Hälfte des Ganzen sieht, wird immer den Gegendruck der anderen Hälfte stärken und letztlich, statt langfristig weiterzukommen, an Ort treten.
Gefunden
Wenn ich in meinen Beiträgen und Büchern immer wieder Sokrates und andere Leuchtfiguren aus dem antiken Griechenland zitiere, so aus zwei Gründen. Im Allgemeinen: Es ist für mich schlicht staunenswert, was vor 2500 Jahren im alten Athen gedacht wurde. Im Speziellen zu Sokrates: »Erkenne dich selbst«, jene berühmte Aufforderung am Tempel des Apollon in Delphi, erinnert seither daran, wir sollten uns auf die Suche begeben, um an deren Ende schließlich zu erkennen, dass die Weisheit im Wissen um unsere eigene Unwissenheit besteht.
Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und – Philosophie. Das sind meine Themen als Zeitdiagnostiker. Ein wichtiger Bestandteil des Verstehenwollens unserer Zeit ist deren Durchschauen aus philosophischer Perspektive. Sowohl die Ergebnisse empirischer Forschung als auch die Ergebnisse wissenschaftlicher Erhebungen sind – das ist wenigstens meine Überzeugung – immer kritisch zu hinterfragen. Wie kämen wir sonst zu ethischen Fragen oder nachhaltigen Kriterien? Dazu eignet sich philosophisches Gedankengut aus 2500 Jahren. Tatsächlich können wir daraus eine Menge lernen. »Wir« heißt in diesem Fall jene unverbesserlich optimistische Gruppe von Menschen, die Geschichte und Philosophie als einander bedingend, beeinflussend und äußerst spannend und abenteuerlich erachten.
Schreiben ist meine Leidenschaft. »Und wenn mich kein Mensch lesen wird, habe ich deswegen meine Zeit damit verloren, dass ich so manche müßige Stunden mit solch nützlichen und angenehmen Gedanken verbracht habe?«, fragte sich Montaigne schon vor einiger Zeit. Angesichts der eher bescheidenen Auflagen meiner Bücher erkenne ich mich in diesen Gedanken selbst; die aufmunternden Worte meiner Gattin, »da hast du etwas in die Welt gesetzt«, waren jedenfalls verdankenswerter Trost und beruhigende Motivation. Ich schreibe offensichtlich keine massenkompatiblen Bücher.
Geschrieben
Ich habe mich entschlossen, meine Aufsätze chronologisch, mit dem letzten beginnend, aufzuführen. Den Anfang macht deshalb eine Auswahl meiner 100 Internetkolumnen durchschaut!, die ab 2012 auch in der Internetzeitung »Journal 21« erscheinen.
Meine Frau Käti hat meine Schreibwut und gelegentlichen gedanklichen Abwesenheitsphasen also während nunmehr über 30 Jahren erduldet. Dass wir beiden 2013 die Goldene Hochzeit feiern durften, spricht nochmals für Käti (aber nicht nur für sie). Wofür ihr ein ehrliches, gewaltiges Dankeschön gehört.
Einen kleinen Teil dieses Werkes bilden Hinweise auf meine vier Bücher, seit 2002 publiziert:
»EPOCHALER NEUBEGINN – Update nach 2500 Jahren« (2011)*, (*Trilogie)
»2032 – Rückblick auf die Zukunft der Schweiz« (2008)
»Die Debatte läuft – Ganzheitliche Thesen für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik« (2005)*
»Die Glaskugel-Gesellschaft – Transparenz als Schlüssel zur Moderne« (2002)*
Diese Trilogie widerspiegelt meine jahrelange Überzeugung, wonach der Ruf nach vermehrter Transparenz dazu führen wird, dass mehr und mehr Menschen den ganzheitlichen Aspekt unseres Daseins erkennen und dadurch der Dualismus unserer Tage überwunden werden kann. Meine These wird seit einigen Jahren unterstützt durch überraschende Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Einem Update nach 2500 Jahren demokratischer und gesellschaftlicher Grundregeln stünde nichts im Wege. Was mich außerordentlich freut.
Das »rote« Schweizerbuch – aus dem Jahre 2032 in der fiktiven Rückschau geschrieben – ist Antizipation, Wunschdenken und Provokation in einem. Bereits im zweiten von drei Teilen (dem Jahr 2012) ereignete sich einiges, was ich schon 2006 »erfunden« hatte. Früher Spaß, späte Genugtuung.
II. Politische Agenda
Ob wir uns zu Beginn des 21. Jahrhunderts in einer Phase des Epochalen Neubeginns befinden, wird sich erst in der Rückschau herausstellen. Vielleicht in 100 Jahren? Ein geschichtlicher Wendepunkt wird ja erst dann epochal, wenn ein neues, alles grundlegend beeinflussendes Prinzip in die alte Welt einbricht.
Konservative Kräfte bestehen aus zwei Gruppen. Die erste versucht heute, jene Verhältnisse (Gesetze, Rechtsprechung, politisches System) zu bewahren, die ihnen zu Macht und Reichtum verholfen haben. Die zweite, bescheidenere profitiert auf familiärem Niveau von mehr Selbstbestimmung und Wohlstand. Sie unterstützen die erste Gruppe aus Überzeugung und in guten Treuen – ehrlich, bodenständig, arbeitsam. Bei Abstimmungen und Wahlen verhelfen sie ihnen zu politischem Einfluss. So war es schon zu Gotthelfs Zeiten. Beide Gruppen orientieren sich eher Richtung Vergangenheit, gelegentlich auch durch Mythen verklärt.
Liberale aller Schattierungen sind dagegen eher zukunftsorientiert. Ihre Reaktion auf die Weltveränderungen (Globalisierung, Internet, Big Data) ist generell dynamisch, auf Erneuerung erpicht. Sie treten ein für Strukturreformen (wieder: Gesetze, Rechtsprechung, politisches System). Sie ahnen, dass einst erfolgreiche Modelle im schnellen Wandel der Zeit veralten, ja zum Standortnachteil mutieren können. Wer rastet, rostet. Nicht im Erhalt der alten (»so sind wir gut gefahren«) Lösungen sehen sie ihre zukünftigen Erfolgschancen, sondern in deren Wandlung (»kreative, schöpferische Zerstörung«). Davon versprechen sie sich … Macht, Reichtum, Selbstbestimmung, Wohlstand. Auch hier unterstützen die einen, die vielen politisch wenig Interessierten, die andern, die sich exponieren, die kämpfen und handeln. Sie erhoffen sich damit mehr politischen Einfluss, der neuen Ideen zum Durchbruch verhelfen könnte.
Den Einwand, diese Zweiteilung sei willkürlich und vereinfachend, lasse ich voll und ganz gelten. Ich werde ihn später erklären. Denn vorerst gilt es, zwei weitere Tatsachen zu akzeptieren.
Auch beim weltweit wichtigsten Anliegen der heutigen Zeit – dem Gebot der Nachhaltigkeit – ist exakt dieses dualistische Weltbild ein großes Problem. Wer sich fundiert mit Alternativenergien, Umweltanliegen und sich daraus ableitenden, dringenden Strukturreformen beschäftigt, wird zustimmen. Konservative Kreise verharmlosen im Allgemeinen die Erderwärmung, belächeln Alternativenergien, bekämpfen grüne Anliegen und strengere Raumplanungsgesetze. Ihre Kampagnen werden finanziert durch ebenso konservative wie finanzkräftige Interessengruppen (in erster Linie die Erdöl-, Bergbau-, Bau- und Atomlobbys). Sie alle schöpfen ihren Reichtum aus einst erfolgreichen Modellen, deren Problematik inzwischen erkannt ist. Dass sie diese Einwände verharmlosen oder verleugnen, ist menschlich. Sie wenden dafür weltweit Hunderte von Millionen Dollar auf. In der kleinen Schweiz sind es Dutzende von Millionen Schweizerfranken.
In den Medien ist es üblich, die politische Landschaft in links und rechts einzuteilen. Auch diese Zweiteilung ist natürlich willkürlich und vereinfachend. Sie entspringt in ihrer heutigen Einfältigkeit dem Zeitgeist des 19. Jahrhunderts. Doch, man hat es seither immer so gemacht. Proletariat hier, Kapitalismus dort in zeitgemässe Definitionen gekleidet. Solange die Republikaner in den USA ihren Präsidenten Barack Obama als »linken Europäer« diffamieren und Demokraten das vereinfachte Bild der Republikaner als »nimmersatte Steuerhinterzieher und Staatsabbauer« klischieren, wird sich daran kurzfristig wenig ändern. Tatsächlich aber gibt es in der Politik weder Linke noch Rechte. Der Mensch lässt sich so unbedacht nicht zuweisen.
Eigenartigerweise sind es gerade Politologen und Journalisten, die überholte Schlagworte verwenden, ohne weiter darüber nachzudenken. Ich selbst bin ein ausgesprochen liberaler Mensch, der gleichzeitig ökologisch und ökonomisch denkt. Ich trete ein für sorgfältigen und bewussten Ressourcenverbrauch, für starke Privatinitiative und zurückhaltende, staatliche Regulierung. Bin ich jetzt links oder rechts? Das soll mir mal einer erklären.
Diese Beispiele stehen stellvertretend für die Krankheit unserer Zeit. Konservative bekämpfen Liberale. Ewiggestrige streiten für ihre Atomkraftwerke gegen Pioniere von Alternativenergien. Rechte politisieren an Linken vorbei, als seien diese Aussätzige. Warum? Weil das immer so war?
Gottlieb Duttweiler, ein wahrer Pionier der Schweiz, entwickelte im letzten Jahrhundert Ansätze zur Überwindung dieses überholten Dualismus. Er war ein kaufmännisches Genie, also ein »Kapitalist«. Er entwickelte kühne Ideen, um in der Zukunft erfolgreich zu bestehen. Und er entzog sich nicht einer ausgesprochen ehrlichen sozialen Verantwortung. Als Kapitalist verschenkte er seinen Besitz, mit revolutionären Ideen erneuerte er von Grund auf den Lebensmitteldetailhandel (und zerstörte aus Wut mit einem Stein eine Glasscheibe im Bundeshaus) und er trat ein für die Arbeitenden aller Schichten. Duttweiler dachte, plante und handelte ganzheitlich. Er realisierte, dass Kooperation wichtiger ist als Kampf. Die von ihm gegründete Migros ist eine erfolgreiche Genossenschaft. Die von ihm seinerzeit lancierte Tageszeitung trug den Namen »Die Tat« – die Wochenzeitung nannte er »Wir Brückenbauer«. Selbstredend. Die von ihm gegründete politische Partei trug den etwas verklärten Namen »Landesring der Unabhängigen«. Zu seiner Zeit ein Erfolgsmodell.
Ein Visionär. Inzwischen hat das Migros-Management viele seiner Ideen »modernisiert«, dem Zeitgeist geopfert. Aus dem Brückenbauer wurde das Migros-Magazin. »Die Tat« ist längst eingestellt, mangels Auflage (oder mangels Professionalität?). Brückenbauer zu sein ist nicht mehr zeitgemäß. Kurzsichtige Optik professionell geschulter Ökonomen?
Die Glaskugel-Gesellschaft
Die fragile Glaskugel als Signatur einer transparenten, globalisierten und selbstverantwortlichen Gesellschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts steht für die vom All her gesehene Erdkugel von verletzlicher Schönheit und zerbrechlichem Gleichgewicht, von endlicher Größe, aber ohne Grenzen. Die rotierende Glaskugel symbolisiert gleichzeitig das integrale Zukunftsbild: kein dualistisches Links oder Rechts, Oben oder Unten, sondern ein ganzheitlich wahrgenommenes, durchsichtiges Ganzes, das in einem nachhaltigen Netzwerk von Natur und Mensch den Durchblick wahrt.
www.glaskugel-gesellschaft.ch