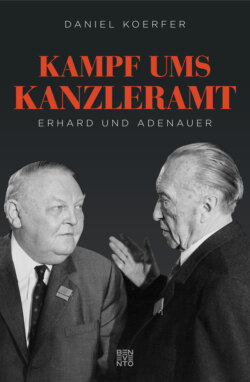Читать книгу Kampf ums Kanzleramt - Daniel Koerfer - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
JUGEND, WELTKRIEG, WIRTSCHAFTSKRISEN – UND MARKTFORSCHUNG IM DRITTEN REICH
ОглавлениеWer war Ludwig Erhard? Welche Erfahrungen und Eindrücke haben seine Kindheits-, seine Jugendjahre bestimmt? Was ist für das Verständnis seiner Persönlichkeit, seiner Mentalität wichtig? Geboren wurde er am 4. Februar 1897 in der Sternstraße 5 in Fürth. In diese aufblühende Gewerbe-, Handelsund Garnisonsstadt mit ihren damals rund 50 000 Einwohnern war sein Vater, Philipp Wilhelm Erhard, schon rund ein Jahrzehnt früher gezogen. Als Sohn eines armen Kleinbauern aus dem Dörfchen Rannungen in der unterfränkischen Rhön hatte er sich zuvor in Schweinfurt als Lehrling, Gehilfe, Handelsvertreter im Textileinzelhandel verdingt, schließlich in Fürth als selbstständiger Kaufmann niedergelassen. Dort hatte er auch geheiratet. Die Mutter, Augusta Friederika Anna Erhard, geborene Haßold, entstammte einer alten fränkischen Handwerkerfamilie; ihr Vater war Seilermeister.1 Ihre Mitgift und die eigenen Ersparnisse gestatteten es Wilhelm Erhard, sein eigenes Weiß-, Wollwaren- und Ausstattungsgeschäft zu eröffnen. Vom Bauernsohn zum Kaufmann – Stationen eines sozialen Aufstiegs, wie ihn das wirtschaftlich prosperierende Kaiserreich im ausgehenden 19. Jahrhundert vielfach ermöglichte.
Das Milieu, in dem Erhard aufwuchs, wird man wohl zunächst als kleinbürgerlich bezeichnen können, obgleich hier von Anfang an die geistige Enge fehlte, die oft genug damit verbunden ist.2 In seinem Elternhaus herrschte eine beträchtliche Aufgeschlossenheit und Offenheit. Das war für Fürth nicht unüblich. Denn das politische und kulturelle Klima der Stadt war geprägt von Toleranz, der jüdische Bevölkerungsanteil war hoch, lag bei etwa zwanzig Prozent. Die konfessionelle Mischehe der Erhards wirkte sich deshalb nicht als Belastung, als Nachteil für die Familie aus. Der Vater, ein Katholik, ließ die Kinder durch die Mutter ihrem Wunsch entsprechend protestantisch erziehen. An den Familienfeiern nahmen jedoch Geistliche beider Konfessionen teil. Diese Erfahrung der religiösen Versöhnlichkeit und Harmonie war für den jungen Erhard wichtig, wirkte »formend« auf ihn und ließ in ihm die Vorstellung wachsen, dass zwischen Menschen unterschiedlicher Auffassung bei etwas gutem Willen stets ein Ausgleich gefunden werden könne.3
Die politische Einstellung seines Vaters, der Familie umschrieb Erhard selbst später mit den Worten »kaiser- und königstreu«.4 Der Vater gehörte zu den Bewunderern der Hohenzollern – nicht von ungefähr bekam sein Sohn Ludwig, das zweitjüngste der vier überlebenden Kinder, den weiteren Vornamen Wilhelm5, verehrte daneben aber auch Otto von Bismarck, übrigens gleichzeitig noch Eugen Richter, ebenjenen Mann, der im Namen seiner Deutschen Freisinnigen Partei größere Rechte für den Mittelstand forderte und bei dessen Reichstagsreden der Kanzler Bismarck den Saal zu verlassen pflegte. Solche Widersprüche nahm man damals nicht tragisch – man war liberal.6
Ludwig Erhards Kindheit stand, was die persönlichen Lebensumstände anbelangt, unter einem guten Stern, auch wenn er mit drei Jahren an spinaler Kinderlähmung erkrankte, eine bleibende Gehbehinderung zurückbehielt und sein Leben lang orthopädische Schuhe tragen musste. Das materielle Auskommen der Familie war mehr als gesichert – er wuchs auf in einer »Atmosphäre bürgerlicher Beschaulichkeit und Sorglosigkeit, die keine Zweifel und Skrupel über die Angemessenheit einer scheinbar festgefügten gesellschaftlichen Ordnung aufkommen ließ«, wie er sich 1958 erinnerte.7
Kindheit und Jugend im prosperierenden Kaiserreich – Ludwig Erhard mit seinen Eltern um 1915.
Schon sehr früh schien der weitere Lebensweg klar und deutlich vorgezeichnet. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte Ludwig Erhard die Königliche Realschule in Fürth, die er mit dem »Einjährigen« beendete. Ein eher mittelmäßiger Schüler, der in Mathematik mit der Note »genügend« abschloss; die Eltern sahen keine Veranlassung, ihn auf das Gymnasium zu schicken und das Abitur machen zu lassen. Das »Einjährige«8 war Qualifikation genug, wenn er nach einer kaufmännischen Lehre in einem Nürnberger Textilkaufhaus das väterliche Geschäft, wie ausgemacht und abgesprochen, übernehmen sollte. Zwar reizte den jungen Ludwig Erhard, der als Kind das Klavierspiel gelernt hatte und in dem die Liebe zur Musik gewachsen war, der Gedanke, Dirigent zu werden, aber schließlich fügte er sich den elterlichen, vor allem den väterlichen Wünschen und unternahm die ersten Schritte in Richtung Kaufmann und Weißwarenhandel. Es war eine Zeit, in der man als Lehrling sechzig Stunden in der Woche arbeiten musste, was er gerne getan habe, und der Spitzensatz der Einkommensteuer bei 4,5 Prozent lag, wie er sich später leicht amüsiert erinnerte.
Doch der Krieg machte alle Pläne zunichte. 1916 wurde Ludwig Erhard, nachdem sein älterer Bruder Max am Ostermontag 1915 gefallen war und er sich daraufhin trotz seiner Gehbehinderung aus Patriotismus freiwillig gemeldet hatte, zum 22. Königlich bayerischen Feldartillerie-Regiment (Nürnberg) eingezogen. Nach der üblichen oberflächlichen Ausbildung schickte man ihn als Richtkanonier in die Stellungskämpfe in den Vogesen, im Münstertal, ab Oktober 1916 dann nach Siebenbürgen, an die rumänische Front. Dort wurde seine Einheit in zahlreiche Gefechte verwickelt. Er selbst erkrankte an Flecktyphus, überlebte aber, dem Mangel an Medikamenten und den ärztlichen Prognosen zum Trotz, bewies eine erstaunliche körperliche Robustheit und Widerstandskraft.
Sein optimistisches Naturell ließ ihn die Kriegserfahrungen auch nicht als primär traumatische Phase in Erinnerung behalten, sondern vor allem als eine Zeit, wo man Kameradschaft und Verlässlichkeit in einer Gemeinschaft kennenlernte, was er als sehr positiv wahrnehmen sollte. In seiner Privatbibliothek gibt es einen Baedeker-Band aus der Vorkriegszeit zu Rumänien, den er damals wohl im Tornister mitgenommen hatte und in dem sich die handkolorierte Zeichnung eines kleinen Städtchens mit Kirchturm findet. Von Hand hatte er auf diesem Bild vermutlich noch an der Front mit Bleistift einen kleinen Pfeil auf diesen Turm eingezeichnet und daran geschrieben: »Den hab ich zerschossen« – die naive Freude des Richtkanoniers über einen Treffer festhaltend.
Er berechnet die Geschossbahnen: Erhard als Richtkanonier auf der Geschütz-Lafette mit seiner Einheit in Rumänien, Herbst 1916.
Er bringt es zum Unteroffizier und Offiziersanwärter, auch wenn er bei der ersten Prüfung im November 1917 noch durchfällt. Nach dem Waffenstillstand an der rumänischen Front im Dezember 1917 wird er nach Flandern versetzt, wo er im Februar 1918 die zweite Prüfung zum Offiziersanwärter besteht.9 Kurz vor Kriegsende treffen den mittlerweile zum Wachtmeister Beförderten bei Ypern mehrere Granatsplitter, verwundeten ihn schwer. Erst nach sieben Operationen konnte er seinen linken Arm, seine linke Schulter unter Mühe und Schmerzen wieder bewegen. Tiefe Narben blieben zurück. Aber Ludwig Erhard überstand auch das, überstand sogar die hohen Dosen Morphium, die ihm wegen der qualvollen Schmerzen verabreicht worden waren.10 Diese Zähigkeit, diese Fähigkeit, seinem Körper höchste Belastungen zuzumuten und abzufordern, sollte sich in allen späteren Lebensphasen als hilfreich erweisen. Außerdem zeigte sich bereits damals ein ganz charakteristischer Zug seines Wesens: der Optimismus. Ein gewisses Grundvertrauen, das möglicherweise durch die erfüllte, harmonische Jugend, durch die enge Eltern-Kind-Beziehung – wobei die tüchtige, lebenskluge und warmherzige Mutter eine zentrale Rolle gespielt haben mag – bedingt war, ließ ihn trotz der strapaziösen, leidvollen Erfahrungen die Kriegsjahre nicht ausschließlich in düsteren Farben in Erinnerung behalten.11
Wie bei vielen Angehörigen seiner Generation veränderte der Krieg auch die weitere Lebensentwicklung von Ludwig Erhard, gab ihr eine gänzlich andere Wendung, auch wenn er zunächst von Umsturz, Revolution und dem eskalierenden Bürgerkrieg in Bayern, von den blutigen Kämpfen zwischen kommunistischer Räterepublik und Freikorps nur wenig mitbekam; er lag im Lazarett und blieb nach der Entlassung noch über Monate Rekonvaleszent. Selbst an ein Zupacken, ein Mithelfen im väterlichen Geschäft war überhaupt nicht zu denken.
Da in Nürnberg im Oktober 1919 eine neue Handelshochschule ihre Tore geöffnet hatte, beschloss er, dort als Gasthörer Kurse zu besuchen. Schon bald lernte er den Gründungsdirektor Wilhelm Rieger, einen Fachmann der Privatwirtschaftslehre, kennen. Diesen Kontakt bezeichnete Erhard später als »fast schicksalhaft entscheidenden Wendepunkt« in seinem Leben.12 Rieger kümmerte sich intensiv um den angehenden Studenten, empfahl ihm und den zögernden Eltern ein Vollstudium, ebnete später – Erhard hatte ja kein Abitur gemacht – sogar den Weg zur Immatrikulation an der Frankfurter Universität. Hochschule – das war eine andere, ferne, fremde Welt damals, eine entrückte Sphäre. Aber Rieger überwand die Bedenken der Familie, zog Ludwig Erhard in seinen Bann, weckte in ihm – nach dessen eigenen Worten – »die Liebe zur Wissenschaft«13, lehrte ihn »vor allem die Kunst, folgerichtig zu denken«.14
1922 bestand Ludwig Erhard sein Examen als Diplom-Kaufmann, übrigens gemeinsam mit einer vier Jahre älteren Kommilitonin, der Kriegswitwe Luise Schuster, geborene Lotter. Die Nachbarstochter und Spielgefährtin aus Fürther Jugendtagen war ihm bereits während des Studiums eine konzentrierte, aufmerksame Gesprächspartnerin bei der Diskussion wirtschaftswissenschaftlicher Fragestellungen gewesen – und mehr als das. Beide heirateten am 11. Dezember 1923. Da hatte sich Ludwig Erhard schon in Frankfurt am Main immatrikuliert, um seine Studien zu vertiefen und zu promovieren.
Es war eine dramatische Zeit. Die Hyperinflation erreichte gerade ihren Höhepunkt. Erst durch die Mitte Oktober 1923 erlassene Verordnung über die »Rentenmark«, durch die am 15. November begonnene Ausgabe der neuen Währung gelang es Reichskanzler Gustav Stresemann, zusammen mit dem damaligen Finanzminister Hans Luther und dem Reichswährungskommissar Hjalmar Schacht, den scheinbar unaufhaltsamen Währungsverfall zu stoppen. Und Ludwig Erhard verfolgte diese Entwicklung nicht allein deshalb besonders aufmerksam, weil sein Interesse an wirtschafts- und währungspolitischen Problemen geweckt worden war und stetig wuchs, nein, er erlebte die brutalen Auswirkungen der galoppierenden Inflation gewissermaßen am eigenen Leib: Das väterliche Geschäft stand, wie zahlreiche andere kleinere Unternehmen auch, vor dem Zusammenbruch. Die Rücklagen trotz immer neuer Kapitaleinlagen auch aus dem familiären Umfeld der Mutter aufgezehrt, die Warenlager zusammengeschmolzen, zugleich bedrängt von der Konkurrenz moderner Kaufhäuser mit deutlich größerem und zugleich preiswertem Sortiment in Fürth und Nürnberg, war es höchst zweifelhaft, ob es sich noch lange würde halten können.
Geburtshaus und Laden der Familie Erhard in Fürth um 1900 – heute Teil des Ludwig Erhard Zentrums.
Die Frage stellte sich immer dringlicher nach dieser ersten deutschen »Währungsreform« im 20. Jahrhundert, bei der das Reich sich auf einen Schlag all seiner seit 1914 aufgehäuften Schulden entledigte, die Besitzer von Sachwerten wie Aktien, Immobilien, Gold und Devisen – besonders Dollar oder Schweizer Franken – relativ ungeschoren davonkamen, hochverschuldete Spekulanten, die auf Kredit Sachwerte erworben hatten, begünstigt wurden und die vielen Zeichner von Kriegsanleihen, aber auch die kleinen Sparer und Rentner alles verloren. Tatsächlich musste der Familienbetrieb Anfang 1929, am Beginn der einsetzenden Weltwirtschaftskrise, nach langer Agonie aufgegeben werden – den Insolvenzantrag hat Ludwig Erhard selbst unterzeichnet, um seinem Vater diesen letzten Schritt zu ersparen, den dieser wohl als zutiefst ehrenrührig empfand.15 Auch das Geburtshaus in Fürth – das man seit Sommer 2018 als Teil des Ludwig Erhard Zentrums besichtigen kann – verlor die Familie darüber.
Die damaligen Eindrücke und Erfahrungen sind schwerlich folgenlos für Erhards wirtschaftspolitische Konzeption geblieben: Bei ihm – wie auch bei Konrad Adenauer, der diese Phase als Oberbürgermeister von Köln ebenfalls sehr bewusst miterlebt hatte – besaß später die Stabilität von Währung und Preisen nicht von ungefähr hohe Priorität, war beiden doch nur zu bewusst, wie stark die brutalen ökonomischen Verwerfungen der Zwanzigerjahre und die damit einhergehende Verarmung von Millionen dem Aufstieg Hitlers und damit der ersten deutschen Diktatur den Boden bereitet hatten.16
In Frankfurt beschäftigte sich Erhard allerdings nicht mehr ausschließlich mit Fragen der Ökonomie. Hier traf er auf einen weiteren Dozenten, der sich als Mentor seiner annahm, entscheidenden Einfluss auf ihn ausübte: Franz Oppenheimer, der erste Inhaber des Frankfurter Lehrstuhls für Soziologie und ökonomische Theorie. Ein interessanter, durchaus umstrittener Mann, der dem nicht-marxistischen Flügel der Sozialdemokratie nahestand. Oppenheimer, 1864 geboren, hatte als Arzt in seiner Berliner Praxis in der Eichendorffstraße nahe dem Stettiner Bahnhof die Schrecken der »großstädtischen Slums« mit ihrer hohen Säuglingssterblichkeit, den zahlreichen Tuberkulosekranken kennengelernt17, war dann Journalist geworden und schließlich so, auf dem »Weg eines Außenseiters«18, zur Nationalökonomie und Soziologie gekommen, wo er sich durch Monographien über Malthus, Marx und Ricardo einen Namen machte. Der Sohn eines Berliner Rabbiners muss ein glänzender Redner, ein vielseitiger und faszinierender Wissenschaftler gewesen sein. Wie andere große Gelehrte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, etwa sein Altersgenosse Max Weber oder der ein Jahr ältere Werner Sombart, strebte er nach einer »universalen Betrachtung des gesellschaftlichen Lebens«19, nach einer Überwindung der Grenzen zwischen den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen.
Oppenheimers Suche nach einem dritten Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus, nach etwas, das er »liberalen Sozialismus« nannte, die Ablehnung der Monopole im Wirtschaftssystem, das Lob der Konkurrenz, besonders aber seine Vorstellungen über das Verhältnis von Staat und Wirtschaft – der Wirtschaft wurde eine friedenstiftende, ausgleichende, harmonisierende Rolle zugeschrieben, der Staat als gewaltsamer Eroberer und Unterdrücker verstanden – beeindruckten Erhard so tief, dass er Teile davon seinen eigenen Konzeptionen zugrunde legte. Wenn er später, nach dem Zweiten Weltkrieg, gegen Kartelle kämpfte, den Abbau der Handelsschranken zwischen den einzelnen Staaten forderte, für ein geeintes Europa, ein »Europa der Freien und Gleichen« ohne Zölle und nationale Abschottungen votierte20, dann zeigt sich darin die Langzeitwirkung der Oppenheimer’schen Ideen. Allerdings drehte er, der den Sozialismus nach dem Zweiten Weltkrieg für eine verhängnisvolle Irrlehre hielt, ganz bewusst Oppenheimers Leitspruch um, stellte ihn gewissermaßen vom Kopf auf die Füße, wenn er von einem »Sozialen Liberalismus« sprach, den er zu verwirklichen trachte.21
Bleibend geprägt hat Oppenheimer das Menschenbild Erhards. Er machte ihn mit den Thesen von Jean-Jacques Rousseau bekannt und bestärkte ihn in der optimistischen Grundüberzeugung, der Mensch an sich sei im Wesenskern gut, nur durch äußere Umstände, durch den auf Gewalt gegründeten Staat könne er fehlgeleitet, zur Unterwerfung und Misshandlung anderer gebracht werden; ändere man jedoch die institutionellen Rahmenbedingungen, lasse sich letztlich ein Zustand der Ausgewogenheit und des Friedens erreichen.22 Ein in der Tat folgenreicher Einfluss. Der humanitäre und liberale Idealist Erhard mit seinen tiefen Skrupeln vor der Macht – hier formt und festigt er sich. Gewiss übernahm er dabei nicht alles, was der Kathedersozialist Oppenheimer »predigte«; dessen Lieblingsidee etwa, die Bevölkerung aus den Ballungszentren auf viele, möglichst autarke Kleinsiedlungen zu verteilen, um dadurch die Proletarisierung der Stadtbevölkerung ebenso wie den Großgrundbesitz – darin sah Oppenheimer zwei Hauptübel seiner Zeit – wirksam zu bekämpfen, taucht bei Erhard nicht mehr auf.23
Insgesamt sind aber nicht nur die Konzeptionen Oppenheimers für Erhard wichtig geworden. Dieser ungewöhnliche Lehrer begegnete seinen Studenten mit menschlicher Anteilnahme. Er wollte vertrauensvolle Zusammenarbeit, führte die Diskussion unter Gleichgestellten, ohne je nachtragend zu sein, dachte nicht in Hierarchien. Überhaupt entsprach er nicht dem Gelehrtentyp seiner Zeit. Er liebte Gesellschaft, war ein begeisterter Sportler, dazu ein leidenschaftlicher Bergsteiger mit einer Passion für das schweizerische Engadin, wo er – in Celerina – viele Monate zubrachte.24
Erhard fand in seinem Kreis die Anregungen, die er suchte, fand wohl auch die Vaterfigur, die er damals brauchte. »Ich war nicht nur Professor Oppenheimers Schüler, ich durfte auch sein Freund sein!«25, bemerkte er später über sein Verhältnis zu seinem Doktorvater. Die Dissertation, eine theoretische Arbeit über »Wesen und Inhalt der Werteinheit«, schloss Erhard 1925 ab; das Prüfungsgespräch mit Oppenheimer fand während einer Gebirgswanderung auf dem Höhenweg oberhalb von Pontresina statt. Am Ende, rund 3000 Meter über dem Meer, drückte der Professor seinem Doktoranden die Hand und erklärte voll Humor: »Ich verleihe Ihnen hiermit den höchsten akademischen Grad.«26 Erhard hatte die Einladung zu dieser Bergwanderung ohne Zögern akzeptiert, obwohl bei seiner Gehbehinderung ein solcher Marsch nicht unbeschwerlich sein konnte. Aber wenn Ludwig Erhard jemand verehrte, dann nahm er auf sich selbst wenig Rücksicht, war zu den größten Anstrengungen bereit.
Die Arbeit selbst war kein Meisterwerk akademischen Scharfsinns, wie beide Gutachter übereinstimmend feststellten. Doktorvater Oppenheimer fertigte sein Gutachten übrigens erst nach der Bergwanderung und nach mehrfacher Aufforderung durch die Universitätsverwaltung an. Es hatte Platz auf einer Postkarte an die Alma Mater in Frankfurt und lautete: »Die Dissertation des Ludwig Erhard über die Werteinheit hat der Unterzeichner angenommen, vorbehaltlich vereinbarter Änderungen und mit III zensiert. Im früher stattgefundenen mündlichen Examen über die theoretische Nationalökonomie im Hauptfach hat er mit II bestanden.« Der auch zu dieser Zeit schon vorgeschriebene Zweitgutachter Prof. Fritz Schmidt, neben Eugen Schmalenbach, Heinrich Nicklisch und Wilhelm Rieger einer der bedeutendsten Betriebswirtschaftler jener Zeit, hatte ähnlich kurz geurteilt, zugleich damals schon Erhards bisweilen leicht genialische Arbeitsweise moniert und ihn zu Nachbesserungen verdonnert: »Die Arbeit zeugt von kritischem Denken und ist flüssig geschrieben. Das Positum scheint mir nicht geführt. Der Verf. operiert mit einer Arbeitswerttheorie, die nicht genügend scharf begründet ist. Quellenangaben sind sehr nachlässig im Text verstreut. Die Quellenangaben sind nachzuführen. Unter der Auflage für hinreichend: Note III. Schmidt.«27
Die Verbindung zu seinem Doktorvater pflegte Erhard auch nach der Promotion, hielt zu ihm auch im Dritten Reich Kontakt, als der freundschaftliche Umgang mit jüdischen Deutschen längst schon sozial geächtet war, bis Oppenheimer sich 1938 schließlich doch noch zur Emigration in die USA entschloss. Beinahe wäre es zu spät gewesen – und Oppenheimer wäre verhaftet worden. Er unterschätzte lange die Bedrohung und war sogar nach dem ersten USA-Aufenthalt im Sommer 1936 wieder in Hitlers Reich zurückgekehrt, um seine reguläre Pension zu beziehen – er war damals bereits 72 Jahre alt –, die ihm nicht nach Amerika weitergeleitet werden durfte. Ab Januar 1937 wohnte er tatsächlich in der der Nassauischen Straße 9–10 in Berlin. Seine Tochter Renata hat in ihrem umfangreichen, in den USA verfassten Manuskript mit dem Titel One who got away von der dramatischen Phase berichtet, die begann, nachdem im April 1938 der Pass ihres Vaters von der Gestapo eingezogen worden war: »Jetzt endlich realisierte mein Vater, dass es Zeit war, das Land zu verlassen. Beinahe zu spät. Es war schon gefährlich geworden (für beide Parteien), irgendeinen sozialen Austausch mit ›Ariern‹ zu haben. Ludwig Erhard, ein Student meines Vaters und Kanzler in Westdeutschland nach dem Krieg, schaute vorbei, um Abschied zu nehmen – die Gestapo war Vater bereits auf den Fersen …«28
Ludwig Erhards jüdischer Doktorvater Franz Oppenheimer mit seiner Tochter Renata kurz vor der Flucht aus Deutschland 1937/38.
Weniger den energischen Warnungen Erhards als dem Mut seiner Tochter hatte es der Vater zu verdanken, dass er trotz der nach der Reichspogromnacht wieder massiv angestiegenen antisemitischen Welle und der Verhaftung von über 30 000 jüdischen Deutschen im Dezember 1938 seinen Pass tatsächlich zurückerhielt, wenn auch versehen mit den nunmehr vorgeschriebenen rassenantisemitischen Merkmalen, den Zwangsvornamen »Israel« – bzw. bei Frauen »Sarah« – und dem eingestempelten großen roten »J«. Sie insistierte unermüdlich und unerschrocken bei der Gestapo in der Prinz-Albrecht-Straße, ihren Status als Halbjüdin und ihr Aussehen – blond und blauäugig wie auf einem BDM-Plakat – instrumentalisierend. Sie besorgte auch Visa und Ausreisebewilligungen, wobei der Vater seine Pensionsansprüche opfern musste als Äquivalent für die obligatorische Reichsfluchtsteuer. Am 24. Dezember 1938 ging er zusammen mit seiner Tochter in Marseille an Bord der Félix Roussel, um in die USA zu flüchten, wo schon seine Schwester Lisel lebte. Weil das Visum für die Tochter nicht eintraf, erreichten sie erst nach längeren Zwangsaufenthalten in Singapur und Japan anderthalb Jahre später, am 12. August 1940, den Hafen von San Francisco. Franz Oppenheimer sollte »his beloved Germany« nie wiedersehen, denn er starb 1943 in Los Angeles. Als Bundeskanzler hat Ludwig Erhard die Familie gebeten und ermutigt, wieder nach Deutschland zu kommen.
Er selbst kehrte nach dem Abschluss seines Studiums von Frankfurt am Main nach Fürth zurück. Als der Konkurs des väterlichen Geschäfts nicht mehr aufzuhalten war, bewarb er sich, als junger Familienvater auf ein geregeltes Einkommen angewiesen, Ende 1928 bei Wilhelm Vershofen, einem weiteren Professor an der Handelshochschule Nürnberg, der zugleich ein kleines »Institut für Wirtschaftsbeobachtung der deutschen Fertigware« – heute würde man sagen: für Markt- und Konsumforschung – leitete. Zunächst ging es lediglich um eine Halbtagsstelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Erhard, der bereits bei Oppenheimer mit der Kapitalismusforschung der Zwanzigerjahre, mit den Ideen und Modellen von Emil Lederer, Georg Gothein und Joseph Alois Schumpeter in Berührung gekommen war29, wurde zum 1. Oktober 1929 eingestellt – in jenem Monat, als mit dem Börsencrash in New York die Weltwirtschaftskrise fatale Fahrt aufnahm. Bei Vershofen lernte er nun die subtilen Methoden der Marktforschung kennen und erlebte die Übertragung amerikanischer Befragungspraktiken auf deutsche Verhältnisse aus nächster Nähe mit.
Vershofen ist damit zugleich der letzte in der Triade akademischer Lehrer, die Erhard menschlich wie wissenschaftlich stark beeinflussten, vielleicht der persönlich »vielseitigste«.30 Er hatte Germanistik, Philosophie, Naturwissenschaften und Nationalökonomie studiert, war als Spitzenkandidat der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) 1919 in die Nationalversammlung eingezogen, an der Ausarbeitung der Weimarer Verfassung beteiligt gewesen und seit 1921 als Dozent an der Handelshochschule in Nürnberg tätig.31 Zugleich schrieb er Romane. Nach der Machtübertragung und Machtergreifung Hitlers stand er als Personifizierung der nunmehr verhassten Weimarer »Systemzeit« zunächst unter Rechtfertigungsdruck und verschärfter Beobachtung, trat aber selbst nie in die NSDAP ein.
Wie schon zu Rieger und Oppenheimer entwickelte Erhard auch zu ihm rasch eine freundschaftliche Vater-Sohn-Beziehung; überzeugte durch sein Engagement, stieg rasch auf, wurde zwei Jahre später zum 1. Assistenten befördert und bereits im Oktober 1933 Mitglied der geschäftsführenden Leitung des Instituts. Zusammen mit Vershofen und Erich Schäfer gründete Erhard wenig später im Februar 1935 in Berlin die »Gesellschaft für Konsumforschung« (GfK). Bereits ein Jahr später verfügte sie über 300 ehrenamtliche »Korrespondenten«, die im Auftrag der Gesellschaft die in Nürnberg formulierten Fragebögen in bis zu 15 000 Haushalten abarbeiteten und so Informationen über die deutschen Verbraucher sammelten; in den folgenden Jahren wuchs das Korrespondentennetz immer weiter. Bereits in der Zeit zuvor, als allenthalben nach einem Ausweg aus der Weltwirtschaftskrise und der tiefen Depression gesucht worden war, hatte sich Erhard dezidiert in Leopold Schwarzschilds renommierter Berliner Zeitschrift Das Tage-Buch32 zu den großen ökonomischen Themen und Problemzusammenhängen jener Zeit geäußert, dabei 1932 in einem Artikel die von dem ins Lager der Nationalsozialisten übergewechselten ehemaligen Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht formulierten »Grundsätze deutscher Wirtschaftspolitik« scharf kritisiert und damit in Fachkreisen Aufsehen erregt.33
Das Projekt einer Habilitation betrieb er aber allenfalls halbherzig, auch wenn er ab 1935 absatzwirtschaftliche Kurse des Instituts organisierte und von 1935 bis 1940 Lehraufträge für Marktordnung und Verbandswesen & Verbandspolitik an der Nürnberger Handelshochschule gab. In dieser Zeit hoffte er wohl auf eine Honorarprofessur, doch dazu kam es nicht, denn der Rektor der Hochschule in Nürnberg, Georg von Ebert, hielt ebenso wenig von der Idee wie das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Seine Lehrveranstaltungen, zu denen ihn vor allem sein akademischer Lehrer Vershofen gedrängt hatte – der ihm in einem wohlwollenden Gutachten Anfang 1939 die Befähigung zum außerordentlichen Professor bescheinigte –, fielen zudem wegen seiner vielen Reisen häufig aus.
Was die förmliche Habilitationsschrift anging, blieb es bei Entwürfen und Stückwerk. Das bis heute unveröffentlichte, rund 140 Seiten umfassende Manuskript über »Die Überwindung der Wirtschaftskrise durch wirtschaftspolitische Beeinflussung« – eigentlich sein Lebensthema – hat er nie als Habilitationsschrift eingereicht, vermutlich weniger, weil er nicht in den NS-Hochschuldozentenbund eintreten wollte, wie er nach dem Krieg erklärte, sondern weil er mit Substanz und Stringenz selbst nicht zufrieden war – oder aber Vershofen, der ihn in dem Verfahren begleiten musste. Und für eine kumulative Habilitation reichte die Zahl und Breite seiner Aufsätze nicht aus. Dass die Berufung zum Professor im Dritten Reich allein an seiner fehlenden Mitgliedschaft in einer nationalsozialistischen Parteiorganisation – zu der etwa der NS-Dozentenbund gehörte – gescheitert sein soll, gehört daher ins Reich der Legenden und Selbststilisierungen, die Ludwig Erhard besonders in der unmittelbaren Nachkriegszeit 1945/46 durchaus karrierefördernd einzusetzen wusste. Er war schlichtweg stärker an konkreten, praktischen Wirtschaftsfragen orientiert und dabei vor allem an der Frage, wie sich die ökonomische Lage der breiten Massen verbessern ließ. Umfassende wirtschaftstheoretische Abhandlungen waren seine Sache nicht und sind deshalb auch aus späteren Phasen nicht von ihm überliefert. Das Manuskript für einen 200-Seiten-Band zum Thema »Konsumforschung und Konsumlenkung« lieferte er nie ab, obwohl er 1938 einen entsprechenden Vertrag mit dem Felix Meiner Verlag in Leipzig abgeschlossen hatte.34
Seine Distanz gegenüber der NSDAP war allerdings keine bloße Behauptung. Die braune Ideologie, der brutale, pseudo-biologistisch begründete Rassenantisemitismus und die Lockungen der NS-Volksgemeinschaft – die für alle, die wie Kommunisten, Sozialdemokraten, Juden, psychisch Kranke bzw. geistig Behinderte, Roma oder Homosexuelle aus rassischen, sozialen oder politischen Gründen immer unerbittlicher ausgegrenzt und verfolgt wurden, ohnehin nur Schrecken bereithielt – blieben ihm durchweg zutiefst fremd. Auch den immer weiter ausgreifenden staatlichen Eingriffen bei gleichzeitig staatlich befohlener preisgestoppter Inflation stand er zunehmend skeptisch gegenüber. In den Friedensjahren von Hitlers Herrschaft erwies sich dabei das Nürnberger Institut für ihn aber wohl als eine jener »Nischen« in der Diktatur, wo man arbeiten und existieren konnte, ohne allzu sehr von den neuen Machthabern bedrängt und bedroht zu werden.35 Dabei mag eine Rolle gespielt haben, dass das NS-Regime wegen seiner massiven Aufrüstungspolitik der Fertigwaren- und Konsumgüterindustrie, die ja im Mittelpunkt des Interesses von Erhard und seinem Institut standen, wesentlich weniger Interesse und Aufmerksamkeit schenkte als der Grundstoff- und Schwerindustrie. Erhard meinte rückblickend auf die zweite Hälfte der Dreißigerjahre: »Von der Wertung menschlichen Glücks aus waren diese Tage, trotz der sich immer mehr ausbreitenden Schatten des Naziregimes, vielleicht die erfülltesten meines Lebens, weil in mir die äußeren und inneren Maße harmonisch aufeinander abgestimmt waren.«36
Vershofen hat diesen Eindruck bestätigt. Er schilderte Erhard nach dem Krieg als »wundervoll geselligen« Menschen und nannte ihn zugleich – im Hinblick auf spätere Vorwürfe und vor allem das tiefe Zerwürfnis 1942 etwas überraschend – »ein geniales Organisationstalent«.37 Dabei mag eine Rolle gespielt haben, dass der 1937 zum Geschäftsführer und stellvertretenden Institutsleiter beförderte Erhard sich rasch als ausgemacht geschickter Akquisiteur von Aufträgen erwies und großen Anteil am Aufstieg des Instituts hatte. Als Erhard seine neue Assistentenstelle antrat, war das Institut der Nürnberger Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften angeschlossen (ab Mai 1933 »Hindenburg-Hochschule«) und wurde über deren Etat finanziert. Dazu kam ein kleiner Zuschuss von 6000 Reichsmark vonseiten eines Industrieverbands – pro Jahr. Als dieser während der ökonomischen Krise 1931/32 auf 1500 Reichsmark gekürzt wurde, stand es vor dem Aus wie kurz zuvor das väterliche Geschäft. Der Leiter Vershofen verschickte bereits Kündigungen, weil er zunächst keine Möglichkeit mehr sah, das von ihm damals noch primär wissenschaftstheoretisch ausgerichtete Institut weiterzuführen. Es war wohl tatsächlich Ludwig Erhard, der den Institutszug auf ein neues, stärker praxisorientiertes Gleis setzte und dadurch eine Fülle neuer Aufträge für Untersuchungen und Gutachten an Land zog. Diese wurden so ordentlich honoriert, dass Mitte der Dreißigerjahre zwischen sechzig und achtzig Mitarbeiter für das Institut und die GfK arbeiteten – und bezahlt werden konnten.
Die ungewöhnliche Expansion war nur möglich geworden, weil neben der engen Kooperation mit der Fertigwarenindustrie und den – nur partiell realisierten – ständischen Wirtschaftsorganisationen zunehmend auch Reichsbehörden wie das Wirtschaftsministerium die Dienste des Instituts in Anspruch zu nehmen begannen. Hierbei waren insbesondere die vielfältigen Verbindungen und Kontakte Ludwig Erhards von erheblichem Nutzen. Nach dem Wechsel des Ersten Stellvertreters Erich Schäfer 1937 auf eine Professur an der Handelshochschule Leipzig trat Ludwig Erhard interimistisch an dessen Stelle und übernahm auch die Schriftleitung bei der Institutszeitschrift Die Deutsche Fertigware. Der mit Erhards umtriebigem Wirken einhergehende Bedeutungszuwachs des Instituts, das sich zunehmend zu einer renommierten Mittlerstelle zwischen privatwirtschaftlichen Interessen und den Instanzen der NS-Staatswirtschaft entwickelte, führte 1938 zur Einführung einer neuen Stiftungsordnung, bei der die Stadt formal zum Verwalter der Stiftung und zur direkten Aufsichts- und Kontrollinstanz wurde. Damit war eine deutliche Erhöhung des jährlichen Zuschusses aus der Stadtkasse verbunden, der zukünftig etwa die Hälfte des Institutsetats ausmachte; bis 1942 im Schnitt etwa 85 000 Reichsmark38, was das mittlerweile deutlich gewachsene städtische Interesse an dieser Einrichtung dokumentierte.
Ludwig Erhard stieg im Zuge dieser Umwandlung per 1. September 1938 nun auch offiziell und mit Zustimmung der städtischen Gremien zum 1. Stellvertreter Vershofens auf und wurde de facto Geschäftsführer des Instituts. Auf seine Ernennung und den wohlwollenden Brief Vershofens, der mit ihr einherging, reagierte Erhard so überschwänglich wie später in der Anfangsphase der Partnerschaft mit Konrad Adenauer auf die Gunstbeweise des Alten Herrn aus Rhöndorf. An Vershofen schrieb er jedenfalls Mitte September: »Lieber Herr Professor! Ihr Schreiben vom 10. hat mich von Herzen gefreut. Ich weiß nun wirklich nichts Besseres, als mit Ihnen an einer Sache und an einem Werk arbeiten zu dürfen, das ich immer – was ich auch selbst zum Gelingen beigetragen haben könnte – als das Ihre behandelt habe und behandeln werde. Nunmehr bin ich stolz, mich – im wahrsten Sinne des Wortes – Ihr Stellvertreter nennen zu dürfen. Als solcher bin ich nicht nur immer bereit, mit Ihnen solidarisch zu handeln, sondern mich auch Ihnen freudig unterzuordnen. Was ich zu meiner Arbeit allein brauche, das ist Ihr Vertrauen und Ihre Anerkennung und weil das aus Ihrem Briefe spricht – darum war ich sehr glücklich. Ich werde sie nie enttäuschen! Stets Ihr Ludwig Erhard.«39
Diese mehr als euphorische Stellungnahme kennzeichnet das Innenverhältnis der beiden in den ersten zehn Jahren ihres gemeinsamen Wirkens sehr gut. Erhard war – wie dann auch bei Konrad Adenauer, der ihn fast zwanzig Jahre später, wenn auch nach langem Zögern, 1957 ebenfalls zu seinem Stellvertreter ernannte – nur zu gerne dazu bereit, als zweiter Mann dem Chef zuzuarbeiten. Hier wie dort genügten wenige warmherzige und anerkennende Worte, um ihn mit Euphorie zu erfüllen. Dann machte er aus seinem Herzen keine Mördergrube und dankte voll emotionalem Überschwang mit enthusiastischen Treueschwürden.
Wenn man Erhard allerdings nicht lange kannte, nicht mit seinem Wesen vertraut war, konnte man bezüglich seines Auftretens auch zu gänzlich anderen Schlüssen gelangen. Theodor Eschenburg fand nach der ersten längeren Begegnung 1936 jedenfalls, ein Gespräch mit ihm komme »nur schwer zustande«, er gebe sich »wortkarg«, sei »vielleicht auch kontaktarm«.40 Nun waren die Zeiten damals natürlich nicht so, dass man sich jedem mehr oder weniger Unbekannten auf Anhieb vertrauensvoll zuwenden konnte. Allerdings hatte den Kontakt zwischen Erhard und Eschenburg der nach Istanbul emigrierte und beiden gleichermaßen nahestehende Professor Alexander Rüstow vermittelt – das hätte eine etwas intensivere Unterhaltung eigentlich ermöglichen können.
Tatsächlich fasste Erhard dann aber doch rasch Vertrauen zu Eschenburg, einem früheren Mitarbeiter Gustav Stresemanns und damaligen Syndikus der Knopfindustrie, und lud ihn ebenso wie Elly Heuss-Knapp oder Carl Friedrich Goerdeler, den ehemaligen Reichskommissar für Preisüberwachung und von den Nazis 1937 abgesetzten Oberbürgermeister von Leipzig, zu Vorträgen in den von ihm organisierten Kursen ein. Er schuf sich so ein kleines Netzwerk, dessen Mitglieder sämtlich eine innere Distanz gegenüber dem braunen Regime verband, auch wenn beispielsweise Eschenburg 1933/34 kurzzeitig Mitglied der SS geworden war – »aus Opportunismus«, wie er in seinen Erinnerungen kurz vor seinem Tod 1999 eingestand. Bei Erhard referierte er im Juni 1938 im vierten Kurs für Absatzwirtschaft über »Werbeformen der gebundenen Wirtschaft«.41
In dieser Zeit wurden die Kontakte des Instituts und damit auch von Erhard zum NS-Staat enger. Weil in der ohnehin immer stärker dirigistischstaatsinterventionistisch ausgerichteten NS-Wirtschaft die Privatindustrie als Auftraggeber zunehmend ausfiel, mussten ab jetzt vermehrt Staatsaufträge requiriert werden, um das Überleben des Instituts zu sichern – und damit zugleich die »uk-Stellung« (»uk« steht für »unabkömmlich«) möglichst vieler Mitarbeiter, die vor einer Einberufung schützte. Mit Kriegsbeginn hatte sich wegen der Welle von Einberufungen tatsächlich abermals die Frage einer Schließung gestellt. Erhard war es aber rasch gelungen, eine Reihe »kriegswirtschaftlich wichtiger Aufträge« einzuholen und damit den Fortbestand zu sichern. Nachdem noch ein Großauftrag der Wirtschaftsgruppe Keramische Industrie hatte an Land gezogen werden können, der eine Denkschrift über die Lage der gesamten keramischen Industrie vorsah, teilte Erhard am 4. Dezember 1939 Vershofen mit: »Im ganzen sind jetzt jedenfalls so viele Aufträge im Haus, daß wir uns den Kopf zerbrechen müssen, wo wir die Arbeitskräfte zu ihrer Erledigung hernehmen sollen.«42
Als ein besonders wichtiger Auftraggeber erwies sich dabei Gauleiter Josef Bürckel, den Erhard Ende 1938 in Wien kennenlernte, wo er erstmals einen Kurs über »Aspekte der Konsumforschung« außerhalb Nürnbergs organisierte und selbst über »Absatzprobleme der österreichischen Wirtschaft – Mittel und Wege zu ihrer Lösung« referierte. Außerdem sondierte er in enger Abstimmung mit Vershofen und der GfK, ob man nicht in Wien mit dem Institut für Verbrauchs- und Absatzforschung (ab 1942 dann als eingetragener Verein geführt) eine Dependance des Nürnberger Instituts errichten könne. Bürckel fand die stark praxisorientierte Arbeitsweise von Erhard und seinem Institut ganz offensichtlich interessant. Er war 1895 geboren und damit gerade einmal zwei Jahre älter als der Nürnberger Institutsmanager, bereits 1921 unter der Mitgliedsnummer 33.979 in die NSDAP eingetreten, mithin ein »Alter Kämpfer« der ersten Stunde, der ab 1933 rasch Karriere machte. Zwischen 1935 und 1936 war er als Reichskommissar für die Rückgliederung des Saargebiets im Einsatz, diese Position entsprach der eines Reichsstatthalters, also dem von Hitler als Chef der Zivilverwaltung eingesetzten Beauftragten der Reichszentrale auf der Ebene der Reichsgaue mit beträchtlichen Überwachungs-, Eingriffs- und Leitungsfunktionen. Die Stellung war in etwa der eines Landeschefs oder Ministerpräsidenten vergleichbar. 1936 wurde Bürckel zum SA-Obergruppenführer, ein Jahr später zum SS-Gruppenführer – also zweimal in den Generalsrang – befördert. Ab März 1938 war er als Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Reich damit betraut, binnen Jahresfrist die politische und wirtschaftliche Eingliederung der »Ostmark« zu bewerkstelligen. Dabei erwies er sich als fähiger, zugleich vielfach pragmatischer Organisator, war aber gleichzeitig entschiedener Verfechter einer systematischen und rücksichtslosen Politik der Verfolgung und Ausgrenzung gegenüber den österreichischen Juden, der etwa im Herbst 1938 Adolf Eichmann beim Aufbau seiner Zentralstelle für jüdische Auswanderung, jenem »Fließband« zur rascheren Austreibung bei gleichzeitig fast vollständiger Ausplünderung, entschieden unterstützte.
Dieser Josef Bürckel zog 1939 schon bald neben dem Institut für Konjunkturforschung und dem Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit (für betriebswirtschaftliche Erhebungen) auch das Nürnberger Institut (für marktpolitische Erhebungen) hinzu. Das Eintrittsticket für Erhard war wohl die von ihm geleitete und Ende 1938 abgeschlossene GfK-Untersuchung über »Tabakverbrauch im Reich und im ehemaligen Österreich« gewesen. Das zügig dort aufgebaute Korrespondentennetz der GfK kam noch hinzu. Schon bald nach ihrer ersten Begegnung fungierte Ludwig Erhard als Verbindungsmann, Ansprechpartner und Berater zur Belebung und Leistungssteigerung der österreichischen Wirtschaft, ab 1940 dann auch für das Saarland und Lothringen. Dabei ging es nicht zuletzt um die Frage, wie die Produktion von Konsumgütern und damit auch der Konsum rasch wieder angekurbelt werden könnte und wie man zugleich verhinderte, dass alles ausschließlich dem Primat der Kriegsgüterproduktion untergeordnet würde – was Bürckel im Krieg auf all seinen Posten wichtig sein sollte.
Hätte Erhard diesen Kontakt meiden, die Beraterrolle zurückweisen sollen? Das wäre in einer offenen Gesellschaft möglich gewesen, in einer Diktatur dagegen schwerlich. Hinzu kam, dass mit den staatlich finanzierten Aufträgen sich das Institut weiter würde halten können – und dass Bürckel wohl Erhard tatsächlich sympathisch und originell fand und fördern wollte. Beide hatten pädagogische Seiten, Bürckel war ausgebildeter Volksschullehrer, Erhard Dozent an der Nürnberger Handelshochschule. Und – weitaus wichtiger – beide hatten gemeinsam militärische Berührungspunkte in der Feldartillerie: Bürckel hatte als Freiwilliger im 20., Erhard im 22. Königlich bayerischen Feldartillerie-Regiment gedient. Auf jeden Fall war Bürckel kein tumber NS-Parteibonze, sonst hätte er sich schwerlich Erhard als Berater ausgesucht, dem es, anders als vielen anderen damals, überhaupt nicht lag, Parteiparolen zur eigenen Absicherung nachzuplappern.
Entscheidend für die weitere Zusammenarbeit wurde wohl, was intern im Nürnberger Institut »Ostmark-Blitz-Studie« genannt werden sollte. Bürckel war von Göring als Chef der Vierjahresplanbehörde im Frühjahr 1940 aufgefordert worden, ihm binnen zwei Wochen – das war auch in einer auf Befehl und Gehorsam basierenden Diktatur eine extrem kurze Zeitspanne – einen umfassenden Bericht über die Wirtschaftsverfassung der Ostmark und speziell die Lage der Verbrauchsgüterindustrie zwei Jahre nach dem »Anschluss« zu übermitteln. Bürckel wird darüber ziemlich ins Schwitzen gekommen sein – und fragte bei Erhard und dem Nürnberger Institut nach, ob man trotz der überaus knappen Frist in der Lage sei, derlei zu »liefern«. Zu Bürckels Überraschung war man dazu in der Lage, denn man verfügte dort bereits über die erforderliche breite Datenbasis, und Erhard konnte auch nahezu das gesamte Institutsteam für zwei Wochen allein mit dieser einen Aufgabe betrauen. Jedenfalls war Bürckel von der sogenannten »Ostmark-Blitz-Studie« und ihrer rasanten Entstehung überaus angetan, wie er in seinem Brief vom 18. April 1940 an Ludwig Erhard zum Ausdruck bringt:
»Das Institut für Wirtschaftsbeobachtung hat unter Ihrer Leitung in einem Zeitraum von 14 Tagen einen Bericht erstellt über die ostmärkische Verbrauchsgüterindustrie. Dieser Bericht ist von mir benötigt worden als Unterlage für eine Denkschrift, die dem Generalfeldmarschall vorgelegt wurde. Ich bestätige Ihnen, daß ich über die bei Erstellung des Lageberichts geleistete hervorragende Arbeit Ihres Instituts und die vorzüglichen Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter nur mein uneingeschränktes Lob aussprechen kann. Der Bericht ist trotz der Kürze der Zeit derart umfassend und qualitativ bestechend, daß ich tatsächlich über diese Leistung mehr als erstaunt bin. Wenn ich bei Erteilung des Auftrags der Auffassung war, daß Ihnen in der Kürze der Zeit diese Arbeit nicht voll gelingen wird, so bestätige ich Ihnen heute gerne, daß Sie mich in dieser Hinsicht in angenehmster Weise überrascht haben. Ich versichere Ihnen, daß ich auch in Zukunft gerne wieder an Ihr Institut herantreten werde.«43
Mit diesem Gutachten beginnt eine mehrjährige Zusammenarbeit. Erhard und sein Institut hatten Bürckel allem Anschein nach mit einer Fülle substantieller Informationen zur wirtschaftlichen Entwicklung in Österreich nach dem »Anschluss« aus der Bredouille geholfen, nachdem Hermann Göring als Chef der Vierjahresplanbehörde eine solche Bestandsaufnahme sehr kurzfristig angefordert hatte. Bürckel war höchst überrascht und erfreut über die ökonomische Fachkompetenz und Leistungskraft im Nürnberger Institut.