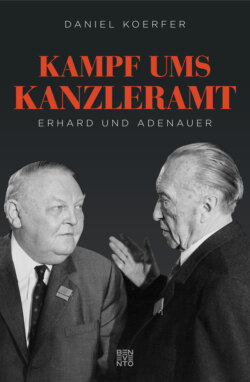Читать книгу Kampf ums Kanzleramt - Daniel Koerfer - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EINE AMERIKANISCHE ENTDECKUNG
ОглавлениеIm Frühjahr 1945 gingen der große Krieg und das große Morden endlich zu Ende. Ganz entscheidend war für jeden der besiegten Deutschen, wo er das Kriegsende erlebte und ob er in die Einflusszone der Westalliierten oder der Roten Armee geriet. Im Westen erwartete die Mehrheit eine vergleichsweise milde Niederlage trotz aller brutaler Härten, Entbehrungen, Hunger und unsicheren Zukunftsaussichten in den ersten Jahren. Im Osten brachen nicht zuletzt für viele Frauen noch schreckliche Wochen an, und es zog bald eine neue Diktatur herauf – Konzentrationslager wurden in Speziallager umgewandelt, in denen Zehntausende verschwanden. Hier hielt sich die Freude über das Ende der Kampfhandlungen nicht lange, mündete die Niederlage doch erstaunlich schnell in eine über vier Jahrzehnte andauernde neuerliche Diktatur mit massiv eingeschränkten Lebenschancen, minimierten Freiheits- und Entfaltungsmöglichkeiten für die allermeisten. Zugleich ging dieser Krieg, in dem der nationalsozialistische Rassen- und Größenwahn Verwüstungen über ganz Europa gebracht hatte und der erst in seinen letzten Monaten mit aller Wucht auf das Reichsgebiet zurückgeschlagen war, in Etappen zu Ende. Während im Osten, wo die deutschen Einheiten und die SS besonders gewütet hatten, Hunderttausende von Flüchtlingen und Vertriebenen schon seit Wochen nach Westen strömten, hatte im Norden die Rote Armee mit mehr als zwei Millionen Mann zum Sturm auf die Reichshauptstadt Berlin angesetzt. Als die kurze, aber blutige Schlacht um die Seelower Höhen tobte, wurden in einer Kleinstadt in Bayern bereits die weißen Fahnen gehisst, die Hakenkreuzfahnen waren dort schon vorher verschwunden.
An diesem 17. April rückten die amerikanischen Truppen auf Fürth vor. Zwei Tage darauf, am 19. April, unterzeichnete der kommissarische Oberbürgermeister Dr. Karl Häupler die kleine Kapitulationsurkunde. In den frühen Morgenstunden hatten die Truppen der US Army die Rednitz überquert – obwohl noch kurz zuvor die Brücke über sie gesprengt worden war – und waren Richtung Königstraße ins Zentrum vorgerückt, ohne noch auf nennenswerten Widerstand zu treffen. Zur Mittagsstunde wehte das Sternenbanner über dem Rathaus. Drei Tage später traf der neue Stadtkommandant in Fürth ein: Captain John Daly Cofer, ein Texaner wie aus dem Bilderbuch, Sohn eines Senators und versierter Jurist, der sich 1942 zur Army gemeldet hatte und in England auf seine Aufgabe vorbereitet worden war, als Offizier in der Militärregierung in Deutschland eingesetzt zu werden. Sein Detachment B-229 war klein, weil Fürth eine kleine Stadt und ein Nebenkriegsschauplatz war. Es bestand neben ihm nur noch aus zwei Unteroffizieren und sechs einfachen Soldaten, die sogleich am Rathaus das Schild »Military Government« anbrachten. Brauchte er Verstärkung, musste er sich an den Kommandeur der US-Truppen in den Nürnberger Kasernen wenden.
Es gab in Fürth auch keine große Siegesparade, wie sie General John W. »Iron Mike« O’Daniel, der Kommandeur der 3. und 45. US-Infanteriedivision für die Abendstunden am 20. April – dem letzten »Führergeburtstag«– im benachbarten Nürnberg anordnen würde. Etwa achtzehn Stunden zuvor hatte sich dort SA-Obergruppenführer Willy Liebel, der langjährige Oberbürgermeister und Ludwig Erhards Kontrolleur, im Raum des Gauleiters Karl Holz im Palmenhofbunker das Leben genommen; oder er war aufgrund seiner Bereitschaft zur Übergabe der Stadt von diesem erschossen worden – was zutraf, konnte später nicht mehr zweifelsfrei geklärt werden, denn Holz selbst fiel noch am selben Tage bei den Kämpfen um das Nürnberger Polizeipräsidium. Ohne Zweifel war jedoch Captain Cofer ab sofort die Schlüsselfigur in Fürth, ein kleiner König, der auch als »Judge«, als Richter amtierte und dabei rasch den Ruf eines ruhigen, korrekten und mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn ausgestatteten Mannes erwarb, der den Deutschen überwiegend – und darin durchaus nicht typisch für die Stadtkommandanten der ersten Phase – mit Wohlwollen begegnete. Weil er die kleine Stadt rasch wieder ertüchtigen und die Verwaltung schnell in Gang setzen wollte, beließ er zunächst auch manch nationalsozialistisch belasteten Beamten auf seinem Posten und entfernte nicht automatisch alle Parteigenossen. Das trug ihm später manche Kritik und sogar ein Verfahren ein, aus dem er aber gänzlich unbeschadet hervorging.
Erhards »amerikanische Entdecker« – am 19. April 1945 rücken die US-Soldaten, beobachtet von Fürtherinnen und Fürthern, durch die Gustavstraße zum Rathaus vor.
Allerdings tat er auch, was fast alle Stadtkommandanten in Ost und West damals taten – er ließ sich bei den Stellenbesetzungen von deutschen NS-Gegnern beraten. Dabei muss ihm auch der Name eines Mannes genannt worden sein, den er so interessant fand, dass er unverzüglich einen Jeep nach ihm schickte, um ihn aus seiner Wohnung in der Forsthausstraße 49 zu holen – nicht von ungefähr steht deshalb im Neubau des Ludwig Erhard Zentrums in Fürth am Beginn der Ausstellung ein solch amerikanischer Jeep. Die Soldaten klingelten an der Türe und versetzten dabei der Tochter einen gehörigen Schrecken. Sie dachte wohl, der Vater solle verhaftet werden. Aber das an ihn gerichtete »Mitkommen« war von einem Lächeln begleitet, also hatte Ludwig Erhard keine Furcht. Der amerikanische Jeep fuhr ihn zur ersten Begegnung mit Captain Cofer – und fuhr ihn zugleich mitten hinein in die deutsche, ja in die Weltpolitik. Nur wusste das damals noch keiner. Wäre es ein britischer Jeep in Göttingen, ein französischer Jeep in Kressbronn oder ein sowjetischer in Greifswald gewesen, die erstaunliche Karriere Ludwig Erhards wäre hier wohl schon zu Ende. Denn das, was jetzt begann, seine politische Karriere, sie war über Wochen, Monate und Jahre hinweg nur möglich in enger Begleitung durch die amerikanische Besatzungsmacht. Dass er als Politiker samt seiner Karriere eigentlich eine amerikanische Entdeckung sei, hat Erhard später ja auch oft behauptet – und das hatte einen wahren Kern.1
An ihrem Beginn stand unzweifelhaft Captain Cofer. Er übertrug dem fast gleichaltrigen Ludwig Erhard sogleich eine Aufgabe, die ihm schon im Dritten Reich von der Haupttreuhandstelle Ost oder von Josef Bürckel übertragen worden war, wenn auch für deutlich größere Territorien. Er sollte das verbliebene Wirtschaftspotential von Fürth erfassen und Maßnahmen zu dessen Aktivierung vorschlagen – innerhalb von vier Wochen. Dass Fürth wegen seines hohen jüdischen Bevölkerungsanteils von etwa einem Drittel nicht bombardiert worden wäre, trifft nicht zu. Es gab fünfzehn Bombenangriffe auf die Stadt, die oft, wie am 21. Februar 1945, als 1198 Bomber ihre Sprengsätze abwarfen, auch gleichzeitig der Nachbarstadt Nürnberg als der Stadt der Reichsparteitage galten. Noch bis in die letzten Kriegstage hinein fielen Bomben auf die Kleeblattstadt – die aber dennoch insgesamt Glück gehabt hatte im Vergleich zu manch anderen Städten im Reich.
Luftaufnahme einer Trümmerwüste: Köln als kriegswichtiger Verkehrs- und Eisenbahnknotenpunkt ist im Frühjahr 1945 zu mehr als 70 Prozent zerstört – auch die wichtigen Rheinbrücken sind gesprengt.
Das sah etwa in Köln gänzlich anders aus, wo bald darauf, am 4. Mai, der amerikanische Stadtkommandant Lt. Colonel John K. Patterson Konrad Adenauer wieder in sein altes Amt als Oberbürgermeister der Domstadt einsetzen wird. Die Domstadt am Rhein, ein wichtiger Verkehrs- und Eisenbahnknotenpunkt, war am Ende mitsamt den für alle Verbindungen bedeutsamen Rheinbrücken zu mehr als 70 Prozent zerstört worden, während es in Fürth am Ende »nur« rund elf Prozent gewesen waren.
Erhard machte sich jedenfalls unverzüglich ans Werk und lieferte innerhalb der gesetzten Frist am 23. Mai seinen erhalten gebliebenen, im LEZ einsehbaren »Fürth-Report« ab (genau vier Jahre später sollte Konrad Adenauer als Präsident des Parlamentarischen Rates das Inkrafttreten des Grundgesetzes verkünden). Aber Ludwig Erhard gab seinen Bericht nicht einfach kommentarlos ab. Er hatte ihm zugleich einen vierseitigen Brief an den »Herrn Kapitän« Cofer beigefügt, der in den Akten des Military Government of Bavaria erhalten geblieben ist. Er beweist, dass Ludwig Erhard nicht nur eine amerikanische Erfindung war, sondern selbst fast alles daransetzte, sich unbedingt von der amerikanischen Militärverwaltung entdecken zu lassen.
Der Brief ist mehr als ein Bewerbungsschreiben, er ist Ludwig Erhards Eintrittsticket in die Politik beziehungsweise in die Wirtschaftspolitik, das Schlüsseldokument für den Beginn seiner Karriere. Wir geben ihn hier leicht gekürzt und übersetzt wieder:
»Ich benütze die Übergabe des von mir verfassten Berichtes über den Stand der Fürther Industrie, um der Militärregierung sowohl in beruflicher als auch politischer Hinsicht nähere Angaben zu meiner Person zu leisten. Da ich auf Grund meiner Vorbildung, Kenntnisse und Fähigkeiten der Überzeugung bin, übergeordnete und wesentliche Aufgaben erfüllen zu können und aus innerer Überzeugung bereit bin, mich unter Führung der Militärregierung in den Dienst des Wiederaufbaus der deutschen Wirtschaft zu stellen, erachte ich es trotz bestehender Hemmungen, in eigener Sache für die eigene Person zu sprechen, als meine Pflicht, meine guten Dienste anzubieten … Ich widmete mich dem Studium der Nationalökonomie und promovierte bei Professor Franz Oppenheimer (1925), mit dem mich bis zu seiner Abreise aus Deutschland herzliche Freundschaft verband (durch Briefe zu belegen). Nach einigen Jahren praktischer Tätigkeit trat ich als Assistent in das Institut für Wirtschafts-Beobachtung ein (1929), um dort bis zur Stellung des Leiters der Forschungsstelle aufzurücken. Meine während dieser Zeit gehegte Absicht, mich der Hochschullaufbahn zu widmen, habe ich angesichts der von mir abgelehnten Bedingung, die Parteizugehörigkeit zu erwerben, aufgegeben.
Als sich in den Kreisen der deutschen Industrie das Bedürfnis nach Begründung eines eigenen wirtschafts-wissenschaftlichen Forschungsinstituts geltend machte und auf meine Anregungen hin für diesen Zweck das Geld aus freien Stiftungen zur Verfügung gestellt wurde, habe ich die Leitung des von mir begründeten Instituts für Industrie-Forschung übernommen … Erwähnt sei in diesem Zusammenhang, dass ich den Arbeitsstab des Instituts … wegen politischer Verfolgung (Verweigerung von uk-Stellungen und von Zuweisung von Arbeitskräften) von Nürnberg nach Bayreuth verlegen musste.
In den letzten Jahren habe ich mich fast ausschließlich mit den nach dem erwarteten deutschen Zusammenbruch auftretenden wirtschaftlichen Problemen beschäftigt und meine Stellungnahmen in ausführlichen Denkschriften und Abhandlungen niedergelegt. Auf diese Weise ist also bereits (seinerzeit streng verboten) wesentliche Vorarbeit geleistet worden, wobei ich ausdrücklich hinzufüge, dass alle diese Arbeiten auf Finanz-, Währungs- sowie allgemein volkswirtschaftlichem Gebiet der Militärregierung zur Einsichtnahme zur Verfügung stehen … Meine Tätigkeit führte mich schon seit vielen Jahren mit dem früheren Oberbürgermeister in Leipzig, Dr. Karl Goerdeler zusammen, mit dem ich bis zu seiner Verhaftung im Juli 1944, wie auch einem vorzulegenden Briefwechsel ersichtlich ist, in stetigem Austausch von Überlegungen und Schriftsätzen stand.
Trotz meiner nie verleugneten politischen Gesinnung wurde ich als einer von der ganzen deutschen Industrie anerkannter bester Sachkenner von dieser wie auch von amtlichen Stellen zu gutachterlicher Tätigkeit herangezogen und vielleicht gerade deshalb geschätzt, weil meine innere sachlich unbestechliche Haltung für politische Kompromisse und Rücksichten kaum Raum ließ. Ich habe auch in solcher Eigenschaft stets meinen ganzen Einfluss zum Schutze politisch bedrängter Personen geltend gemacht. Vor allem war mir das in Lothringen möglich, wofür ich als Zeugen für viele einstweilen nur den Bruder des bekannten Philosophen und Forschers Albert Schwei(t)zer, den Generaldirektor der Glashütten von Portieux, Paul Schwei(t)zer anführen möchte, den ich neben vielen anderen namhaft zu machenden Lothringern vor politischer Verfolgung und Ausweisung schützen konnte.
Aus diesen Erklärungen ergibt sich von selbst, dass ich kein Partei-Mitglied bin, nie der SA, der SS oder irgendeiner anderen Gliederung der Partei angehörte. Ich lehnte sogar die Mitgliedschaft von parteimäßig gebundenen Berufs-Organisationen, wie auch den Eintritt in die deutsche Arbeitsfront ab.
Die Militärregierung möge zu der Überzeugung kommen, dass sie in meiner Person einen Mann erkennen kann, der politisch über alle Zweifel zuverlässig, auch unter Anlegen höchster Maßstäbe auf wirtschaftswissenschaftlichem und organisatorischem Gebiet zur Erfüllung höchst qualifizierter Leistungen befähigt ist. Ich habe vom ersten Tage an der Militärregierung meine Dienste zur Verfügung gestellt und bin derzeit mit dem Spezialauftrag der Wiederherstellung der Fürther Industrie ehrenamtlich im Landeswirtschaftsamt in Fürth tätig. Ich glaube aber, in dieser unselbständigen Stellung meine Kenntnisse und Fähigkeiten nicht voll verwerten zu können, und es ist mir darum besonders viel daran gelegen, mit einer Instanz der amerikanischen Militärregierung in Verbindung zu kommen, die für die Regelung übergebietlicher grundsätzlicher Fragen (etwa innerhalb Bayerns) zuständig ist. Für eine Vermittlung nach dieser Richtung, ggfs. für die Weiterreichung dieses Schreibens wäre ich der Militärregierung in Fürth im Interesse der Sache, der ich dienen will, zu Dank verpflichtet. Bis dahin stehe ich der Militärregierung in Fürth mit meiner Arbeit und mit meinem Rat jederzeit zur Verfügung.
Nach der Ausmerzung des Ungeists des Nationalsozialismus habe ich nur das Bestreben, an der Läuterung Deutschlands mitarbeiten zu dürfen. Ich bekenne mich zu den vielleicht noch wenigen Deutschen, die es als ein Glück ansehen, dass Deutschland für die Taten seiner verbrecherischen Regierung nicht sühnen muss, sondern sühnen darf, um vor den Völkern der Welt wieder einmal ehrlich zu werden.«2
Dieses wirklich sehr spezielle Bewerbungsschreiben war vermutlich der wichtigste politische Brief, den Ludwig Erhard in seinem ganzen Leben verfasst hat. Hier fand einer das ihm zugewiesene Betätigungsfeld in Fürth eindeutig zu klein, hier wollte einer unbedingt höher hinaus, suchte den direkten Kontakt mit dem Office of Military Government (OMGUS) zumindest in Bayern, weil der junge Leutnant vom Counter Intelligence Corps (CIC), der in Fürth für die Bewertung von Personen im Nationalsozialismus zuständig war, ein junger, der Geschichte des Dritten Reiches weitgehend unkundiger und obendrein des Deutschen kaum mächtiger Mann war, auf dessen Hilfe er nicht rechnen mochte.3 Der Briefschreiber ging dabei ausgesprochen geschickt, ja raffiniert vor. Ganz direkt und unverhüllt bot er den Amerikanern seine Mitarbeit, seine Hilfe an, will sich als unbescholtener Wissenschaftler und ausgewiesener Fachmann für ökonomische Fragen in den »Dienst des Wiederaufbaus« stellen. Die zahlreichen großen Gutachten, die er im Dritten Reich angefertigt hatte, will er auf Nachfragen alle vor- und offenlegen. Seine Distanz zur NSDAP hebt er hervor. Die Zeit in Lothringen verschweigt er nicht, gibt ihr aber eine positive Note, weil er auch dort Bedrängten und Bedrohten geholfen hat – als Zeugen nennt er den Bruder Albert Schweitzers. Und nennt noch zwei weitere Namen als Passepartout durch die NS-Zeit: Franz Oppenheimer und Carl Goerdeler.
Besonders Letzterer war wichtig, weil dieser Mann selbst einigen höheren Offizieren in den US-Stäben bekannt gewesen sein dürfte und natürlich all den in amerikanischer Uniform Heimgekehrten wie etwa Hans Habe in München oder Ulrich Biel, dem gebürtigen Berliner und promovierten Juristen, der 1934 in die USA emigriert war und dessen engste Verwandte 1942 in das Ghetto von Riga deportiert und ermordet worden waren. Als Stabsoffizier aus General George Pattons 3. US Army hatte Biel am 16. und 17. April im Auftrag des CIC den 69 Jahre alten Konrad Adenauer in Rhöndorf besucht und interviewt. Schon im März, unmittelbar nachdem die amerikanischen Streitkräfte Rhöndorf erreicht hatten, waren zwei amerikanischen Offiziere bei ihm erschienen und hatten ihn gefragt, ob er wieder das Amt des Kölner Oberbürgermeisters übernehmen könne, aus dem die Nationalsozialisten ihn vertrieben hatten. Damals hatte er noch abgelehnt, weil Söhne von ihm noch in der Wehrmacht dienten und er fürchtete, sie würden in Sippenhaft genommen und hingerichtet, wenn er zusage. Nun sollte Biel sich ein genaueres Bild von seiner Verfassung und Belastbarkeit machen – und ihn für den Wiederaufbau gewinnen. Auch Adenauer war nie vom Nationalsozialismus infiziert gewesen, aber er stand wohl schon – anders als Erhard – auf der »weißen Liste« der Amerikaner mit potentiellen Kandidaten für die Mitarbeit am Wiederaufbau innerhalb des Verwaltungsapparates, der im Westen insgesamt sehr viel unstrukturierter ablief als in der sowjetisch besetzten Zone, wo die kommunistischen Funktionäre von Anfang an alle entscheidenden Fäden in der Hand behielten und sich überall mit Rückendeckung der sowjetischen Militäradministration die Macht- und Schlüsselpositionen sicherten.
An diesem Wiederaufbau mitwirken wollte Ludwig Erhard unbedingt. Aber er brauchte dazu, anders als Adenauer, überzeugende Referenzen. Dabei betrieb er in seinem ausgefeilten Bewerbungsschreiben aber kein plumpes Namedropping, sondern bot zugleich an, Unterlagen und Briefe zur Verfügung zu stellen, die seine fachliche Kompetenz als unpolitischer Wirtschaftsexperte – und auf diese kam es ihm vor allem an – auch in der Zeit der NS-Diktatur beweisen und belegen sollten. Ob er allerdings tatsächlich noch private Briefe von Goerdeler hätte vorlegen können, darf man bezweifeln. Diese hatte vermutlich seine umsichtige Ehefrau Luise sicherheitshalber nach der Verhaftung 1944 verbrannt. Von der seine Darstellung bestätigenden namentlichen Erwähnung in Goerdelers letzten Aufzeichnungen hat Erhard im Übrigen erst in den Fünfzigerjahren erfahren, nachdem der Historiker Gerhard Ritter sie 1954 entdeckt hatte.4
Der Brief sollte in jedem Fall nicht als Prototyp eines Auto-Persilscheins oder als Akt einer Selbstentnazifizierung missdeutet werden. Ludwig Erhard war vor 1945 kein in den nationalsozialistischen Unrechtsstaat und seine Verbrechen tief verstrickter Opportunist gewesen. Er hatte dem Nationalsozialismus von Anfang an misstraut und schon früh seine ökonomischen Heilsversprechungen als wenig nachhaltig durchschaut. Im Herbst 1948 schrieb ihm sein nach Amerika emigrierter jüdischer Jugendfreund Walter D. Klugmann – die Eltern hatten in Fürth wie die Erhards ein Textilgeschäft gehabt, er redete ihn mit »Lieber Lulu« an, Luise war die »liebe Lu« – nicht von ungefähr: »Ich erinnere mich noch sehr gut, als Du mich im Flüsterton auf einer unserer Straßenbahnfahrten von Fürth nach Nürnberg im Jahre 1933 auf die tollen und betrügerischen wirtschaftlichen Maßnahmen der Nazis aufmerksam machtest und ich die ganze Sache damals noch gar nicht richtig durchschaute …«5 Im Dritten Reich, als der Rassenwahn Staatsdoktrin geworden war, hatte er dann, wie im ersten Teil deutlich wurde, im Rahmen seiner Möglichkeiten Positionen vertreten, die sich von den weitverbreiteten völkischen und rassenantisemitischen Denkmustern stark abhoben, und war tatsächlich keiner einzigen der vielfältigen NS-Parteiorganisationen und Untergliederungen beigetreten.
Allerdings ist die in seinem »Kapitänsbrief« erstmals auftauchende Aussage, seine Hochschullaufbahn sei an seiner fehlenden Parteimitgliedschaft gescheitert, höchstwahrscheinlich wirklich eine nachträgliche Selbststilisierung. Natürlich sind auch die anderen Informationen insgesamt positiv eingefärbt, aber alles andere wäre ja auch töricht gewesen, denn es hätte seine Avancen möglicherweise gleich im Papierkorb von Captain Cofer enden lassen. Außerdem ging Erhard sicher davon aus, dass, was für die 131 Fragen des »Fragebogens« gelten sollte, den jeder Erwachsene in der US-Zone bald beantworten musste, auch in seinem Fall Anwendung finden würde: Wen die Amerikaner bei einer Lüge ertappten, der hatte schlechte Karten, musste mit schweren Sanktionen rechnen. Deshalb musste überprüfbar sein und stimmen, was er vortrug.
Hinzu kommt: Ludwig Erhard glaubte, was er schrieb. Er glaubte felsenfest, er sei durch seine langjährige Beschäftigung mit ökonomischen Aufbaufragen jetzt tatsächlich prädestiniert, um am Wiederaufbau maßgeblich und entscheidend und nicht allein als Pro-bono-Helferlein in seiner Vaterstadt mitzuwirken. Hitler war tot, gewiss. Mit der Doppelkapitulation von Reims am 7. und Karlshorst in den frühen Morgenstunden des 9. Mai war der Weltkrieg in Europa beendet. Das Dritte Reich war untergegangen, zumindest politisch und militärisch, das Land zudem moralisch tief diskreditiert. Die Siegermächte hatten es wie die Reichshauptstadt in vier Besatzungszonen geteilt und überall durch ihre Militärgouverneure eine absolute Herrschaft errichtet, die im Grunde eine neuerliche Diktatur war, allerdings eine Militärdiktatur. Mit der Berliner Erklärung vom 5. Juni hatten sie die alleinige Verantwortung und absolute Herrschaftsgewalt über diese Territorien und Berlin übernommen. Das Deutsche Reich hörte an diesem Tage auf, als Staatssubjekt, als staatliche Einheit zu existieren, und die Einschränkung der deutschen staatlichen Souveränität sollte fortwirken bis 1990. Das war alles richtig und ist heute allgemein bekannt.
Aber seltsamerweise bestand das Dritte Reich nach seinem Untergang wirtschaftlich fort, lebte als partielles Geisterwesen nach dem Mai 1945 einfach weiter. Denn die Alliierten behielten das von Hitler mit Kriegsbeginn eingeführte System der Bewirtschaftung, der staatlichen Zuteilung aller wichtigen Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs über Bezugsscheine und -marken, der staatlichen Zuweisung der Rohstoffe und der staatlichen Festsetzung von Löhnen und Preisen einfach bei. Es waren oft auch die gleichen Stellen in den Rathäusern und Meldeämtern, waren oft sogar dieselben Beamten, bei denen man im Krieg und nach dem Krieg die Bögen mit den Bezugsscheinen abholen und Bedarfsgüter beantragen konnte. Allerdings explodierte nach der Kapitulation, da der Kontrolldruck durch die Gestapo weggefallen war, sehr schnell der Schwarzmarkt. Dieser hatte schon im Dritten Reich die Mangelbewirtschaftung durch das Zuteilungs- und Bezugsmarkensystem – das die Deutschen schon aus dem Ersten Weltkrieg kannten – ergänzt und war schon damals mit hohen Strafen belegt gewesen. Bereits Schwarzschlachtung war mit dem Tode bestraft worden. Jetzt drohte zwar meist nicht mehr die Todesstrafe, aber Haft und die Beschlagnahmung der teuer eingekauften oder eingetauschten Waren. Auf dem Schwarzmarkt mit seiner Tauschwirtschaft dominierten die rohen Marktkräfte. Er war der Symbolort jener »Wolfszeit«, die Harald Jähner in seinem 2019 erschienenen Buch so anschaulich beschrieben hat.6 Was knapp war, war teuer. Alles war knapp, ganz besonders aber Lebensmittel. Bauern waren da am besten dran. Hunger kannten sie nicht. Tafelsilber, Edelporzellan, Perserteppiche, ja selbst Fotoapparate wurden gegen einen halben Sack Kartoffeln, Eier, ein Huhn eingetauscht. Weil man der alten Reichsmark in der Besatzungszeit immer weniger traute und Deutschen die Verwendung von Dollars verboten war, wurden rasch Zigaretten wie die »Lucky Strike« zur neuen Parallelwährung. Bei alledem war die Not groß. Wer nix mehr zum Tauschen hatte, musste »hamstern«, plündern, stehlen, Kohlen klauen, »fringsen«, wie das damals hieß – der Kölner Kardinal Josef Frings hatte in seiner Silvesterpredigt 1946 in St. Engelbert (in Riehl) das illegale Beschaffen des Lebensnotwendigsten ausdrücklich legitimiert, weil man in Zeiten extremer Not leben würde und die Menschen es anders nicht erlangen könnten.
Ludwig Erhard erkannte diese ökonomischen Grundvoraussetzungen und Kernprobleme im Gegensatz zur überwältigenden Mehrzahl seiner Landsleute sehr früh, so wie Konrad Adenauer sehr früh das Schisma der Sieger und die sowjetische Bedrohung vorhersah – »Asien steht an der Elbe« sollte er im März 1946 an Wilhelm Sollmann schreiben. Ludwig Erhard war allerdings noch früher als Konrad Adenauer entschlossen, hier nicht tatenlos zuzusehen, sondern selbst zuzupacken und sich dazu von den Amerikanern rufen zu lassen. Anders als die Mehrzahl seiner Landsleute empfand er das Kriegsende nicht primär als niederschmetternde Niederlage, sondern als erlösende Befreiung und zugleich als große Chance zur persönlichen Mitgestaltung. Sein Brief vom 23. Mai 1945 ist denn auch sein erster Schritt auf dem Weg zum Wirtschaftswunderminister.
Die Energie und Entschlossenheit, sich in der Nachkriegszeit auf die Karriere eines Wirtschaftspolitikers einzulassen, die so spürbar die Zeilen seines »Kapitänsbriefs« durchzieht, war für ihn selbst durchaus ein großer Schritt. Denn eigentlich stand Ludwig Erhard der Politik schon früh skeptisch gegenüber, hatte bis dahin allenfalls mit Goerdeler einen Politiker kennengelernt, den er wirklich bewunderte, der ihn übrigens in ihren Gesprächen in der Ablehnung aller totalitären und kollektivistischen Systeme weiter bestärkte: »Ursprünglich war ich kaum zum Politiker geboren … Meiner Distanz lag ursprünglich eine nur geringe Neigung und vielleicht sogar mangelnde Begabung zugrunde, d.h., ich war zunächst kein Politiker von Geblüt. Es trifft schon zu, daß ich selbst … eigentlich wissenschaftlich geprägt, nur durch Zufall und äußere Anstöße zunehmend auch der Politik verhaftet war«7, hat er im Alter rückblickend eingestanden. Dieses Bekenntnis, das er in ähnlicher Form auch schon früher, etwa am 21. Juni 1948, formuliert hatte, war keineswegs reine Koketterie. Denn eigentlich waren ihm von seiner Mentalität her alle Parteien, nicht nur die NSDAP, zutiefst fremd und suspekt, was ebenso für den Typ des Berufspolitikers galt.
Was aus seinem Angebot werden würde, hatte er im Übrigen überhaupt nicht in der Hand, auch wenn er in seinem Text genügend Lockstoffe eingestreut hatte, um Captain Cofer nach der Lektüre zur gewünschten Weiterleitung an höhere und damit entscheidungsmächtigere Instanzen bei OMGUS zu veranlassen. Dieses Kalkül ging aber auf – Cofer reichte den Brief tatsächlich an die Militärverwaltung nach Nürnberg weiter, und von dort ging er nach München. Denn eines suchten nicht nur die Amerikaner händeringend in einem Besatzungsgebiet, wo fast zehn Millionen der NSDAP angehört hatten und Parteimitglieder, aber auch SA- und SS-Ränge besonders stark in den für den Wiederaufbau benötigten deutschen Verwaltungen, Gerichten, Universitäten vertreten waren: unbescholtene, aber dennoch kompetente Deutsche, die zur Mitarbeit bereit und fähig waren. In einer Zeit, als in dem besetzten und besiegten Deutschland nahezu alles fehlte, war dies für die Alliierten der eigentlich kostbarste Rohstoff überhaupt. Und ein solcher Rohdiamant schien Ludwig Erhard tatsächlich zu sein – jedenfalls, wenn seine Selbstdarstellung zutraf.
Die amerikanische Militärverwaltung prüfte und handelte zügig. Bereits wenige Wochen nach Abgabe von Brief und Bericht wurde Erhard tatsächlich zum wirtschaftlichen Berater der Militärregierung von Mittel- und Oberfranken ernannt. Außerdem sollte er in der »Volkswirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaft für Bayern« mitwirken. In den Stäben in Nürnberg und München war den sachkundigen Lesern des Briefes sehr schnell klar geworden, dass dieser Deutsche möglicherweise tatsächlich das Potential für höhere Aufgaben besaß. Der Brief wurde deshalb weitergereicht nach Berlin, wo Erhard ihn ja ursprünglich auch hatte haben wollen: auf der obersten Entscheidungsebene der amerikanischen Militärverwaltung in Deutschland. Wir müssen davon ausgehen, dass sein Verfasser nun ernstlich überprüft wurde, Regelanfrage an das NSDAP-Parteiarchiv, das den Amerikanern nahezu vollständig in die Hände gefallen war, inklusive.
Aber dort und auch sonst wurde nichts entdeckt, was gegen eine weitere und exponierte Verwendung von Ludwig Erhard sprach. So kam er tatsächlich auf eine Liste mit sieben Namen für den Posten des bayerischen Wirtschaftsministers in der ersten Nachkriegsregierung, die das OMGUS in Berlin der amerikanischen Militärverwaltung in Bayern übermittelte. Einer von sieben? Da lagen die Chancen bei etwa vierzehn Prozent. Politik ist eben manchmal auch Lotterie – und man braucht Fortüne, das wusste schon der Alte Fritz.
Ludwig Erhard hatte Fortüne. Er wurde in die engere Wahl gezogen. Wieder kam der Jeep in die Fürther Forsthausstraße und holte ihn zum »Interview« nach München. Die Militärverwaltung wollte den »besten Kenner der deutschen Industriewirtschaft und ihrer Probleme« aber nicht verhören, wie viele andere Deutsche damals, sondern ihre »Entdeckung« noch etwas gründlicher in Augenschein nehmen. Bald nach seiner Rückkehr kam dann der Möbelwagen. Was letztlich den Ausschlag gab für seine Ernennung, wissen wir nicht. In der von den Amerikanern eingesetzten ersten Regierung unter dem bereits am 28. September ernannten Sozialdemokraten Wilhelm Hoegner hieß der neue bayerische Minister für Handel und Gewerbe ab dem 3. Oktober 1945 tatsächlich Dr. Ludwig Erhard – und der musste mit seiner Familie nach München umziehen in die Marienstraße 10 nach Großhesselohe bei Pullach, ganz in der Nähe der – sehr passend – Prinz-Ludwigs-Höhe.
Der parteilose Wirtschaftsminister Erhard, in der ersten Kabinettsliste noch als »Linksdemokrat« geführt, rechts hinter dem sitzenden Ministerpräsidenten Hoegner (SPD).
Schon im Oktober 1945 also, als die britische Militärverwaltung Konrad Adenauer in Köln gerade wieder unter entwürdigenden Umständen entließ, ihm jede politische Betätigung untersagte und sogar verbot, die Stadt zu betreten, weil sie so erbost gewesen war über dessen engen, vom schweizerischen Konsul Franz-Rudolf von Weiss konspirativ begleiteten Kontakt zur französischen Besatzungsmacht, wurde Ludwig Erhard tatsächlich von der amerikanischen Militärverwaltung in sein erstes hohes politisches Amt »befördert« – neben dem Finanzminister der einzige Parteilose im Kabinett übrigens, auch wenn er auf der ersten Kabinettsliste noch als »linksliberal« geführt worden war.
Er stürzte sich mit Verve auf seine neue Aufgabe, nahm unermüdlich an Gremien, Ausschüssen, Kommissionen teil, bereiste auch – ein Faible, das ihn zeitlebens begleiten sollte –, so oft er konnte, das Land. Erhard hatte großen Anteil daran, dass der Zusammenschluss der amerikanischen und der britischen Zone näher rückte, auf die vor allem der stellvertretende US-Militärgouverneur Lucius D. Clay – sein späterer Verbündeter – entschlossen zusteuerte. Das war eine pragmatische und naheliegende Lösung angesichts der wachsenden Kosten der Besatzungspolitik, der andauernden Versorgungsengpässe sowie auch der Intransigenz und Obstruktionspolitik der Russen wie auch – zunächst sogar noch stärker und dominanter hervortretend – der Franzosen. Die schrecklich eisigen Winter 1946 und 1947 mit ihren Hunderten von Kälte- und Hungertoten sollten diesen Prozess beschleunigen, weil sie den Besatzungsmächten die Notwendigkeit vor Augen führten, rasch zu effizienteren Verwaltungs- und damit auch Versorgungsstrukturen zu gelangen.
In den Beratungen des Länderrats der amerikanischen mit dem Zonenbeirat der britischen Zone im Frühjahr 1946 ging es aber auch bereits um Fragen der zukünftigen Struktur Deutschlands. Noch waren alle Waren und Lebensmittel streng rationiert und nicht einmal der Handel zwischen den Besatzungszonen erlaubt. Erhard lernte hier nicht nur erstmals seine späteren sozialdemokratischen Gegenspieler Viktor Agartz, den marxistisch geschulten Gewerkschafter und Leiter des Wirtschaftszentralamtes in Minden, und Erik Nölting, den Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen, kennen. Er legte sich auch gleich mit Kurt Schumacher an, der von Schmerz und Bitterkeit gezeichneten SPD-Galionsfigur, der im KZ Arm und Bein verloren hatte und auf einem deutschen »Reichsvolk« als Träger der so bald wie möglich wiederherzustellenden nationalen Einheit bestand, während Erhard ganz im Sinne bayerischer Tradition partikularistisch die Länder-Eigenstaatlichkeit betonte.
Bei einem dieser Treffen, auf der Sitzung am 3. April 1946, soll er übrigens erstmals Konrad Adenauer begegnet sein, der aber sonst bei diesen Gesprächen nicht entscheidend in Erscheinung tritt – noch nicht, ganz anders als Erhard. Der drängte vehement auf die amerikanische Zone als Sitz der zukünftigen bizonalen Verwaltungsorgane, an denen erstmals deutsche Stellen beteiligt sein würden – als Antidot gegen den wenig marktwirtschaftsfreundlichen Kurs der Briten, die nach Churchills überraschender Abwahl seit Sommer 1945 von einem gewerkschafts- und sozialismusfreundlichen Labour-Kabinett unter Clement Attlee regiert wurden, einem Premier, den sein Vorgänger Churchill nicht von ungefähr als »Schaf im roten Wolfspelz« bezeichnet hatte. Dass er von der von ihm favorisierten Entscheidung für Frankfurt, dem Hauptsitz der amerikanischen Militärregierung, noch persönlich tangiert sein würde, konnte Erhard damals allerdings nicht ahnen.8
Wenige Wochen später – Ende Juni, Anfang Juli – wurden für Brigadegeneral Walter J. Muller, den Stabschef der 3. US-Armee, der mit General Patton nach Bayern gekommen und erster Chef von OMGUS Bavaria geworden war, Bewertungen sämtlicher bayerischen Minister angefertigt, darunter auch für den einzigen »Non Political«, den nicht parteigebundenen Wirtschaftsminister. Der kurze Report folgt weitgehend der Darstellung Erhards in seinem »Kapitäns-Brief«, die also tatsächlich ebenso folgenreich wie erfolgreich gewesen war. So heißt es etwa über seine Zeit bei Vershofen:
»Sein Bestreben, wissenschaftliche Forschung und ökonomische Praxis miteinander zu verbinden, war überaus erfolgreich, sodass das Institut unter seiner Leitung in akademischen und Wirtschaftskreisen an Bekanntheit gewann. Da er nicht willens war, in die NSDAP einzutreten, musste er sein Vorhaben der Habilitation aufgeben. Erhebliche Meinungsverschiedenheiten mit dem Bürgermeister von Nürnberg, SS-Obergruppenführer Liebel, führten zu seinem Rückzug von der Institutsposition. Da er aber einen exzellenten Ruf erworben hatte, bot ihm die deutsche Fertigungsindustrie beachtliche Geldmittel, um die Forschungsarbeit privat fortzusetzen … Während der letzten Kriegsjahre verbrachte er die meiste Zeit mit der Untersuchung der Probleme, die Deutschland nach dem Ende des Nazi-Regimes bevorstünden. Diese Studien ermöglichten ihm, eine führende Rolle in der bayerischen Nachkriegswirtschaft zu spielen. Vom ersten Tag der Besatzung an arbeitete er in beratender Rolle eng mit den amerikanischen Behörden zusammen, später wurde er als bayerischer Wirtschaftsminister eingesetzt. Trotz seiner Verpflichtungen wünschte er seine Forschungsarbeit fortzusetzen und Vorlesungen an der Universität München zu halten. Er hatte sich spezialisiert auf die politische Ökonomie der angelsächsischen Welt und ist gründlich bewandert in den Theorien der politischen Ökonomie der westlichen Besatzungsmächte.«9
Diese ungemein wohlwollende interne Bewertung der »amerikanischen Entdeckung« blieb nun in den Akten der Besatzungsmacht und wird 1948 sicher auch Militärgouverneur General Lucius D. Clay vorgelegt worden sein. Noch aber lag das Hauptbetätigungsfeld Ludwig Erhards eindeutig in Bayern. Mit dem gleichfalls parteilosen Finanzminister Fritz Terhalle arbeitete er harmonisch und konstruktiv zusammen. Aber er stöhnte bald über die Mühen der staatlichen Bewirtschaftung, die Zuteilung von Gütern und Rohstoffen, die schleppende, planwirtschaftliche Versorgung mit dem Allernötigsten, für die sein Ressort mitverantwortlich war, und natürlich über die weiterhin schlechten Verkehrs- und Transportmöglichkeiten sowie das provinzfürstliche Gehabe mancher Landräte und Bürgermeister, mit der sein Ressort sich herumzuschlagen hatte. Es war ja dies eine Zeit des großen Mangels an allem. Statistiken wiesen aus, dass jeder im Durchschnitt mehr als dreißig Jahre auf einen Anzug, eine Hose, ein Kleid warten müsse –und man spottete voller Galgenhumor, dass man jetzt keinesfalls sterben dürfe, weil statistisch nur alle sieben Jahre ein Sarg zur Verfügung stehe.
Umso stolzer war der Minister als »Schirmherr« über den Erfolg und Publikumsandrang bei der ersten, von ihm mit besonderem Enthusiasmus organisierten »Export-Schau« des Freistaats, die dem durch bürokratische Gängelung und die strengen Kontrollen der Besatzungsmächte fast völlig abgewürgten bayerischen Außenhandel die Türen in die Welt wieder öffnen sollte. Natürlich ließ er es sich als Staatsminister nicht nehmen, US-Außenminister James F. Byrnes während dessen Deutschlandbesuch im Herbst 1946 in Begleitung des Ministerpräsidenten persönlich durch diese »Leistungsschau der bayerischen Wirtschaft« zu führen. Byrnes hielt anschließend am 6. September in Stuttgart seine berühmte »speech of hope«, in der er den Deutschen Mut zusprach und erstmals Hoffnungen auf die Rückgewinnung der verlorenen Souveränität und ein Ende der Aufteilung in vier Besatzungszonen machte. Zugleich legte er den Morgenthau-Plan, der Deutschland in einen Agrarstaat hatte verwandeln wollen, vernehmlich zu den Akten, indem er erstmals offiziell erklärte, dass die Vereinigten Staaten einen Wiederaufbau unterstützten, weil davon »nicht nur das Wohlergehen Deutschlands, sondern auch das ganz Europas« abhänge – ein entscheidender Wendepunkt in der US-Deutschlandpolitik.
Der bayerische Wirtschaftsminister im Gespräch mit dem ranghöchsten Offizier seiner »amerikanischen Entdecker«, dem Oberkommandierenden der alliierten Streitkräfte in Europa, General Dwight D. Eisenhower, im Herbst 1946 in München.
Wenige Monate nach dieser Rede verkündete der amerikanische Präsident im März 1947 seine berühmte »Truman-Doktrin« und bot unter dem Eindruck der voranschreitenden sowjetischen Expansion in Ostmitteleuropa und des kommunistischen Putschversuches in Griechenland jedem Staat amerikanische Hilfe an, der von kommunistischen Umsturzversuchen und Machtergreifungen bedroht sei. Damit war der Zerfall der Siegerkoalition von 1945 offen zutage getreten, zugleich der Kalte Krieg erklärt – und eine baldige Wiedervereinigung Deutschlands in weite Ferne gerückt. Aber da war Außenminister Byrnes schon nicht mehr im Amt. Er war nach Differenzen mit Truman bereits am 20. Januar zurückgetreten, sein Nachfolger wurde der General und Diplomat George C. Marshall, mit dessen Namen sich das gewaltige Kreditprogramm zum Neuaufbau Europas, das »European Recovery Program« (ERP) verknüpft, das der Kongress im Sommer 1947 verabschieden würde.
Auch Ludwig Erhard war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Amt, er hatte es sogar noch vier Wochen früher als Byrnes verloren. Sein Rücktritt war aber vor allem der Tatsache geschuldet, dass in Bayern am 1. Dezember 1946 die ersten Landtagswahlen nach dem Krieg stattgefunden hatten. Die CSU hatte aus dem Stand die absolute Mehrheit erreicht, anschließend unter der Führung ihres Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt, Hans Ehard, mit den Sozialdemokraten (und der Wirtschaftlichen Aufbau-Vereinigung) eine Große Koalition gebildet – was damals keineswegs ungewöhnlich, sondern in den allermeisten Ländern gängige Praxis war.10
Der parteilose Ludwig Erhard musste daher am 21. Dezember 1946 dem Sozialdemokraten Rudolf Zorn weichen, da ihm die Rückendeckung der CSU fehlte, in die er nicht hatte eintreten wollen. Allerdings wäre eine Fortsetzung seines Ministeramts wohl auch nach einem opportunistischen Parteieintritt schwierig geworden. Aufgrund seiner immer unverhüllter zutage tretenden liberalen Auffassungen war der Wirtschaftsminister nicht nur mit seinem kommunistischen Staatssekretär oder den Sozialdemokraten, sondern auch rasch mit dem »Bauernflügel« der CSU sowie dem bayerischen Gewerkschaftsbund aneinandergeraten.
Er stand außerdem in dem Ruf, sein Ministerium nicht straff genug führen zu können, überhaupt für die Wahrnehmung bürokratischer Aufgaben ungeeignet zu sein, hatte andererseits ungeniert – welche Anmaßung – wiederholt öffentlich die Meinung vertreten, Bayern sei für einen Wirtschaftsfachmann seines Kalibers als Betätigungsfeld eindeutig zu klein.11 Seinen Kritikern und Gegnern fehlte es jedenfalls nicht an »Munition«, auch Erhards kommunistischer Staatssekretär Georg Fischer lieferte ihnen diese fleißig. Das nach seiner Entlassung durch die Militärverwaltung im Juni 1946 von ihm mitgenommene Material stellte er den Linksparteien zur Verfügung.
Kurz nach Erhards Entlassung wurde auf Antrag der SPD im Februar 1947 daher vom bayerischen Landtag ein »Ausschuss zur Klärung der Missstände im Wirtschaftsministerium« eingesetzt, der erste in der bundesrepublikanischen Parlamentsgeschichte. Unter dem Vorsitz des CSU-Landwirtschaftsministers Alois Schlögl tagte er neun Monate lang, befragte 50 Zeugen – um in seinem Abschlussbericht festzustellen: »Dem Minister a. D. Dr. Erhardt (sic!) können nach Überzeugung des Ausschusses keine Vorwürfe in Bezug auf die Lauterkeit seiner Person gemacht werden. Wenn Minister Erhardt der Erfolg versagt blieb, so lag dies nach Überzeugung des Ausschusses im Besonderen daran, daß er zuviel Theoretiker war, daß ihm die nötige Verwaltungserfahrung zur Führung eines Ministeriums fehlte und er es nicht verstand, sich die Mitarbeiter zu suchen, die das, was ihm fehlte, ersetzten.«12
Erhard muss sich darüber schrecklich geärgert haben, obwohl sich alle Korruptionsvorwürfe in Luft aufgelöst hatten. Die Hinweise über Verwaltungsprobleme, nun gut, das kannte er schon seit Vershofen, da mochte vielleicht etwas dran sein. Allerdings hatte er auch mit einem heterogenen Apparat zu kämpfen gehabt. Aber ein abgehobener Theoretiker? Lächerlich. Das war er ja nun gerade nicht. Entsprechend scharf äußerte sich der Angegriffene am Ende des Verfahrens in einem Interview mit Radio München, sprach von »Pharisäertum«, »grandiosem Blödsinn«, »grotesken Unwahrheiten«, auch von »Verleumdung und Ehrabschneiderei«, schließlich abschätzig von »parlamentarischem Freibeutertum«.13
Durch seine Einbindung in den Münchner Kreis um den bedeutenden Nationalökonom Adolf Weber, einen dezidierten Kritiker der sowjetischen Planwirtschaft wie der NS-Befehlswirtschaft, war Ludwig Erhard noch während seiner kurzen Ministerzeit in Kontakt zur Staatswirtschaftlichen Fakultät der Universität München gekommen. Bereits in der Fakultätssitzung vom 2. Februar 1946 hatte man beschlossen, beim bayerischen Kultusministerium die Ernennung Erhards zum Honorarprofessor zu beantragen, und ihm nach Zustimmung der Militärregierung vom 26. März 1946 zwei Lehraufträge über wirtschaftspolitische Gegenwartsfragen erteilt, von denen er allerdings wegen seiner ministeriellen Arbeitsbelastung nur den ersten durchführte. Nach seinem Ausscheiden aus dem Kabinett wurde ihm ein neuerlicher Lehrauftrag erteilt. Fast zeitgleich mit dem Vorliegen des Untersuchungsberichts wurde ihm am 7. November 1947 dann endlich die Ernennung zum Honorarprofessur an der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität München überreicht, auf die er so ausgemacht stolz war, dass er »fortan die Anrede ›Professor‹ quasi zu seinem ersten Vornamen machte«.14
Die Ernennung war zwar ein willkommenes Trostpflaster, aber sie konnte ihn nicht wirklich darüber hinwegtrösten, dass die angestrebte Karriere in der Politik nach etwas mehr als einem Jahr ganz offensichtlich schon wieder abrupt beendet worden war, zumal diese akademische Würde seine Rolle als realitätsferner »Theoretiker« noch festzuschreiben schien – und dass ihm nun offenbar nachgesagt werden konnte, er sei zur Führung eines Ministeriums ungeeignet. Immerhin war er auf Umwegen endlich doch noch ein Hochschulprofessor geworden, wenn auch ohne Habilitationsschrift. Nicht nur vor seinen Studenten, die ihm in der Universitätsruine in der Münchner Ludwigstraße zuhörten und, weil es kaum Heizleistung gab, Briketts zu den Sitzungen beisteuerten, trat er in diesen Wochen weiter für marktwirtschaftliche Prinzipien ein. Auch im Organ der amerikanischen Besatzungszone Die Neue Zeitung äußerte er sich mehrfach ablehnend gegenüber »staatlicher Befehlswirtschaft« und Wirtschaftsvorstellungen eines demokratischen Sozialismus.15 Wirklich lange unterrichtet hat er allerdings nicht, denn nach wenigen Monaten verließ er die Alma Mater schon wieder – für immer.
Damals verfestigte sich seine marktwirtschaftliche und wettbewerbsfreundliche Position weiter, deren Wurzeln, wie wir gesehen haben, bis in die Kriegszeit und die damalige Suche nach neuen Wegen zurückreichen. Seit damals rückte Ludwig Erhard immer stärker an jenen Kreis von Wirtschaftswissenschaftlern heran, die sich selbst – weil einer freiheitlichen Ordnung verpflichtet – als Ordo-Liberale oder Neo-Liberale bezeichneten. »Neoliberal« ist heute ein vergiftetes Etikett, das nicht nur von SPD, Grünen und Linkspartei, sondern auch von Teilen der Medienwelt verwendet wird, um die Marktwirtschaft als »marktradikalen« Tiefpunkt der kapitalistischen Ausbeutung zu diskreditieren. Ludwig Erhard hätte aufgelacht darüber, denn dass der Markt radikal und damit gefährlich sei, das wäre ihm ebenso grotesk und lächerlich vorgekommen wie eine »radikale Küche« oder ein »radikaler Brunnen«.
Das Etikett »neoliberal« – und das vergessen die allermeisten, die es heute negativ belegen – geht zurück auf eine Konferenz im Jahr 1938 in Paris. Damals rief der kluge Walter Lippmann, der gerade das Buch The Good Society veröffentlicht hatte und 1947 den Begriff »Kalter Krieg« hellsichtig prägen sollte, rund dreißig Intellektuelle, Akademiker und Wirtschaftswissenschaftler aus Europa zusammen, um in einem Kolloquium über die beste Form der zukünftigen Gesellschaft nach der Zeit der Diktaturen zu debattieren. Zu den Eingeladenen zählten aus Deutschland die Emigranten Alexander Rüstow und Wilhelm Röpke, aus Österreich unter anderem die beiden Emigranten Friedrich August von Hayek und Ludwig von Mises.
Entscheidender Ausgangspunkt für sämtliche Diskussionen war der antitotalitäre Konsens aller Beteiligten. Sowohl Stalins Massenmordsozialismus wie Hitlers braune Rassenwahn- und Rassenmord-Diktatur wurden verworfen – aber auch der brutale Manchester-Kapitalismus, den viele überhaupt als Grundvoraussetzung für den Siegeszug der totalitären Führer- und Einparteienherrschaft begriffen. Als einziges nachhaltig wirksames Gegengift wurde auf dieser Konferenz eine Belebung des in den Dreißigerjahren mit fatalen Folgen überall marginalisierten Liberalismus definiert. Über den Namen, das treffende Etikett, unter dem man für die neue Sache streiten wollte, wurde heftig gerungen. »Neo-Kapitalismus« fiel durch, Alexander Rüstows Begriffsschöpfung »Neo-Liberalismus« fand eine Mehrheit. Auch wenn mit diesem Begriff etwa Walter Röpke sogleich nicht zufrieden war und der abwesende Walter Eucken ihn gänzlich ablehnte – er plädierte für eine neue liberale Ordnung, einen neuen »Ordo-Liberalismus« –, setzte er sich nach dem Krieg dennoch durch und fasste den kleinen Kreis derjenigen zusammen, die den damals weitverbreiteten planwirtschaftlichen und staatsinterventionistischen Konzepten eine deutliche Absage erteilen und auf Markt und Wettbewerb setzen wollten.
In diesen Kreis rückte jetzt auch Ludwig Erhard. Schon im Krieg hatte er Wilhelm Röpkes Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, seine 1944 publizierte Civitas Humana und die Internationale Ordnung gelesen und sich dadurch in seinem Herantasten an marktwirtschaftliche Konzepte bestärkt gefühlt. Röpke, der schon 1933 seinen Lehrstuhl in Marburg verloren hatte und anschließend wie Ernst Reuter in die Türkei, später dann in die Schweiz emigriert war, hat Erhard intensiv beeinflusst mit seinem Plädoyer für möglichst freie Märkte, Privateigentum und einen starken Staat als Schiedsrichter, der Auswüchse des Marktes einhegen, Kartelle, wie sie in Deutschland noch in der Weimarer Zeit völlig selbstverständlich und legitim gewesen waren, verbieten und gleichzeitig den Menschen größtmögliche Freiheit in der Gestaltung ihres Lebens und ihres Wirtschaftens lassen sollte. Freier Handel, stabile Währung, eine dem Gemeinwohl verpflichtete, gegenüber Partikularinteressen unparteiische Regierung – dem konnte Erhard mit wachsender Überzeugung zustimmen.16
Aber auch Walter Eucken, der im Krieg in seiner Freiburger Widerstandsgruppe die Grundzüge der ordoliberalen Schule oder auch der »Freiburger Schule« entwickelte, ab 1948 die Zeitschrift ORDO edierte und anders als Röpke eine stärkere Überwachung der Märkte durch die Regierung für notwendig hielt, um den Missbrauch durch marktbeherrschende Interessengruppen zu verhindern, hatte es Erhard angetan. Ob Erhard und Eucken sich schon im Krieg kennenlernten und austauschten, ist bislang nicht belegt. Verifizierbare Kontakte und einen Gedankenaustausch gibt es erst für die Nachkriegszeit.17
Natürlich spielte all das in dem Arbeitskreis um den Nationalökonomen Adolf Weber eine Rolle, zu dem Erhard schon ab Juni 1945 gehörte; der von ihm bald schon verehrte Professor hatte ihn erstmals zu einer Gesprächsrunde über Fragen der Weltwirtschaft und Währung in sein Haus am Herzogpark eingeladen. Nach seiner kurzen Amtszeit als bayerischer Wirtschaftsminister intensivierte Erhard – nun wieder als Leiter des Instituts für Wirtschaftsbeobachtung – den Meinungsaustausch mit diesem Kreis und arbeitete sogar in einer Volkswirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaft mit Adolf Weber, seinem früheren Kabinettskollegen Fritz Terhalle und weiteren Nationalökonomen auf währungspolitischem Gebiet zusammen. Daraus entstand eine neuerliche Denkschrift über die von allen Beteiligten für unabdingbar gehaltene Währungsreform, die dem Wirtschaftsrat der Bizone im Juli 1947 überreicht werden sollte, was vor allem Erhards Ansehen bei den Amerikanern weiter stärkte.18
In diesem Kreis setzte man sich – teilweise durchaus kritisch, in jedem Fall intensiv – mit der sogenannten »Freiburger Schule«, mit den Thesen von Eucken, dem Juristen Franz Böhm (übrigens auch er ein Berater von Carl Goerdeler), dem nach Genf emigrierten Wilhelm Röpke und dem seit 1938 britischen Staatsbürger Friedrich A. von Hayek auseinander.19 Erhard, mit Röpke mittlerweile persönlich gut bekannt, »empfand«, so der Münsteraner Nationalökonom Alfred Müller-Armack, damals »die Gedankengänge der neoliberalen Schule … als den seinen verwandt«.20 Vor allem muss ihm aber die Konzeption verwandt und vertraut erschienen sein, die Müller-Armack, mit Erhard seit Anfang der Vierzigerjahre bekannt, im Jahr 1946 veröffentlichte: die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft. Es ist wohl kein Zufall, dass ausgerechnet Müller-Armack, der zuvor, angeregt durch Max Weber, religionssoziologische und wirtschaftsgeschichtliche Studien verfasst und über den Zusammenhang von Ethik und Arbeitsauffassung nachgedacht hatte21, diesen Begriff prägte. Er brachte auf eine Formel, was Erhard wenig später praktizierte, weiterzuentwickeln und in die Realität zu übertragen suchte – eine Wirtschaftsordnung, in der zwar Wettbewerb herrschen sollte, zugleich aber auch soziale Sicherungen einzubauen waren. Sie wollte den Menschen zu einem Höchstmaß an Produktivität anhalten, ihn aber zugleich vor gnadenloser Ausbeutung und existenzieller Not bewahren.22
Nach der Verkündung der Truman-Doktrin und dem Scheitern der Moskauer Außenministerkonferenz im März/April 1947, als sich immer deutlicher der Beginn des Kalten Krieges abzeichnete, waren von US-Seite im Einvernehmen mit den Engländern die Bemühungen intensiviert worden, die Verhältnisse in der neuen, durch das Zusammenlegen des amerikanischen und britischen Besatzungsgebiets entstandenen Bizone – es war dies die erste deutsche Wiedervereinigung nach dem Krieg – weiter zu stabilisieren und die Versorgungslage durch kürzere Entscheidungswege zu verbessern. Es wurde ein zentraler Wirtschaftsrat, eine Art Wirtschaftsparlament, mit Sitz in Frankfurt eingerichtet, dem 54 (bzw. nach einer Wahlprüfung 52) von den acht Landtagen der Bizone gewählte Abgeordnete angehörten. Sie traten am 25. Juni 1947 zu ihrer konstituierenden Sitzung im Saal der Frankfurter Börse zusammen. Außerdem waren fünf, später sechs Direktorenposten vorgesehen. Diese Direktoren fungierten gewissermaßen als Minister; sie leiteten nunmehr zentral von Frankfurt aus die einzelnen Ressortverwaltungen und wurden vom Wirtschaftsrat gewählt, in dem die bürgerlichen Parteien CDU/CSU, FDP, DP sowie das Zentrum über eine knappe Mehrheit gegenüber SPD und KPD verfügten. Dies war die heute vollständig vergessene Keimzelle für ein neues deutsches Parlament und eine neue deutsche Nachkriegsregierung.
Wer sollte Direktor der besonders wichtigen Verwaltung für Wirtschaft werden? Darüber kam es zu einem folgenreichen Konflikt. Die SPD, die zu diesem Zeitpunkt bereits sämtliche acht Wirtschaftsminister in der Bizone stellte, plädierte für Alfred Kubel, den sozialdemokratischen Wirtschaftsminister und – seit dem 9. Dezember 1946 – Ministerpräsident Niedersachsens, nachdem der marxistisch geschulte Viktor Agartz sich aus gesundheitlichen Gründen zum Verzicht auf eine Kandidatur gezwungen gesehen hatte. Doch hier – und das ist eine Ironie der Geschichte oder eine, nach Hegel, ihrer Listen – intervenierte Konrad Adenauer, der Vorsitzende der CDU in Rheinland und ihr Fraktionsvorsitzender im Landtag von NRW, erstmals auf einem Feld, das Ludwig Erhard stark tangieren sollte. Zur entscheidenden Fraktionssitzung von CDU und CSU vor der Wahl am 22. Juli 1947 war er eigens nach Frankfurt gereist und hatte die Abgeordneten vehement davor gewarnt, auch noch dieses Wirtschaftsamt der SPD zu überlassen: »Mit Aufgabe des Wirtschaftsdirektors durch die CDU werde die CDU in der britischen Zone einen Stoß erhalten, von dem sie sich nicht mehr erholen werde«, lautete die von seinem Hang zur Überdramatisierung geprägte Warnung. Das mochten aber nun doch nicht alle anwesenden Christdemokraten glauben, denn die Probeabstimmung fiel mit zwölf zu sieben Stimmen bei zwei Enthaltungen recht knapp aus.
Aber immerhin gab Adenauers Intervention den Ausschlag. Die Mehrheit von CDU/CSU, FDP und DP – ein bürgerliches Bündnis rechts von der SPD, das es auf Länderebene bislang sonst nirgendwo gab – brachte anschließend Johannes Semler, einen der wenigen evangelischen Mitbegründer der bayerischen CSU, als ihren Kandidaten durch. Daraufhin zog die SPD enttäuscht ihre Bewerber für die übrigen Ressorts zurück, ging schmollend in die Opposition und verzichtete damit auf wichtige Einflussmöglichkeiten. Es war ein Schritt mit Langzeitwirkung, zugleich eine der ersten wichtigen Weichenstellungen der deutschen Innenpolitik nach dem Krieg – und bald schon überaus folgenreich für Ludwig Erhard.23
In einer der nächsten Sitzungen des Wirtschaftsrats hatten die Abgeordneten auf Anweisung der Besatzungsmächte die sog. »Sonderstelle Geld und Kredit« zu besetzen, die auf deutscher Seite Vorschläge für die allgemein als unvermeidlich erachtete Währungsreform erarbeiten sollte. Unter den acht Vollmitgliedern dieses neuen Gremiums, die sich am 10. Oktober 1947 in Bad Homburg im Taunus zu ihrer ersten Sitzung trafen, befand sich auch Ludwig Erhard, der – vielleicht kannten einige der Anwesenden zumindest vom Hörensagen seine Denkschrift zur Schuldenkonsolidierung – wenig später sogar den Vorsitz übernahm. Zu den lange unbekannten Hintergründen dieser Wahl, die Erhard wieder etwas näher an die politische Sphäre heranführte, hat Andreas Metz 1998 hilfreiche Hinweise beigesteuert und plausibel belegt, dass es der bayerische FDP-Abgeordnete und Präsident der bayerischen Maschinenbau-Anstalten Everhard Bungartz gewesen ist, der ihn seiner Fraktion vorgeschlagen hatte. Die FDP, die in Bayern zwischen 2,5 und 5 Prozent dahindümpelte, hatte schon länger ein Auge auf Erhard geworfen, und besonders sein bayerischer Kollege Thomas Dehler hatte sich schon um ihn bemüht. Die Benennung von Erhard als Kandidaten für die Sonderstelle und seine Bestätigung war denn auch so etwas wie ein Werbegeschenk der FDP an ihn.24
Die Sonderstelle und damit auch Erhard wurden dem Direktor der Verwaltung für Finanzen beim Frankfurter Wirtschaftsrat, dem CDU-nahen Alfred Hartmann, von 1949 bis 1959 Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, unterstellt. Allerdings durften sie nicht direkt mit dem Wirtschaftsrat zusammenarbeiten – ihre Ergebnisse sollten ausschließlich dem »Bipartite Control Office« (BICO), also der amerikanisch-britischen Verwaltung, zugeleitet werden. Rasch wurde den Mitgliedern der Sonderstelle und damit auch Erhard klar, »daß der Inhalt der Währungsreform von den Alliierten weitgehend selbst bestimmt werden würde, und daß diesen vorwiegend nur an einer technischen Mitarbeit der deutschen Sachverständigen gelegen war«.25 Die Amerikaner, allen voran der junge Währungsexperte Edward A. Tenenbaum, der unter der Anleitung von Jack Bennett, dem Finanzberater des amerikanischen Militärgouverneurs Lucius D. Clay, wesentliche Teile der Reform konzipierte, insbesondere die in den USA bei New York neu zu druckende und anschließend in Deutschland zu verteilende Geldmenge und die Umtauschquote austüftelte, wollten sich die Regie bei diesem Schritt, den sie für den wirtschaftlichen Gesundungsprozess für entscheidend hielten, keinesfalls aus der Hand nehmen lassen.
Für Ludwig Erhard bestand daher keine Möglichkeit, von dieser Basis aus jene umfassende Wirtschaftsreform in Gang zu setzen, von deren Notwendigkeit er schon seit der letzten Kriegsphase zutiefst überzeugt gewesen war. Allerdings tat er selbst diesmal nichts, um sich anderweitig – etwa durch Mitgliedschaft in einer Partei – eine politische Basis zu verschaffen. Er suchte lediglich über Zeitungsartikel öffentlich für seine Vorstellungen zu werben und wartete ab – in auffälligem Gegensatz zu Adenauer, der in diesen Wochen und Monaten zielstrebig seine politische Einflusssphäre auszubauen und abzusichern wusste. Dass Erhard 1948 doch noch in jene Schlüsselposition gelangte, die er im Frühjahr 1945 angestrebt hatte, verdankte er am Ende weniger eigener Initiative als einer Kette von kaum vorhersehbaren Umständen und Zufällen – und ein weiteres Mal der energischen Fürsprache durch die Freien Demokraten.
Nachdem im Dezember 1947 die Londoner Außenministerkonferenz in keiner Frage eine wirkliche Einigung gebracht, sondern vor dem Hintergrund der avisierten Marshallplanhilfe und der voranschreitenden kommunistischen Gleichschaltung in den mittel- und osteuropäischen Staaten ganz im Gegenteil eine Verschärfung der Gegensätze zwischen den drei Westmächten und der stalinistischen Sowjetunion sichtbar gemacht hatte, trieb die amerikanische Regierung den Ausbau der Bizone zu einem selbständigen, funktionstüchtigen Staatsgebilde – wenn irgend möglich unter Einschluss der französischen Zone – mit noch größerer Energie voran.26 Die Kompetenzen des Wirtschaftsrates in Frankfurt wurden erweitert, die Zahl seiner Mitglieder verdoppelt. Seine Direktoren bildeten fortan unter einem ihre Arbeit koordinierenden Oberdirektor einen Verwaltungsrat, eine Art Kabinett. Damit hatte sich – zumindest partiell – im westlichen Teil Deutschlands so etwas wie die Vorform eines zentralen Regierungssystems ausgebildet.
Wie schon beim Vorgänger dieses neu formierten Wirtschaftsrates standen auch jetzt wieder Sozialdemokraten und Kommunisten in Opposition zur »regierenden« bürgerlichen Koalition, die sich bei Semlers Wahl erstmals zusammengefunden hatte. Bei der Wahl der einzelnen Direktoren gaben die Abgeordneten von KPD und SPD weiße, also ungültige Stimmkarten ab. Hermann Pünder, von 1926 bis 1932 Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei, im Herbst 1945 dann Adenauers Nachfolger im Amt des Kölner Oberbürgermeisters, erreichte bei seiner Wahl zum Oberdirektor am 2. März 1948 nur 40 statt der eigentlich erforderlichen 53 Stimmen – und kam (wegen des Stimmverhaltens von SPD und KPD) dennoch nach kurzen Geschäftsordnungsdebatten durch.27 Auch dem neuen Direktor der Verwaltung für Wirtschaft im Vereinigten Wirtschaftsgebiet – so sein offizieller Titel – genügten 48 Ja-Stimmen gegenüber 49 weißen Kärtchen für eine »Mehrheit«.28 Dieser Direktor, der da am 2. März 1948 gewählt worden war, hieß für viele gänzlich überraschend – Ludwig Erhard.
Wie war das möglich? Johannes Semler, der bisherige Direktor der Verwaltung für Wirtschaft, hatte am 4. Januar 1948 auf einer CSU-Veranstaltung in seiner berühmten »Hühnerfutter-Rede« die amerikanische Militärverwaltung wegen der – angeblich – schlechten Versorgungslieferungen scharf attackiert und war, weil ein Spitzel mitgeschrieben und seine Worte der Besatzungsmacht hinterbracht hatte, drei Wochen später seines Amtes enthoben worden.29 In der Union war klar, dass es bei der Neubesetzung eigentlich um eine Richtungsentscheidung über die zukünftige Wirtschaftspolitik ging. In der Anlage zum Protokoll der Fraktionssitzung vom 23. Februar 1948 stand unter dem Punkt »Freie oder staatlich gebundene Wirtschaft?« die Feststellung: »Die CDU muß ein klares und eindeutiges Gesicht in dieser Frage zeigen. Was gegenwärtig herrscht, ist kein Kompromiß, sondern Systemlosigkeit«.30
Allein, die Wahl sollte schon am 2. März stattfinden. Die Zeit bis dahin verrann schnell. Einen Tag vor der Wahl hatte man sich noch immer nicht auf einen Kandidaten verständigen können, von einer Grundsatzdebatte ganz zu schweigen. Die CSU, die den Posten nur ungern an eine andere Partei abtreten mochte, plädierte für Hanns Seidel. Bei den Christdemokraten favorisierte man dagegen den niedersächsischen Arbeitsminister Hans-Christoph Seebohm (DP), wäre aber auch mit einer kommissarischen Leitung der Amtsgeschäfte durch Semlers Stellvertreter, Staatssekretär Dr. Walter Strauss (CDU), einverstanden gewesen. Ausgerechnet jetzt war Adenauer nicht anwesend, um ordnend einzugreifen – abermals eine List der Geschichte, allerdings eine tragische. Denn in diesen letzten Februartagen des Jahres 1948 lag seine zweite Frau Gussie im Sterben; sie starb am 3. März in einem Bonner Krankenhaus an den Folgen eines Selbstmordversuchs. Diesen hatte sie aus Scham darüber unternommen, dass sie der Gestapo nach dem 20. Juli 1944 das Versteck ihres Mannes – angesichts einer Folterdrohung gegenüber der Tochter – verraten hatte. Adenauer konnte deshalb nicht nach Frankfurt kommen, sondern blieb in Rhöndorf.
In den gemeinsamen Beratungen von CDU/CSU und FDP schlugen die Liberalen, schlugen Viktor-Emanuel Preusker und Hans Wellhausen als Kompromisskandidaten Ludwig Erhard vor. Preusker und Franz Blücher hatten sich vorher mit dem Wirtschaftsprofessor mehrfach im Frankfurter Hotel Monopol-Metropol getroffen, wo Erhard seit dem 20. Februar weilte. Er war vermutlich eigens dorthin gekommen, um doch noch seine Chancen auf die Semler-Nachfolge zu sondieren. Nach den Gesprächen mit Blücher und Preusker durfte er annehmen, dass sie nicht ganz schlecht standen, denn beide waren hinterher nicht allein von seinen vorzüglichen Zigarren (damals regelrechte Raritäten), sondern mehr noch von seinen optimistischen Ausführungen beeindruckt.
An der Nachtsitzung der CDU/CSU-Fraktion vor der Wahl nahmen dann erstmals zwei FDP-Abgeordnete – Heinrich Faßbender und Fritz Oellers – teil und beharrten in der intensiven Debatte auf dem liberalen Personalvorschlag. Im Protokoll heißt es hinterher: »Zu Gunsten einer gedeihlichen zukünftigen Zusammenarbeit mit der FDP verzichtet die Fraktion auf die Nomination Dr. Seebohms. Obwohl dieser die einhellige Anerkennung der kleinen Auswahlkommission gefunden hat, beschließt die Fraktion mit 12 gegen 2 Stimmen, der Kandidatur Dr. Erhards zuzustimmen.«31
Es ist mehr als wahrscheinlich, dass Erhard nicht so einfach nominiert worden wäre, wenn Konrad Adenauer hätte in Frankfurt sein und den christdemokratischen Findungsprozess konzentriert steuern können. Telefonisch hatte er sich wohl gegenüber seinem Freund und Vertrauten Robert Pferdmenges für Hans-Christoph Seebohm – und den Kölner Oberbürgermeister Hermann Pünder, dessen Zusage er vorsorglich einholte – ausgesprochen. Auf den für die Union überraschenden FDP-Vorschlag in letzter Minute hatte er dann nicht mehr reagieren können. Dass der alte Fuchs, der sich so stark für Semlers Wahl eingesetzt hatte, sich jetzt mit einem Vorschlag der FDP, einen Parteilosen zu wählen und damit den Zugriff auf eine wichtige Schlüsselposition aufzugeben, einverstanden erklärt hätte, ist schwerlich anzunehmen. Außerdem wusste Adenauer mit ziemlicher Sicherheit, dass ein Untersuchungsausschuss in München wenige Monate zuvor ausgerechnet diesem Kandidaten bürokratische Unfähigkeit attestiert und die Eignung zum Ministeramt abgesprochen hatte.
Warum haben Vertreter aus Bayern wie Josef »Ochsensepp« Müller, der CSU-Chef, oder der junge, ehrgeizige Franz Josef Strauß, die beide natürlich nur zu genau vom Untersuchungsausschuss wussten, in Frankfurt so vornehm geschwiegen? Vermutlich weil sie zu den wenigen in der CSU gehörten, die Erhard schätzten, ja sich ihm freundschaftlich verbunden fühlten. Insgesamt bleibt jedenfalls bemerkenswert, dass die Vertreter der CDU und der CSU einen erklärten Liberalen – und als solcher galt Erhard damals schon – überhaupt akzeptierten. »Entweder«, so hat Gerold Ambrosius diese Tatsache zu erklären versucht, »bestand eine erhebliche Unkenntnis über die Persönlichkeit des neuen Wirtschaftsdirektors, oder man hielt den Handlungsspielraum für eine gezielte Wirtschaftspolitik schlichtweg noch für zu begrenzt.«32
Schon sehr bald sollte Ludwig Erhard, der am 6. April 1948 den geschäftsführenden Walter Strauss ablöste, dem Wirtschaftsrat und der deutschen Öffentlichkeit die Grundzüge seiner wirtschaftspolitischen Vorstellungen offenlegen und damit alle eventuell noch vorhandenen Unsicherheiten bezüglich seiner Position beseitigen. Bevor er das aber tat, erklärte er den mehr als 3000 Beamten und Sachbearbeitern seiner Riesenbehörde zur Planung und Lenkung der bizonalen Wirtschaftspolitik, dass es das Hauptziel seines Handelns sei, die Bewirtschaftung abzuschaffen und den Großteil von ihnen damit leider überflüssig zu machen und in andere Aufgabengebiete zu entlassen. Der eine oder andere wird das gewiss mit leichtem Frösteln vernommen haben.
Mit seiner Konzeption vor den Wirtschaftsrat und damit vor die Öffentlichkeit trat er mit der berühmten Grundsatzrede vom 21. April. Nach seiner Wahl war er im Übrigen nicht bei den Fraktionssitzungen der FDP erschienen, obwohl er aus dem Radio die freudige Nachricht vernommen hatte, dass die Liberalen Wort gehalten und seine Ernennung durchgesetzt hatten, sondern immer häufiger bei den Sitzungen der CDU/CSU-Fraktion. Das wurde natürlich registriert. Auf eine entsprechend besorgte Anfrage aus dem bayerischen Landesverband, auf welchem politischen Ticket Ludwig Erhard denn nun eigentlich reise, antwortete Thomas Dehler am 12. März denn auch merklich frustriert: »Dr. Erhard ist nicht Mitglied der Freien Demokratischen Partei. Er ist einer der Leute, die uns ›nahestehen‹. Es gibt tausende solcher Männer. Wir lieben sie nicht. Aus ihnen rekrutiert sich das Heer der ›Mitläufer‹, die schon immer eine verhängnisvolle Rolle gespielt haben.«33 Das war eine Momentaufnahme der Bitterkeit. Erhard und Dehler fanden dennoch später zu einem kollegial-freundschaftlichen Umgang miteinander. Erhard wusste allerdings, dass er zur Durchsetzung seiner umfassenden wie stark umstrittenen Pläne stärkere Bataillone als die der FDP benötigte. Daher begann er, sich auf die Seite der Union zu schlagen, suchte aber die Liberalen, die ihm sachlich-inhaltlich natürlich näherstanden, darüber nicht allzu heftig zu verprellen.
Die deutsche Wirtschaftsordnung der unmittelbaren Nachkriegsjahre hat der Journalist Michael K. Caro ebenso drastisch wie treffend einen »Bastard aus Kriegswirtschaft und Planwirtschaft« genannt.34 Ein gesetzlich vorgeschriebener Preis- und Lohnstopp – in Deutschland bereits im Oktober 1936 dekretiert – blockierte auch nach der Zerschlagung des Dritten Reichs zusammen mit den umfassenden zentralen Bewirtschaftungsmaßnahmen weiterhin jedes marktwirtschaftliche Funktionieren. Nun kam noch erschwerend hinzu, dass sich alliierte und deutsche bürokratische Vorschriften zunehmend wechselseitig behinderten. Die Kriegs- und Rüstungswirtschaft rasch und möglichst reibungslos den neuen Erfordernissen der Friedenszeit anzupassen war jedenfalls bis dahin nahezu vollständig missglückt. Die Versorgung der Bevölkerung selbst mit dem Notdürftigsten war keineswegs sichergestellt. An den einfachsten Dingen fehlte es. Nahrungsmittel, Zahnbürsten, Seife, Schnürsenkel, aber auch Wohnraum, Fensterglas und Fahrräder – Mangel allenthalben. Die industrielle Produktion hatte 1948 gerade erst wieder etwa 50 Prozent des Standes von 1936 erreicht, obwohl die Industrieanlagen im Land nicht komplett, sondern »nur« zu etwa 25 bis 29 Prozent zerstört waren. Allerdings verlängerten und vertieften die alliierten Demontagen vielerorts das Verlustpotential, besonders in der sowjetisch besetzten Zone, die ohnehin durch die dort eingeleiteten sozialistischen Beschlagnahmungen, Kontensperren und Verstaatlichungen in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung um Jahre, ja Jahrzehnte zurückgeworfen werden sollte. Wer arbeitete, tat dies aber in allen vier Zonen unzureichend ernährt, denn nur mit Mühe konnten die Menschen ihren täglichen Kalorienbedarf decken. Was unter diesen Umständen produziert wurde, gelangte außerdem nicht in jedem Fall auf den Markt. Waren wurden zurückbehalten, gehortet, weil die im Zuge der Kriegsfinanzierung bedenkenlos aufgeblähte Geldmenge massiv an Wert eingebüßt hatte – das Gesetz des Tauschhandels, des grauen, schwarzen Marktes galt weiterhin mit Zigaretten als der einzig wirklich akzeptierten stabilen Währung.35
Was schlug Erhard in dieser düsteren Situation vor, welche Rezepte hielt er bereit, als er sieben Wochen nach seiner Wahl zum Direktor der Verwaltung für Wirtschaft am 21. April 1948 mit seiner ersten großen programmatischen Rede vor den Wirtschaftsrat trat? Bezeichnenderweise umriss er zunächst seine ganz persönliche Auffassung von seinem neuen Amt: »Wenn ich dieses Amt übernahm, so geschah es in dem Bewußtsein, daß in unserer Lage weder die gemeine Erfahrung noch Verwaltungsroutine zur Meisterung der anstehenden Probleme ausreichen, sondern daß nur die aus praktischer Erfahrung und wissenschaftlicher Erkenntnis fließende tiefere Einsicht in die sehr komplexen gesellschaftswirtschaftlichen Zusammenhänge dazu befähigen kann … das vielleicht sogar chaotisch anmutende Geschehen zu entwirren und sinnvoll zu ordnen.«36
Eine für Erhard ungemein charakteristische Aussage, ja ein Kern- und Schlüsselsatz. Das Missionarische, sein Sendungsbewusstsein tritt hier bereits hervor.37 Erhards Leitmotiv und Legitimation zugleich: die wissenschaftlichtiefere Erkenntnis, die daraus resultierende Fähigkeit zur richtigen Diagnose, zur Heilung gesellschaftspolitischer Krankheitsprozesse. Der Verwaltungsroutine – der Stachel der bayerischen Vorwürfe saß tief – und nüchternem politischem Pragmatismus erteilte er eine deutliche Abfuhr; sie konnten in kritischen Situationen nicht weiterhelfen, mochten sie in der alltäglichen politischen Praxis auch noch so angebracht sein. Nein, in schwierigen Zeiten brauchte man aus tieferen Quellen gespeiste Ideen, konnte man das Chaos nur durch kühne Visionen bannen, zu einer neuen Ordnung fügen. Und Erhard ließ kaum einen Zweifel daran, dass er die dafür erforderlichen Qualitäten besaß.
Sein Rezept war einfach und klar: Umstellung der Industrie auf Konsumgüterproduktion, weil »der letzte Zweck allen Wirtschaftens nur der Verbrauch sein kann«38 und dadurch die Produktivität der menschlichen Arbeitskraft besser gesteigert werden würde als durch jede andere Maßnahme; Bejahung des Wettbewerbs, »rasche Auflockerung der Bewirtschaftung«39 – natürlich in Verbindung mit einer Währungsreform, deren brutale Auswirkungen durch einen Lastenausgleich gemildert werden sollten. Auch die großzügige Unterstützung durch die einsetzende Hilfe des Marshallplanes, die ERP-Gelder, bezog Erhard in seine Überlegungen mit ein.
Besonders geschickt argumentierte er, als er sich in den letzten Passagen seiner Ansprache mit der von ihm abgelehnten Planwirtschaftskonzeption auseinandersetzte. Er machte deutlich, dass die Verwirklichung des föderalistischen Prinzips – wofür ja nicht nur auf deutscher Seite viele votierten, sondern, weitaus entscheidender, die Alliierten, vor allem Briten und Franzosen – sich mit dem Gedanken der Planwirtschaft, der ein hohes Maß an Zentralisierung unabdingbar voraussetze, überhaupt nicht vereinbaren lasse.
Abschließend griff Erhard dann die berühmten Sätze von Walther Rathenau auf – »Es wird der Tag kommen, wo das Wort lautet: Die Wirtschaft ist das Schicksal. Schon in wenigen Jahren wird die Welt erkennen, daß die Politik nicht das letzte entscheidet«40 – und verknüpfte sie mit seinen eigenen Erwartungen und Handlungsanweisungen:
»Heute droht uns die Wirtschaft wieder einmal zum Schicksal zu werden. Diese These ist immer Ausdruck der Not, aber sie darf nicht anerkannter Grundsatz sein. So wie der einzelne Mensch des physischen Lebens bedarf, um jene geistigen und seelischen Kräfte entfalten zu können, die ihn erst zum Menschen werden lassen, so bedürfen auch ein Volk und seine Volkswirtschaft der materiellen Sicherung, aber sie bedürfen dieser auch nur als Grundlage zur Entscheidung außerökonomischer, höherer Ziele, deren Setzung der Staatspolitik obliegt. Ihr Vorrang ist unbestritten.
Ihnen als den berufenen Vertretern einen Weg in eine neue Zukunft aufzuzeigen, in unserem Volke noch einmal den Glauben zu wecken, daß es nicht nur fatalistisch hoffen, sondern zuversichtlich an eine Wende glauben darf, wenn wir gemeinsam alle Energien auf dieses eine Ziel des zu neuer Wohlfahrt Gesundenwollens hinlenken, das sah ich vor den entscheidenden Ereignissen dieses Jahres 1948 als meine Aufgabe an. Wir glauben nicht an Wunder und dürfen solche auch nicht erwarten. Umso größer aber ist die Gewißheit, daß die ausschließlich friedlichen Zwecken und der Mehrung der sozialen Wohlfahrt zugewandte Arbeit eines fleißigen Volkes in enger Gemeinschaft mit der übrigen Welt Früchte zeitigen und es aus seiner Not erlösen wird. Aus rauher Gegenwart eröffnet sich ein versöhnlicher Ausblick in eine für unser Volk wieder glücklichere Zukunft.«41
Was für ein wirkungsvoller, optimistischer, für Erhards Reden durchaus typischer Schluss. Zugleich ein Abschnitt, der wie im Falle der bereits zitierten Einleitung Grundsätzliches über Erhards Haltung verrät. Primat der Wirtschaftspolitik? Nein, niemals auf Dauer, nur temporär. Jetzt, in der Situation des Jahres 1948, in der Not, in der Krise war es allerdings erste und vordringlichste Aufgabe des Staates, seinen Bürgern wieder wirtschaftliche und soziale Sicherheit zu vermitteln – erst dann konnten weitere, außerökonomische Zielsetzungen formuliert werden. Würde man klug die wirtschaftlichen Voraussetzungen schaffen, so dürfe man, das machte Erhard auf überzeugende Weise deutlich, hoffnungsfroh in die Zukunft blicken.
Die Delegierten des bürgerlichen Lagers im Wirtschaftsrat zeigten sich von dieser Rede tief beeindruckt. Die Suggestivkraft Erhards, die sich im Nachhinein dem Leser seiner häufig verschachtelt formulierten Ansprachen kaum mehr erschließt, seine Begabung, Zuhörer in seinen Bann zu ziehen und in eine angenehm-harmonische Stimmung zu versetzen – wobei ihm die tiefe Stimme, das fränkische Idiom gute Dienste geleistet haben –, offenbarte sich den Sitzungsteilnehmern in Frankfurt zum ersten Mal.42
Hocherfreut begrüßte der spätere FDP-Vorsitzende Franz Blücher Erhards »klares Bekenntnis zum neoliberalen Gedanken«.43 Wirtschaftspolitik schien bislang eine Domäne der Sozialdemokraten gewesen zu sein, die ja nicht umsonst alle Wirtschaftsminister in den Ländern der Bizone stellten. Sollte sich hier nun endlich eine Wende abzeichnen? Sollte mit Ludwig Erhard ganz unverhofft ein »bürgerlicher« Fachmann in den Vordergrund rücken können, der über das Format, die Fähigkeit und ökonomischen Kenntnisse verfügte, ihnen eine eigenständige marktwirtschaftliche Konzeption entgegenzusetzen?
Aber nicht überall stießen Erhards Visionen auf Begeisterung. Der Zeitgeist war links damals, das Vertrauen in einen allmächtigen Staat groß und weitverbreitet – bei den sowjetischen, englischen und französischen Besatzungsoffizieren ebenso wie bei den besetzten Deutschen. Wer sollte die Menschen vor den Risiken des Alltags denn sonst noch schützen, wenn nicht der Staat. Demgegenüber verhießen Erhards Freiheitsvisionen und -versprechungen allenfalls noch mehr Unsicherheit und Alltagskampf. Die überwältigende Mehrheit der Menschen konnte sich damals einfach nicht vorstellen, dass die Wirtschaft nach einer Aufhebung der Beschränkungen und umfassenden staatlichen Lenkungsmaßnahmen weiter und sogar sehr viel besser funktionieren würde. Ganz typisch mag hier die Reaktion von Marion Gräfin Dönhoff, immerhin einer promovierten Volkswirtin, gewesen sein, die, nachdem sie im Frühjahr 1948 bei einer Pressekonferenz Erhards in Frankfurt einen ersten Eindruck von ihm gewonnen und seine Vorstellungen kennengelernt hatte, ihren Redaktionskollegen bei der ZEIT in Hamburg entsetzt berichtete: »Wenn Deutschland nicht schon eh ruiniert wäre, dieser Mann mit seinem absurden Plan, alle Bewirtschaftung aufzuheben, der würde es ganz gewiß fertigbringen. Gott schütze uns wirklich davor, daß der einmal Wirtschaftsminister wird. Das wäre nach Hitler und der Zerstückelung Deutschlands die dritte Katastrophe.«44