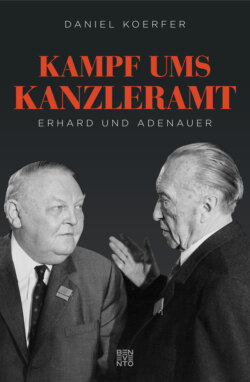Читать книгу Kampf ums Kanzleramt - Daniel Koerfer - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ENTTÄUSCHTE ERWARTUNGEN – DER BRUCH MIT VERSHOFEN
ОглавлениеKontaminiert war für Ludwig Erhard im Rückblick wohl auch seine enge Zusammenarbeit mit Gauleiter Josef Bürckel, dem Reichsstatthalter der Westmark und Chef der Zivilverwaltung in Lothringen und der damit eng verknüpfte Zerrüttungsprozess des Vertrauensverhältnisses zu Institutschef Wilhelm Vershofen. Auch darüber hat er nach dem Krieg weitgehend den Mantel des Schweigens gebreitet, nachdem er den Amerikanern gegenüber seine Beratertätigkeit bei den ersten Kontakten intern offengelegt hatte. Die Aufträge von Bürckel hatten vielfach seine manchmal kürzere, manchmal längere Präsenz vor Ort an der Saar oder in Lothringen erforderlich gemacht und dort immer wieder zu ganz unterschiedlichen neuen Kontakten geführt. Einer davon war der zu Paul Schweitzer, dem Generaldirektor der Glashütten von Vallerysthal in Portieux und Bruder des berühmten Theologen und späteren Dschungelarztes Albert Schweitzer gewesen. Erhard wird nach dem Krieg von einer dort entstandenen persönlichen Freundschaft zur Familie des von ihm bewunderten Albert Schweitzer sprechen und im Frühjahr 1945 gegenüber dem amerikanischen Stadtkommandanten von Fürth Paul Schweitzer zugleich als Zeugen dafür anführen, dass er in der NS-Zeit während seiner Beratertätigkeit seinen Einfluss zum Schutz von politisch bedrängten Personen – in diesem Falle wohl von Zwangsarbeitern in den regionalen Industriebetrieben – geltend gemacht hatte.1
Wie erwähnt gingen mit seiner Beratertätigkeit in Elsass-Lothringen längere Abwesenheiten vom Institut in Nürnberg einher. Seine ausgeprägte Reisefreudigkeit, die später auch Adenauer mehrfach monieren wird, wurde bereits 1940 oder 1941 in der jüngst wieder entdeckten Weihnachtszeitung des Instituts von seinen Mitarbeitern in einem kleinen Gedicht persifliert: »Der Ludwig, der hat das Leben schon raus!/ Der ist jetzt in ganz Europa zu Haus!/ Mal Wien und mal Prag, mal Danzig und Metz,/ Bei Gott, ach Kinder, ist das eine Hetz!/ Und wird ihm das Treiben im Saarland zu mies,/ Dann steigt er ins Auto und fährt nach Paris./ Paris – ach Ludwig, mir wird für Dich bang …/ Bist Du dort nicht zu sehr fürs Amüsemang?/ Fleuch Ludwig, fleuch diesen Höllenpfuhl!/ in Fürth ist die Nachtigall – in Paris nur die Uhl!«2
Tatsächlich hatten die Reiseaktivitäten Erhards im Krieg stark zugenommen, weil es zunehmend Aufträge in den deutschen Besatzungsgebieten zu bearbeiten galt. Da es aber im Falle von Bürckel nicht um ein einziges Gutachten, sondern um eine kontinuierliche Beratung gehen sollte, hatte er sich bereits im Juni 1940 vom Nürnberger Oberbürgermeister Willy Liebel als Verantwortlichem der städtischen Institutsaufsicht seine »Nebentätigkeit« offiziell genehmigen lassen, um im Auftrag des Reichsstatthalters vor Ort die Wiederingangsetzung der saarpfälzischen Industrie und der gesamten dortigen Wirtschaft voranzubringen. Dafür sollten zunächst etwa zwei Tage pro Woche in Neustadt reserviert sein, später wurden daraus Aufenthalte im vierzehntägigen oder dreiwöchigen Rhythmus. Obwohl Erhard über seine spezifischen Tätigkeiten vage blieb – »die mir auferlegte Verpflichtung verbietet mir, nähere Ausführungen über Art und Umfang zu machen«, schrieb er Liebel am 15. Juni 1940 –, wurde die Übernahme des Auftrags und damit die Nebentätigkeit am 20. Juni genehmigt.3
Dass der Auftrag von Bürckel keineswegs »gemeinnützig«, sondern mit monatlich 1200 Reichsmark brutto dotiert war, wodurch sich sein Gehalt in etwa verdoppelte und sich das Aufgabenfeld bald auch auf Lothringen erstreckte, verschwieg er allerdings zunächst. Erst ein Jahr später, am 27. Oktober 1941, räumte er es gegenüber Bürgermeister Eickemeyer ein, der nun anstelle von Liebel in Nürnberg die Stiftungsaufsicht führte, einem überzeugten Nationalsozialisten, der 1941 zum SA-Gruppenführer (i.e. General) befördert und parallel zu seinem Oberbürgermeisteramt von Albert Speer als Leiter des Zentralamts ins Rüstungsministerium nach Berlin berufen worden war. Dem Brief hatte Erhard als Rückendeckung eine Liste beigefügt mit Adressaten im NS-Apparat, denen seine Gutachten von der HTO übermittelt würden. Sie umfasste fast alle von Hitlers Ministern, angefangen bei Göring, über Ribbentrop, Frick, Goebbels, Schwerin von Krosigk, Darré, Rosenberg, Seldte, Rust, Todt, Kerrl, Frank, Schacht bis Seyss-Inquart, ferner die Staatssekretäre Körner, Landfried, Pfundtner, Stuckardt und Neumann sowie Reichsorganisationsleiter Dr. Ley, Reichsführer SS Himmler und den Bevollmächtigten für Siedlungsfragen Major Lindmar, dazu noch den Generalinspektor für Wasser & Energie, Direktor Katzmann.
So eindrucksvoll diese Liste auch erscheinen mochte, ein wirksamer Schutzschild wurde nicht daraus. Denn Erhard wurde trotzdem aufgefordert, die Nebeneinnahmen nach Abzug seiner Reisekosten an die Stiftungskasse abzuführen. Doch dagegen wehrte er sich. Er schrieb am 13. Dezember 1941 an Eickemeyer: »Die Besonderheit meiner Stellung in Lothringen mag z.B. durch den Hinweis illustriert werden, daß mir durch den Gauleiter die Aufgabe gestellt wurde, Maßnahmen in Vorschlag zu bringen, in Ansehung der derzeitigen Lage die weitere rasche Einschaltung der lothringischen Industrie für den Rüstungseinsatz sicherzustellen. Aufgaben dieser Art dürften nach meinem Dafürhalten wohl erheblich von den üblichen Normen einer Nebentätigkeit von Angestellten im öffentlichen Dienst abweichen. Aus diesem Grund lehnte es auch der Chef der Zivilverwaltung und Gauleiter Bürckel ab, das Institut mit der Beratung zu beauftragen, weil er nicht auf dessen Meinung, sondern auf meine persönlichen Kenntnisse Wert legte.«
Als Eickemeyer als Vertreter der Stiftungsaufsicht dennoch im Februar 1942 in der Eskalationsphase des Streits zwischen Vershofen und Erhard die Nebentätigkeitsgenehmigung widerrief, intervenierte schließlich Bürckel und erklärte gegenüber der Nürnberger Aufsicht, nach seiner Auffassung sei die Tätigkeit Erhards überhaupt nicht genehmigungspflichtig, weil kein Angestelltenverhältnis vorliege, sondern es sich um eine wissenschaftliche Gutachtertätigkeit handele. Daraufhin wurde die Aufhebung zurückgezogen. Die persönliche Verbindung zwischen Erhard und Bürckel war de facto also recht eng.
Doch Erhard betonte nicht allein die persönlichen Verbindungen, sondern auch sein fachliches Renommee und erinnerte an die bereits erwähnte »Ostmark-Blitzstudie« als wichtigen Ausgangspunkt, als er während der Auseinandersetzung im Februar 1942 an Eickemeyer schrieb, er habe »den Auftrag von Reichskommissar Bürckel lediglich deshalb bekommen, weil die unter meiner Leitung durch das Institut durchgeführte Ostmark-Untersuchung, die auch von mir berichtsmäßig niedergelegt wurde, so hohe Anerkennung fand, daß Herr Gauleiter Bürckel nach seinen eigenen Worten den größten Wert darauf legte, sich auch in Zukunft meines Rates und meiner Gutachten zu bedienen«.4
Insgesamt war die Kooperation mit Bürckel nicht nur für Erhard profitabel, sondern auch für das Institut. Für die Wirtschaftsberatung in der Ostmark vermeldet Erhard 1940 Vershofen stolz eine Einnahme von 18 000 Reichsmark. Im Zeitraum von 1940 bis zu Erhards Ausscheiden aus der Geschäftsführung im Frühjahr 1942 lag allerdings wohl tatsächlich in Lothringen das wichtigste Einsatz- und damit auch Einnahmefeld, wie eine erhalten gebliebene Übersicht über alle Berichte und Gutachten des Instituts zwischen 1935 und 1943 zeigt. Erwähnt werden dort nach dem großen zweigeteilten Hauptbericht »Marktanalyse« (Teil I Markt, Teil II Volk & Wirtschaft) vom Sommer 1940 weitere Berichte und Gutachten über die dortigen Glasereien, die Glasindustrie mit Glasschleifereien, die Teerdestillation und Ziegeleien (jeweils im Oktober 1940), Kalkindustrie und Metallwaren »mit kriegswirtschaftlichen Auswirkungen« sowie Werkstoffverfeinerungen und Metallwaren (jeweils Januar 1941), Stahl- und Eisenbau (Mai 1941) oder Uhrengläser – einer der wenigen Aufträge für die Privatindustrie – aus dem März 1942.
Bürckel und sein Stab erwiesen sich aber auch als hilfsbereit und hilfreich, wenn es darum ging, Mitarbeiter des Instituts vor dem Fronteinsatz zu bewahren oder von dort zurückzuholen – ein in der Korrespondenz zwischen Erhard und Vershofen vielfach behandeltes Dauerproblem. Der im Vorkapitel erwähnte Dr. Binder war keineswegs ein Einzelfall. So kann Erhard am 31. Mai 1940 dem einmal mehr in seinem Domizil in Tiefenbach bei Oberstorf im Allgäu weilenden Vershofen mitteilen, »Herrn Dr. Böhmer, der wieder zum Heeresdienst zurückberufen wurde, hofft Herr Bürckel durch ein persönliches Schreiben an den Kommandeur des XVII. Wehrkreises, General Carl-Heinrich von Stülpnagel, freibekommen zu können und außerdem möchte er aus unserem Haus noch einen weiteren Mitarbeiter.«5
Bürckel legte sich hier also wirklich ins Zeug und nutzte seine Verbindungen auf höchster Ebene, um dem Institut zu helfen, in diesem Fall zu General Carl-Heinrich von Stülpnagel, der nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 hingerichtet werden sollte. In einem anderen Brief von Erhard an Vershofen vom 26. Oktober 1940 heißt es: »In der Zwischenzeit bemühe ich mich weiter, Mitarbeiter des Institutes vom Heeresdienst freizubekommen, denn wir werden sehr gedrängt, in Lothringen eine weitere wichtige Untersuchung durchzuführen, die darauf abzielt, die wirtschaftlichen und organisatorischen Voraussetzungen für die Einschaltung von Lothringer Betrieben zur Rüstungserzeugung zu schaffen. Im Augenblick können wir beim besten Willen keine Leute freistellen, obwohl mir ausdrücklich gesagt worden ist, daß die Frage der Finanzierung keine Rolle spiele.« Bürckel war offenbar bereit, diese Argumentation zu unterstützen und die Arbeiten obendrein noch finanziell großzügig zu honorieren, wie Erhards Zeilen andeuteten.
Ein Bild aus fröhlichen Institutstagen – Ludwig Erhard und Wilhelm Vershofen kräftig paffend um 1938.
Dennoch begann die enge Zusammenarbeit Erhards mit Bürckel zunehmend das Verhältnis zu Vershofen zu belasten. Der Institutschef, der sich in Nürnberg als Hochschullehrer bereits zum Wintersemester 1936/37 in den Ruhestand hatte versetzen lassen und 1939 emeritiert wurde, war gesundheitlich angeschlagen und über längere Phasen nicht im Institut anwesend, sondern zur Kur oder in seinem Haus in Tiefenbach im Allgäu. Umso mehr war er auf die Präsenz seines umtriebigen Stellvertreters vor Ort angewiesen und registrierte mit wachsender Sorge dessen vielfältige Abwesenheiten, besonders natürlich seine Aufenthalte im Saarland und in Lothringen.
Bereits in einem langen Brief an Erhard vom 12. Juni 1940 klingen die Bedenken an, wobei Vershofen einleitend betont, »daß mich die Hochschätzung, die Herr Reichskommissar Bürckel unserer Arbeit entgegenbringt, sehr gefreut hat und ich auch Ihnen persönlich zu diesem Erfolg, an dem Sie wesentlich beteiligt sind, Glück wünsche«. Anschließend rühmt er die einzigartige »Zwischenstellung« des Instituts und seine Mittlerfunktion zwischen »der wirtschaftlichen Praxis, den privatwirtschaftlichen Unternehmen und den Behörden verschiedenster Art«, äußert aber auch die Sorge vor einer Verstaatlichung durch das NS-Regime und kommt dann auf die große Bedeutung von Erhard für die Institutsarbeit zu sprechen:
»Ich habe deshalb nur zögernd und nicht ohne Bedenken zustimmen können, daß Sie zwei Tage in der Woche in Neustadt tätig sind. Eine Erweiterung dieses Zeitraumes kann auf keinen Fall in Frage kommen, sofern nicht Ihre Funktionen im Institut eingeschränkt werden müßten. Und das wäre weder von meinem, noch von Ihrem, noch vom Standpunkt des Instituts erwünscht. Ich möchte ausdrücklich … festhalten, daß wenn sich eine irgend geartete Störung der Institutsarbeit ergeben sollte, Sie Herrn Bürckel um Entpflichtung würden bitten müssen. Ich hoffe sehr, daß es zu dieser unangenehmen Notwendigkeit nicht kommen wird und verspreche mir, genau wie Sie, aus der neuen und vorübergehenden – zunächst auf ein halbes Jahr festgelegten – Tätigkeit eine Förderung des Ansehens und eine Erweiterung des Wirkungskreises unseres Institutes.«
Dem Brief hatte Vershofen noch ein bemerkenswertes Postscriptum zum Thema Freistellungen hinzugefügt: »Wäre es nicht möglich, daß wir angesichts der neuen Sachlage nicht den einen oder anderen, vielleicht sogar mehrere unserer eingezogenen Mitarbeiter reklamieren könnten? Damit würde meinen Bedenken wenigstens zu einem gewissen Grad Abbruch getan werden.«
In seiner Antwort vom 4. Juli 1940 versucht Erhard auf vier eng beschriebenen Seiten, Vershofens Sorgen zu zerstreuen, verweist auf zwei gerade abgeschlossene, von ihm selbst vor der Absendung durchgesehene und sorgfältig redigierte große Untersuchungen zur Porzellan- und Metallwarenindustrie und fährt dann fort:
»Tatsächlich führt meine Abwesenheit von Nürnberg nicht, wie es Ihnen vielleicht erscheinen mag, zu einer Lockerung der Arbeit dergestalt, daß ich die Überwachung nicht mehr im bisherigen Maße besorgen könnte. Ich weiß vielmehr immer sehr genau Bescheid, mit welchen Aufgaben einzelne Mitarbeiter betraut sind und welche Zeit ihnen dafür zur Verfügung gestellt werden muss … Das ganze dynamische Geschehen unserer Zeit führt ja auch zwangsläufig dahin, daß der Außendienst des Instituts immer umfangreicher und zunächst auch wichtiger wird … Wir wissen ja, wie wichtig es war, daß das Institut Anschluß an die kriegswirtschaftlichen Aufgaben fand und daß es damit sicherlich auch sehr günstige Voraussetzungen für die kommende Friedensgestaltung geschaffen hat. Was meine Tätigkeit in der Pfalz und in Lothringen anlangt, so beginnt sich dies ja auch bereits für das Institut nutzbringend auszuwirken. Im übrigen bin ich schon jetzt dabei, meine Tätigkeit dort so zu beschränken, daß auf je drei Wochen nur zwei Reisen von mir notwendig werden … Daß Sie diesmal offenbar etwas unbefriedigt Nürnberg verlassen haben, bedaure ich sehr, weil ich mir selbst wirklich keine Sorgen und keine Arbeit erspare, um das Institut so gut durch den Krieg zu führen, als es eben möglich ist. Ich bin aber auch beruhigt und zuversichtlich, weil ich weiß, daß wir durchaus einer Meinung sind und daß wir das Institut nach dem Krieg deshalb auch wieder so bauen und gestalten wollen, wie es Ihnen vorschwebt … Ich bitte Sie also nochmals, über das Schicksal des Instituts in der nächsten Zeit wirklich beruhigt zu sein, wobei meinerseits hinter dem Wunsche auch die Zuversicht steht, daß Sie wirklich Grund haben, es zu sein.«
Allein, Vershofens Sorgen wuchsen, zumal ihm gegenüber Erhard am 24. Februar 1941, nachdem er seine in der Tat eindrucksvolle Akquisetätigkeit hatte Revue passieren lassen, in schöner Offenheit und Selbsterkenntnis eingeräumt hatte: »Sie wissen ja, daß ich ein durchaus unbürokratisch eingestellter Mensch bin, darin liegt sowohl mein Verdienst als auch meine Schuld.« Darüber sollte sich ja später dann auch Konrad Adenauer noch des Öfteren ärgern. Tatsächlich verlief die sich hier anbahnende Entfremdung zwischen Vershofen und Erhard nach einem ganz ähnlichen Muster wie später die Entfremdung zwischen dem ersten Kanzler der Bundesrepublik und seinem Wirtschaftsminister und Vizekanzler. Beide Male steht am Anfang eine nach außen hin erfolgreiche, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Beide Male ist der deutlich jüngere Erhard den zwanzig Jahre Älteren – Vershofen ist 1878 geboren, Adenauer noch zwei Jahre früher – in Verehrung zugetan, äußert dies auch in blumigen Formulierungen. Beide Male hofft er auf eine gleichberechtigte, kooperative Partnerschaft. Doch beide Male wird diese Hoffnung ebenso bitter enttäuscht wie die Erwartung, mit dem Segen der Vaterfigur die Nachfolge antreten zu können. Und in beiden Fällen spiegelt sich all das in umfangreichen, ausführlichen Briefwechseln, wobei das im Falle Vershofen nur ein kleiner Ausschnitt belegen soll.
Ein anschauliches Beispiel für den sich verschärfenden, durchaus an den Ton mancher Adenauer-Briefe erinnernden Duktus von Vershofen bietet etwa der dreiseitige Brief vom 24. Oktober 1941. Vershofen war die Zusammenarbeit seines ersten Stellvertreters und Geschäftsführenden Leiters mit Bürckel mehr und mehr ein Dorn im Auge. Mittlerweile geht es darum, dass Erhard trotz seiner Zusage, die Zusammenarbeit spätestens im April 1941 zu beenden, dies immer noch nicht getan hat, wie dem Institutschef durch einen Zufall bekannt geworden war. Vershofen schreibt:
»… noch immer ist diese Ihre, nicht von mir, sondern von der Stiftungsverwaltung bewilligte Nebentätigkeit nicht beendet. Ich kenne die höheren Umstände und Bedingungen dieser Ihrer Nebentätigkeit bis zum heutigen Tage nicht. Ich weiß nur, daß Sie in dieser Zeit ganzberuflich für das Institut tätig sein müssen … Daß ich diese Nebentätigkeit seit dem 14. Dezember 1940 nicht gebilligt habe, ist Ihnen bekannt … Sie scheinen mir persönlich noch zu stark an den Arbeiten im Saargebiet interessiert zu sein … Sie haben meine wiederholt mündlich und schriftlich gegebene Anordnung, mir alle Vertragsabschlüsse zur Gegenzeichnung resp. zur Bestätigung ohne Verzug zugänglich zu machen, überhaupt nie befolgt … Sie wissen, daß ich zur Kontrolle für mich mit Anordnung vom 2. März das Posteingangsbuch eingerichtet habe, das ich bei fast jeder Anwesenheit in Nürnberg genau durchsehe … Ich habe nun ›Überraschungen‹ … herzlich satt und ganz und gar nicht die Absicht, auf diesem Gebiet noch Weiteres zu erleben. Ich ordne deshalb folgendes an: Sie reichen mir jeweils Ende und Mitte eines jeden Monats Ihren Reiseplan ein, mit Datum des Reiseantritts, Dauer der Reise, Zweck der Reise, Anschrift des in Betracht kommenden Auftraggebers und Verhandlungspartners. Die Reise darf Ihrerseits nur angetreten werden, wenn Sie meine Zustimmung haben, die ich mir vorbehalte in der Regel fernmündlich zu erteilen.«
Konrad Adenauer wird derlei Weisungen später in seinen Briefen an den Wirtschaftsminister nicht wesentlich anders formulieren. Allerdings sind hier der Entfremdungsprozess und die Inkubationsphase bis zum Ausbruch der heftigen, in einem unheilbaren Zerwürfnis endenden Krise wesentlich kürzer, während sie sich im späteren Fall über Jahre hinziehen. Beide Male ist aber alles unauflöslich mit der zentralen Nachfolgeentscheidung verknüpft, denn auch diesmal, auch bei Vershofen, geht es im Kern darum – und auch hier zerbricht die Partnerschaft darüber. Insofern wirkt der eskalierende Institutsstreit wie ein seltsamer Prolog zum späteren Kampf ums Kanzleramt.
Unter dem Eindruck, dass Erhard sich nicht wirklich um die Anweisungen aus dem Allgäu kümmerte und Vershofen, wenn man so will, zunehmend auf der Nase herumtanzte, weil er glaubte, als Einwerber von Großaufträgen unersetzlich zu sein, reifte dessen Nachfolgeentscheidung. Dass es dabei auch um eine Richtungsentscheidung zwischen einem stärker praxisorientierten Institut, das Erhard anstrebte, oder einer von Vershofen favorisierten primär wissenschaftsorientierten Institution gegangen sein soll, wie bisweilen vermutet wird, lässt sich aus der Überlieferung nicht wirklich herauslesen. Es mag eine Rolle gespielt haben, war aber nicht entscheidend.
In dem gesundheitlich angeschlagenen Vershofen reifte jedenfalls im Herbst 1941 der Entschluss, sehr bald nach seinem 63. Geburtstag am 25. Dezember die Führung des Instituts in andere, jüngere Hände zu legen und den universitären und städtischen Entscheidungsgremien der Stiftungsverwaltung nicht seinen ersten Stellvertreter als Nachfolger vorzuschlagen. Stattdessen fiel seine Wahl auf Erich Schäfer, der, aus Leipzig nach Nürnberg zurückgeholt, im Januar 1942 zum ordentlichen Professor an der Handelshochschule ernannt und im April auf den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre berufen werden sollte. Die Leitung des Instituts hätte dadurch wie zuvor ein Professor inne – die Stiftungssatzung von 1938 sah das jedoch nicht zwingend, sondern nur »nach Möglichkeit« vor, was damals wohl eigens so formuliert worden war, um den »nur« promovierten Erhard nicht von vornherein auszuschließen. Allerdings war Schäfer einer, der das Institut gleichfalls mit aufgebaut hatte, dem es mit der Forschungsarbeit ernst war und der, anders als Vershofen und Erhard, vermutlich unter dem Eindruck von Blitzkrieg und Blitzsiegen am 1. Februar 1940 in die NSDAP eingetreten war.6 Ausgerechnet Schäfer, muss Erhard gedacht haben, waren sich beide doch in wechselseitiger Antipathie verbunden – Schäfer hatte nicht von ungefähr 1938 sein Ausscheiden aus dem Institut gegenüber Vershofen unter anderem mit der »völlig gewissenlosen Arbeitsschlamperei des Herrn Dr. Erhard« begründet.7
Vershofen hatte Erhard schon im Herbst 1941 mitgeteilt, dass er Schäfer an das Institut zurückzuholen beabsichtigte und Erhard wohl auch über vorbereitende Gespräche mit den Herren der Stiftungsaufsicht um Bürgermeister Eickemeyer in Kenntnis gesetzt, wo es um eine mit der Rückkehr verknüpfte Professur in Nürnberg gehen sollte. Erhard hatte am 10. September Vershofen wissen lassen, dass er »nach einer vorgesehenen Übergangszeit von zwei Jahren jede Ordnung gutheißen« würde, »die mich rangmäßig nicht hinter Herrn Prof. Schäfer stellt«8, also eine Art Doppelspitze für die zukünftige Institutsleitung angeregt. Allerdings müssen zur Weihnachtszeit Gerüchte im Institut kursiert sein, dass Vershofen sich nicht erst in zwei Jahren, sondern schon viel früher zurückziehen und dabei Schäfer zum alleinigen Nachfolger machen wolle. Nachdem Erhard in seinem handschriftlichen Glückwunsch- und Neujahrsschreiben vom 3. Januar nach der Zukunftsplanung Vershofens – und damit implizit nach seinen eigenen Zukunftsaussichten – gefragt hatte, schenkte ihm dieser bereits drei Tage später in einem eng beschriebenen vierseitigen Brief reinen Wein ein und fasste dabei seine Vorbehalte noch einmal zusammen. Für Erhard sollte es eine bittere Lektüre werden, ganz ähnlich wie fast zwanzig Jahre später die schonungslosen Briefe Adenauers, in denen ihm das Zeug für die Kanzlerschaft abgesprochen wurde.
»So habe ich Ihnen schon seit langem keinen Hehl daraus gemacht, daß ich Sie als meinen Nachfolger im Institut nur im Rahmen eines kollegialen Direktoriums empfehlen könnte«, eröffnete Vershofen seinem Stellvertreter. Weshalb? Wegen der »Übernahme und Dauer der Tätigkeit in Lothringen«. Wegen der Bereitschaft Erhards, in Abstimmung mit dem Reichwirtschaftsministerium auch noch die Leitung eines Instituts in Wien parallel zu seinen Nürnberger Verpflichtungen zu übernehmen und der damit verbundenen Vertragsverhandlungen, die offenbar schon weit gediehen waren und von denen Vershofen einmal mehr nur durch Zufall erfahren hatte. Wegen der »für Sie persönlich anfallenden Honorierungen«, die Erhard bekanntlich nicht immer offengelegt hatte und schließlich wegen »Nichteinhaltung von einer Reihe von Formvorschriften. Hier handelt es sich, wie Sie ja genau wissen, hauptsächlich darum, daß Sie Vertragsabschlüsse gemacht haben, ohne daß Sie die von mir vorgeschriebene Genehmigung, respektive Gegenzeichnung hatten«. Die neue »Leitung des Instituts einem kollegial zusammenarbeitenden Direktorium« anzuvertrauen – bei dem Erhard, so lässt sich wohl in diese Passage hineinlesen, dann trotz allem einen Platz hätte haben können – wäre zwar ihm, Vershofen, am zweckdienlichsten erschienen, »aber für diese Lösung war die Stiftungsverwaltung aus Gründen, die im wesentlichen formaler Natur, aber zwingend sind (Satzung der Stiftung) nicht zu haben«.
Vershofens gewundener und verschachtelter Text endet mit einer Passage, die nahelegt, dass er wohl selbst unzufrieden war mit dem, was er geschrieben hatte und vielleicht durch Erhards Fragen auch hatte schreiben müssen: »Mir scheint es im übrigen in dieser schicksalsschweren Zeit doppelt überflüssig, daß wir uns gegenseitig immer wieder so lange Briefe schreiben, die doch zum Teil aneinander vorbei gehen. Ein richtiges Wort zur richtigen Zeit kann uns Arbeitskraft und Nerven sparen. Ich denke, so sollen wir es bis auf weiteres halten und uns des Wahns begeben, als ob wir die Zukunft in dem Augenblick vorausbestimmen können, wo es unser persönliches Interesse zu verlangen scheint.« Er endete nicht wie früher mit »besten« oder »herzlichen«, sondern lediglich kühl mit »kollegialen Grüssen«.9
Tatsächlich beendete dieser Brief die Korrespondenz zwischen beiden. Ludwig Erhard wird nur noch einen einzigen persönlichen Brief an den Institutsleiter richten; für ihn war diese Entwicklung und Entscheidung von Vershofens ein schwerer Schlag. Vermutlich konnte er sich tatsächlich nicht vorstellen, dass Vershofen ausgerechnet ihn, der sich zweifelsohne mit ganzer Kraft dem Auf- und Ausbau des Instituts verschrieben hatte, tatsächlich nicht als Nachfolger einsetzen werde. Mit einem Mal war seine gesamte Zukunftsplanung abrupt über den Haufen geworfen. Er ist menschlich tief enttäuscht und verletzt. Und nimmt übel. Anders als bei Adenauer, wo der Bruch über Jahre hinweg gerade nach außen hin immer wieder notdürftig gekittet und verkleistert werden wird, ist das Tischtuch zwischen ihm und Vershofen rasch und nachhaltig zunächst intern und dann auch öffentlich sichtbar durchschnitten. Mit Schäfer war eine kollegiale Lösung nicht denkbar, so viel stand für Erhard schnell fest, und das muss auch Vershofen gewusst haben. Erhard hat wohl noch versucht, den Konkurrenten in einem Brief, der nicht erhalten geblieben ist, vom Wechsel von Leipzig nach Nürnberg abzuhalten. Und er suchte den in Nürnberg für die Stiftungsaufsicht verantwortlichen Bürgermeister Eickemeyer auf, erinnerte ihn an alte mündliche Zusagen bezüglich der Nachfolge, fragte vermutlich auch nach Gründen für die plötzlichen Vorbehalte gegen seine Bestellung. Seine Schritte wirkten wie ein Brandbeschleuniger, denn sie verkürzten den Entscheidungsprozess in den akademischen und städtischen Gremien.
An dieser Stelle kommt nun Luise Erhard ins Spiel. Sie erlebte die heftige Krise im Berufsleben ihres Ehemanns hautnah mit und versuchte sich als Feuerlöscherin. Für ihre stille Intervention wählte sie den Weg eines – nicht überlieferten – Briefes an die Frau von Professor Vershofen, weil sie völlig zu Recht fürchtete, dass das gute Verhältnis beider Ehemänner ebenso wie das enge Verhältnis der zwei Familien durch die Vorgänge irreparabel beschädigt werden würde. Naheliegenderweise reichte Frau Vershofen diesen Brief an ihren Mann weiter, sodass dieser am 11. März 1942 an Luise Erhard schrieb, justament, als die endgültige Entscheidung für die Berufung Schäfers in den zuständigen Gremien gerade gefallen war:
»Liebe Frau Erhard! … Den Anstoß zu der so verhältnismäßig plötzlichen Lösung gab ein Brief, den Ihr Herr Gemahl seinerzeit glaubte an Herrn Professor Schäfer schicken zu müssen und es dabei für nötig hielt, auch noch den Entwurf eines längeren Schreibens an die Stiftungsverwaltung beizufügen. Ein Entwurf, den er dann meines Wissens nicht abgeschickt hat, der aber höchst ungeschickt eine Reihe von Konsequenzen in Aussicht stellte, die von der Stiftungsverwaltung als Drohung angesehen und von Herrn Prof. Schäfer zum Anlaß genommen wurden, seine Absicht, nach Nürnberg zu kommen, einer Revision zu unterziehen. In diesem Stadium fühlte sich der Stiftungsverwalter in seiner Entscheidungsfreiheit getroffen und griff durch, indem er bestimmte, daß zu geschehen hätte, was inzwischen auch durch die Presse bekanntgeben worden ist … Die Lösung, wie sie die Stiftungsverwaltung herbeigeführt hat und herbeiführen mußte, kann mich persönlich auch nicht restlos befriedigen, bringt sie doch mit sich, daß ich eineinhalb Jahre früher als geplant aus der aktiven Leitung ausscheide. Wenn das auch bei meinem gegenwärtigen Gesundheitszustand als ein glücklicher Umstand zu bezeichnen wäre, so sind doch die Aufgaben, die dem Institut mit Kriegsende erwachsen, so einschneidende, daß ich lieber an ihnen noch entscheidend mitgewirkt hätte. Ich will Ihnen nicht vorenthalten, daß mir auch sonst Ihr Herr Gemahl, zumal seit dem vorigen Frühjahr, sehr viel Sorgen bereitet hat, obwohl mir von Zerwürfnissen nichts bewußt geworden ist, denn man kann die Nichtbeachtung von Anordnungen, die ich pflichtgemäß treffen mußte, kaum als Zerwürfnis bezeichnen. Dennoch habe ich, wenn ich mich selbst prüfe, keine persönliche Voreingenommenheit gegen ihn, die mich etwa seine positiven Qualitäten vergessen ließe und wäre selbst in diesem gegenwärtigen Stadium noch geneigt, mich mit ihm in eine Unterhaltung über eine Stellung in Wien einzulassen. Damit habe ich zugleich der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß sich die Angelegenheit auch nicht zu einem Zerwürfnis entwickeln möge.«10
Vershofens Hoffnung erfüllte sich nicht. Ganz im Gegenteil. Es setzte ein mehrmonatiger Rosenkrieg ein, der absurd anmutende Weiterungen beinhaltete. In der Vereinbarung mit Eickemeyer zur Beendigung seines Dienstverhältnisses vom 26. März hatte man sich zwar noch einvernehmlich darauf verständigt, dass Ludwig Erhard auf juristische Schritte wie etwa eine Feststellungsklage gegen die Ernennung Schäfers – ein Verstoß gegen Treu und Glauben? – verzichten, zum 1. April 1942 aus der Geschäftsführung ausscheiden und das Institut Ende September mit Ablauf seines Dienstvertrags ganz verlassen würde. Zugleich, auch das war Teil der Abmachung, sollte er in den verbleibenden Sommermonaten noch an der Fertigstellung der Ostuntersuchung, der großen Analyse des Zigarettenmarkts sowie der von der Gauleitung Wien in Auftrag gegebenen Untersuchung des Bierkonsums in der Ostmark mitwirken. Zum Abschied wurde ihm zudem noch das Kriegsverdienstkreuz Zweiter Klasse, das EK II verliehen, vermutlich, um ihn zu besänftigen.
Doch das alles half nicht wirklich. Denn Erhard wurde nicht müde, mit der Entscheidung zu hadern. Seine öffentlich formulierte Behauptung, er habe doch de facto schon lange die Leitung des Instituts innegehabt, wurde ihm vonseiten der städtischen Verwaltung als »Überheblichkeit« ausgelegt, und er wurde daraufhin von Eickemeyers Hauptreferenten Hans Rollwagen im Sommer 1942 gegenüber dem ausscheidungswilligen Institutsmitarbeiter Friedrich Halbmeyer als »Störenfried« bezeichnet, der den sozialen Arbeitsfrieden im Haus gefährde. Erhard seinerseits, dem diese Aussage sofort hinterbracht worden war, nannte den Amtsdirektor beim Oberbürgermeister der Stadt daraufhin einen Lügner und Verleumder – was ihm am 4. November 1942 eine Strafanzeige wegen Beamtenbeleidigung durch Bürgermeister Eickemeyer eintrug, der hinter den Kulissen, so etwa am 4. Februar 1943, bei dem Nürnberger Generalstaatsanwalt Dr. Bems auf eine zügige Verurteilung drängte. Tatsächlich wurde Ludwig Erhard daraufhin wegen Beleidigung rechtskräftig verurteilt.
Den Vorwurf des »Störenfrieds« in Zeiten der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, noch dazu im Krieg, eine nicht ganz ungefährliche Etikettierung, wollte Erhard aber nun doch nicht einfach auf sich sitzen lassen und strengte deshalb seinerseits im Frühjahr 1943 eine Beleidigungsklage gegen Rollwagen an. Über diese Gegenklage »auf Zurücknahme einer Äußerung« mit einem Streitwert von 5000 Reichsmark zu entscheiden, stellte das Landgericht Nürnberg-Fürth im Juni 1943 »mangels jeglicher Kriegsdringlichkeit und zur Vermeidung einer nicht vertretbaren Belastung des in kriegswichtigem Dienst der Stadtverwaltung eingesetzten Beklagten« zwar bis nach Kriegsende zurück, ganz so wie es Oberbürgermeister Liebel im Schriftsatz des städtischen Anwalts Gottfried Biemüller nahegelegt hatte.
Auch wenn es am Ende zu keinem Urteilsspruch kommen sollte, hinterließen die juristischen Auseinandersetzungen doch eine Fülle informativer Aktenspuren im Archiv der Stadt Nürnberg, auf die wir uns heute stützen können und in denen die Konflikte im Institut wie in einem Brennglas gebündelt aufscheinen. Am Ende des ausführlichen Schriftsatzes seines Fürther Anwalts Dr. Ernst Escher vom 28. Juni 1943 stand ein pathetisches Zitat Ludwig Erhards, mit dem er selbst das ihm verliehene EK II instrumentalisierte, um das Gericht für seine Sache einzunehmen: »Es ist mir unerträglich mit einem solchen Makel behaftet zu sein und ich müßte mich als unwürdig erklären, das mir nach meinem Ausscheiden verliehene Kriegsverdienstkreuz zu tragen, wenn ich mich während des Krieges tatsächlich als Störenfried betätigt hätte.«11
Bemerkenswert ist in diesem Kontext, dass Erhard sowohl seinem Gegner Rollwagen wie auch dem Gericht gegenüber relativ offen vom besonderen Gemeinschaftsgeist des Instituts sprach, der unter dem Eindruck der Eingriffe vonseiten der nationalsozialistischen städtischen Kontrollbehörde – also durch Liebel, Eickemeyer, Rollwagen – immer schwächer geworden sei. So schreibt er am 12. Oktober 1942 an Rollwagen, »der Geist, den die Mitarbeiter des Instituts vor Einführung der Stiftungsverwaltung verkörperten, und der sie damit vor der durch Sie und Ihre Organe ›kontrollierten‹ Ordnung verband, war der einer echten Gemeinschaft, die von hohem Idealismus beseelt, in freudiger Hingabe an eine Idee auf freizügigster Grundlage höchste Leistungen erzielte. Es mögen alle seit 1938 im Institut tätig gewesenen Mitarbeiter bezeugen, welche Erscheinungen und Personen nach ihrer Meinung die Schuld dafür tragen, daß dieser Geist immer mehr verlorenging. Ich jedenfalls habe dieses Votum am wenigsten zu fürchten … Deshalb stehe ich auch nicht an, Ihre Bemerkung (›ich sei ein Störenfried‹, D.K.) als Lüge und Verleumdung zu charakterisieren.«
Erhard war so verärgert, dass er ziemlich unvorsichtig ganz grundsätzlich den »freizügigen«, also »freiheitlichen« Geist des Instituts der »kontrollierten Ordnung« – sprich: Überwachung – durch die NS-Stadtverwaltung in Nürnberg gegenüberstellte, die auch nach der Amtsenthebung von Gauleiter Julius Streicher 1940 weiterhin zutiefst nationalsozialistisch geprägt war. Aber es ging auch um konkrete Vorgänge. Erhard erlebte während seiner Endphase im Institut die Zunahme des Überwachungsdrucks, wo Briefe und Äußerungen von ihm von Denunzianten sogleich den Aufsichtsstellen hinterbracht worden waren. Das spricht er in einem langen Schriftsatz vom 23. Dezember 1942 an die Amtsanwaltschaft Nürnberg in seiner »Strafsache 3 FLS 3669/42« erstaunlich offen, ja fast politisch naiv an, mit dem er sich gegen die von Rollwagen angestrengte Verurteilung wegen Beleidigung wehrt: »Die gesamte Geschäftsführende Leitung des Instituts vertrat den Standpunkt, daß eine wissenschaftliche Forschungseinrichtung nicht nach den Methoden einer städtischen Verwaltungsabteilung behandelt werden dürfe, und daß die Übertragung der dort vorherrschenden formalen Ordnung auf dieses Institut dessen Entwicklung hemmen müsse und in diesem Sinne verhängnisvoll sei. Alle Mitarbeiter des Instituts empfanden die seitens der Stiftungsverwaltung, und soweit mir bekannt ist, vornehmlich durch Herrn Amtsdirektor Rollwagen verfügte Arbeitsüberwachung durch subalterne Verwaltungsorgane als eine Art Bespitzelung, die in hohem Masse geeignet war, die bis dahin bestehende soziale Harmonie zu zerstören …«
Vershofen wiederum hatte Erhard bereits ab dem Frühjahr 1942 als ganz heftigen Störenfried betrachtet. Auch von ihm war das eine oder andere Material in denunziatorischer Absicht an die städtische Aufsicht weitergeleitet worden. Vershofen war hintertragen worden, wie Erhard zum Gegenschlag ausholte. Diese im Institut kursierenden Gerüchte wurden dem im Allgäu Weilenden unverzüglich hinterbracht und empörten ihn zutiefst, weil sie die Substanz der von ihm geschaffenen Einrichtung ganz unmittelbar zu bedrohen begannen. Ludwig Erhard suchte nach einer neuen Aufgabe und Führungsposition. Das bedeutete diverse Sondierungen, etwa bei dem mit der GfK vertraglich verbundenen Wiener Institut. Parallel dazu muss er aber auch schon den Plan verfolgt haben, ein eigenes Wirtschaftsforschungsinstitut zu eröffnen und damit der Nürnberger Einrichtung Konkurrenz zu machen. Aber das war es nicht, was Vershofen erboste, sondern die schlichte Tatsache, dass Erhard neben seiner Sekretärin Ella Muhr offenbar auch noch gleich eine ganze Reihe der besten Mitarbeiter abzuwerben und mitzunehmen trachtete: Dr. Gerhard Holthaus, Walter Hesse, der auf dem Außenposten in Metz weilte, Friedrich Halbmeyer und Dr. Albert Kerschbaum. Manpower mit wirtschaftlichem Sachverstand war in jenen Kriegszeiten schwer zu bekommen, ausscheidende Topleute mithin nur schwer zu ersetzen. Entsprechend zornig reagierte Vershofen – hinter den Kulissen. Am 27. Mai 1942 hatte er sich bei Amtsdirektor Rollwagen beschwert, der den an einer Gallenblasenentzündung laborierenden Eickemeyer als städtischen Stiftungsaufseher vertrat: »Herr Dr. Erhard hat neuerdings nach meiner letzten Anwesenheit in Nürnberg Mitarbeitern des Instituts wieder Angebote gemacht, in seine Dienste zu treten. Er hat ein Jahresgehalt von RM 10.000,– angeboten. Nachdem ich entsprechendes ›Benehmen‹ von Herrn Erhard schon früher gemeldet hatte, beweist dieses neue Vorgehen, daß er ganz zielbewußt darauf aus ist, die Arbeit des ganzen Instituts lahmzulegen.«
Aber es blieb nicht nur bei solchen Beschwerden. Vershofen riet beispielsweise dem Verband der Porzellanindustrie im Frühjahr 1942 wiederholt ab, Erhard in seinen Beirat zu berufen. An den Fabrikanten Ernst Heinrich schreibt er am 12. Mai, »Dr. Erhard hat meinen Anweisungen, die ich ihm als Vorgesetzter gegeben habe, verschiedentlich und in zum Teil höchst verhängnisvoller Weise nicht Folge geleistet … Dr. Erhard ist ein sehr begabter Mann von großer Arbeitskraft und Tüchtigkeit. Aber er huldigt einem Optimismus, der in vielen Fällen leider nicht von absolutem Leichtsinn zu unterscheiden ist. Die Folge davon war, daß es immer wieder zu Konflikten mit ihm gekommen ist …« Als Vershofen klar geworden ist, dass ein Teil der führenden Mitarbeiter wie die Doktoren Holthaus und Kerschbaum wohl tatsächlich zusammen mit Erhard sein Institut verlassen würden, legt er gegenüber dem gleichen Adressaten kurz darauf noch schärfer nach: »Von Herrn Dr. Erhard muß ich mich nunmehr vollständig distanzieren, derart, daß ich in Zukunft in keiner Weise, sei es mittelbar oder unmittelbar, mit ihm zu tun haben will. Der Grund ist der, daß er nun zum zweiten Mal den Versuch gemacht hat, mir einige der wichtigsten Mitarbeiter wegzuholen und damit die Arbeit meines Instituts lahmzulegen.«12 Dass der Verband Erhard dennoch in den Beirat berief und das Institut damit zugleich seinen ältesten Auftraggeber verlor, muss Vershofen mächtig gewurmt haben.
Der Kleinkrieg ging weiter. Weil Erhard im Institut Privatbriefe seiner Sekretärin Ella Muhr diktiert hatte, darunter auch seine Angebote an Mitarbeiter im Haus, die von einem Denunzianten an Vershofen und von diesem an die städtische Stiftungsaufsicht weitergereicht worden waren, wurde der armen Frau – sie sollte Erhard bis ins Bundeskanzleramt begleiten – am 11. Juli von Stiftungsverwalter Rollwagen verboten, »innerhalb der vorgeschriebenen Arbeitszeit und mit den sachlichen Einrichtungen des Instituts (Schreibmaschine, Schreibpapier usw.) irgendwelche Arbeiten für Herrn Dr. Erhard auszuführen. Jede Zuwiderhandlung gegen diese Anordnung würde die fristlose Entlassung nach sich ziehen.« Zeitgleich wurde Ludwig Erhard per Einschreiben untersagt, »sich für Ihre privaten Angelegenheiten irgendwelcher privater Einrichtungen des Instituts zu bedienen. Frau Muhr ist entsprechend angewiesen worden.«13
Das alles führte dazu, dass Ludwig Erhard wichtige Briefe in seiner Privatwohnung in der Forsthausstraße diktierte – vermutlich mit weiter wachsendem Unmut, wozu auch Vershofens subversive Aktionen beitrugen. Als Erhard bei August Heinrichsbauer, dem Hauptgeschäftsführer der Südosteuropa-Gesellschaft, sondierte, ob die Leitung des Wiener Instituts für Verbrauchs- und Absatzforschung als neue Position für ihn infrage käme, reichte dieser die Anfrage am 7. Juni sogleich ahnungslos an Vershofen weiter, da das Wiener Haus vertraglich-finanziell mit der GfK verbunden und Vershofen als Vorstandsvorsitzender tatsächlich ein wichtiger Ansprechpartner war. Vershofen wartete nicht lange. Am 13. Juni teilte er Heinrichsbauer mit, weshalb eine »Ernennung des Herrn Dr. Erhard absolut ausgeschlossen« sei:
»1) Herr Dr. Erhard hat nach völlig eindeutigen Informationen, zum Teil authentischen Charakters, für den 1. Oktober folgende Verpflichtungen übernommen: a) die Beratung der deutschen Porzellangeschirrindustrie, b) die Leitung eines industriellen Forschungsinstituts bei der Reichsgruppe Industrie, c) die Beratung des Gauleiters und der Wirtschaftsstellen in Lothringen, d) die Erledigung von Forschungsaufträgen für eine bestimmte Firma. Nach meinem Urteil wird also Herr Erhard vom 1.10. ab so stark beschäftigt sein, daß er die Ihnen gegebene Zusage, sich in der rechten Weise um das Wiener Institut zu kümmern, praktisch gar nicht erfüllen kann. Die Weitherzigkeit, mit der er sich für diese weitere Verpflichtung angeboten hat, entspricht durchaus dem, was ich in den letzten Jahren in einer sehr mißlichen Weise erfahren mußte und was mich pflichtgemäß gehindert hat, ihn in Nürnberg als meinen Nachfolger zu empfehlen.
2) Herr Erhard hat nach der gütlichen Trennung in Nürnberg eine Verhaltensweise gezeigt, die … jedenfalls dahin geführt hat, daß ihm die Stiftungsverwaltung, die personalidentisch ist mit der Leitung der Stadt der Reichsparteitage, die fristlose Entlassung in Aussicht gestellt hat. Sie hat sich dabei ein weiteres Vorgehen auf dem Rechtswege gegen ihn vorbehalten. Angesichts dieser Sachlage ist es nicht verständlich, wie Herr Erhard es überhaupt wagen kann, sich für die Wiener Stelle, dazu noch in vollständig selbständiger Funktion, in Vorschlag zu bringen … Sollten Sie darauf beharren, daß Herr Erhard dort eingesetzt wird, so würde zweckmäßigerweise die Kündigung des Vertragswerkes erforderlich sein, da ich nicht in der Lage bin (was ich vor einem halben Jahr noch gekonnt hätte) ihn für die Wiener Tätigkeit zu empfehlen, resp. als Vorsitzer des Vorstandes der GfK zu ernennen.«14
Wo er konnte, suchte Vershofen dem Unbotmäßigen jetzt den Weg in eine neue Stelle zu verbauen. Weshalb fragte Erhard überhaupt bei Heinrichsbauer nach – und tat das noch einmal im Herbst? Ganz einfach, weil damals, anders als Vershofen annahm, seine Zukunft noch keineswegs geklärt und besonders die Finanzierung des geplanten neuen, eigenen – und von der Reichsgruppe Industrie (RI) vorzufinanzierenden – Forschungsinstituts noch überhaupt nicht in trocknen Tüchern war. Aber Vershofens Drohung mit der Kündigung der Geschäftsbeziehungen wirkte in Wien. Heinrichsbauer, der Erhard offenbar mochte und mit ihm weiter in Kontakt blieb, verzichtete darauf, seine Ernennung zu betreiben. Dass das mit dem Vershofen-Streit zusammenhing, blieb Erhard nicht verborgen, denn Heinrichsbauer berichtete ihm am 11. August, dass der Professor »die Betreuung unseres Wiener Instituts durch Sie rundweg ablehnt«.15
Wenig erstaunlich ist angesichts der hier skizzierten Vorgeschichte die Tatsache, dass es über der Frage des Arbeitszeugnisses schließlich zu einer letzten Eskalation in diesem Streit kam. In seinem Schreiben vom 25. September 1942 an die Geschäftsführende Institutsleitung, das an die städtische Stiftungsaufsicht weitergereicht wurde, hatte Erhard die Punkte skizziert, die nach seiner Auffassung trotz allem im Zeugnis angesprochen werden sollten:
»Aus dem Zeugnis wolle ersichtlich werden, daß ich mit Ausnahme zum Porzellangeschirr-Verband so gut wie sämtliche praktischen Verbindungen des Instituts geknüpft habe und nahezu sämtliche Aufträge hereinholte und de facto die Verantwortung für die finanzielle Gestaltung des Instituts zu tragen hatte.
In Bezug auf die innere Tätigkeit des Instituts bitte ich darauf hinzuweisen, daß es meiner Aufgabe oblag, die Untersuchungen in ständiger Verbindung mit den Sachbearbeitern auf ihre Problemstellung auszurichten, daß ich die Berichte dann in die abgabereife Form zu bringen hatte und schließlich dann auch vor den wirtschaftspolitischen Stellen vertrat. Neben den Verbindungen zur praktischen Wirtschaft schuf ich auch alle Verbindungen zu den Organen der staatlichen Wirtschaftsführung wie zum Reichskommissar für die Preisbildung, zum Reichswirtschaftsministerium, dem Amt für den Vierjahresplan und den kriegswirtschaftlichen Institutionen.
Auf meine Initiative ist zurückzuführen die Gründung des Wiener Institutes, die Ausweitung des Tätigkeitsbereiches des Instituts auf die Ostmark, das Protektorat, Elsaß-Lothringen und die neu eingegliederten Ostgebiete. Mit Kriegsausbruch habe ich erreicht die Einreihung des Instituts in den Kreis der kriegswichtigen Betriebe und die Heranschaffung von Aufgaben, die diese Einordnung auch sachlich rechtfertigen … Ich muß auf diese genaue Schriftlegung meiner Tätigkeit besonderen Wert legen, weil die Tatsache meines Ausscheidens … wohl des öfteren in unzureichender Leistung oder gar moralischen Gründen gesucht werden könnte.«16
Diese Darstellung des eigenen Wirkens war nicht wirklich übertrieben und entsprach durchaus den Tatsachen. War es dann nicht das Mindeste, ihm trotz der zurückliegenden streitbehafteten Wochen ein solch positives Zeugnis auszustellen? Nicht nur für Vershofen, auch für die städtische Stiftungsaufsicht gab es darauf nur eine Antwort: Nein, niemals. Am 17. Oktober 1942 ließ Rollwagen den einmal mehr in Tiefenbach im Allgäu weilenden Vershofen wissen, wie dieser als Erhards Chef und Vorgesetzter das Zeugnis abfassen solle:
»Mit Rücksicht auf die Einstellung des Herrn Dr. Erhard gegen das Institut und die Stiftungsverwaltung ist es selbstverständlich, daß das Zeugnis auf die vorgeschriebenen Angaben beschränkt bleibt und daß insbesondere das Zeugnis keine Angaben enthält, die die Abwehrstellung des Instituts und der Stiftungsverwaltung gegen Herrn Dr. Erhard gar erschweren könnten. Ich darf in diesem Zusammenhang streng vertraulich zur Kenntnis geben, daß die Auseinandersetzungen mit Herrn Dr. Erhard sich möglicherweise in einem gegen ihn einzuleitenden Beleidigungs-Strafverfahren fortsetzen werden.
Als Anlage erhalten Sie ein mit Herrn Bürgermeister Dr. Eickemeyer aufgestellten Vorschlag für ein Zeugnis, das all diesen Gesichtspunkten entsprechen dürfte. Es wäre der Stiftungsverwaltung sehr erwünscht, wenn Sie sich diesen Entwurf zu eigen machen und das Zeugnis entsprechend ausfertigen würden.«
Natürlich war auch Rollwagen klar, dass Erhard einen arbeitsrechtlichen Anspruch auf ein umfassendes – und auch zumindest in Grenzen positives – Zeugnis hatte und diesen auch geltend machen konnte. Deshalb beschloss er sein amtliches Schreiben mit einer unterschwelligen Drohung: »Sollte Herr Erhard auf eine Änderung des Zeugnisses, insbesondere eine Ausdehnung auf einen Ausspruch über Leistung und Führung verlangen, dann müßte das Zeugnis selbstverständlich auch auf sein Verhältnis zur Stiftungsverwaltung ausgedehnt und auch auf sein besonderes Verhalten in dieser Beziehung abgestellt werden. Herr Dr. Bürgermeister Eickemeyer bittet ganz besonders darum, daß eine Erweiterung des Zeugnisses durch Erstreckung auf Leistung und Führung nur nach vorheriger Verhandlung mit ihm erfolgt.«
Vershofen tat, wie ihm geheißen. Und er tat es gern. Er fertigte entsprechend der ihm von Amtsdirektor Rollwagen übermittelten Vorlage ein kurzes, kaltes, ganze 34 Zeilen umfassendes und auf den 30. September zurückdatiertes Zeugnis aus und ließ es Ludwig Erhard Ende Oktober schicken. Für diesen bildete die Sendung und seine Antwort darauf den Schlusspunkt seines Kontakts zu Wilhelm Vershofen – und markierten den absoluten Bruch. Mit seiner Antwort ließ er sich fast einen Monat Zeit. Arbeitsrechtliche Schritte hatte er wohl erwogen, letztlich aber doch verworfen. Vermutlich war ihm selbst klar geworden, dass man sich in der braunen Diktatur mit einem einzelnen, noch dazu eher subalternen Amtsträger anlegen mochte und konnte, aber besser nicht mit der ganzen städtischen Stiftungsaufsicht, an deren Spitze Oberbürgermeister und Bürgermeister standen, die überzeugte Nationalsozialisten waren und diese auch den gesamten Verwaltungsapparat dominierten. Umso mehr trafen sein Zorn und seine Enttäuschung seinen alten Mentor. Wohl nie zuvor und niemals später, auch nicht an Konrad Adenauer, hat Ludwig Erhard solch einen Brief geschrieben wie diesen vom 20. November 1942 an Wilhelm Vershofen, was bereits einige kurze Auszüge belegen:
»Obwohl das mir zugeleitete Zeugnis über meine dreizehnjährige Tätigkeit am Institut nicht den gesetzlichen Erfordernissen entspricht, die ich zu stellen berechtigt bin und ich mir deshalb das Recht einer neuen Zeugnisanforderung ausdrücklich vorbehalte, kann ich mich nicht entschließen, dieses mir von Ihnen ausgestellte sogenannte Zeugnis zu vernichten oder wieder zurückzugeben. Zwar dokumentiert dieses nicht meine Leistung, sondern lediglich einen Charakter, aber nach dieser Richtung stellt es ein umso bemerkenswerteres Dokument dar, weil es zeigt, bis zu welchem Grad Verblendung, Eifersucht, Mißgunst und Mißtrauen führen können …
Seien Sie gewiss, daß ich glücklicher wäre, wenn Sie mir den Glauben und die Verehrung für Ihre Person nicht so gründlich geraubt hätten, daß ich dort, wo ich Größe wähnte, heute nur noch menschliche Kleinheit und Unzulänglichkeit erblicken kann. Ich muß deshalb noch einmal feststellen, daß nicht ich Ihnen, sondern Sie mir die Treue gebrochen haben … Mit Schaudern fühlte ich Ihren Haß, wenn Sie im Frühjahr 1941 feststellen zu können glaubten, daß ich an der Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit des Instituts Schuld trage, obwohl Ihnen bei einigermaßen klarem Erkenntnisvermögen das Groteske dieses Vorwurfs hätte zum Bewußtsein kommen müssen. Ich kann zur Wahrung meiner Ehre nicht darauf verzichten, diese Behauptung als eine bewußte Verleumdung zu charakterisieren, weil Ihnen oft genug die tatsächlichen Gründe für die Notwendigkeit einer immer noch beträchtlichen Zuschußleistung seitens der Stiftungsverwaltung vor Augen geführt worden sind. Seien Sie sich dessen bewußt, daß sich jede Kränkung und Verleumdung mir in die Seele brannte, weil ich mich stets schuldlos und ehrlich fühlen konnte. Ich werde wohl stark genug sein, diese schwere, ja größte Enttäuschung meines Lebens zu überwinden, aber vergessen werde ich sie niemals können. Das ist also das Fazit einer dreizehnjährigen Zusammenarbeit.«
Ob Wilhelm Vershofen diesen bitteren Abschiedsbrief, der ohne jede Abschiedsgrußformel geblieben war und lediglich Erhards Unterschrift trug, überhaupt gelesen hat, wissen wir nicht. Er hatte schon längst Anweisung gegeben, ihm Schreiben von Erhard nicht mehr vorzulegen. Eine unmittelbare Reaktion erfolgte jedenfalls nicht. Die beiden blieben geschiedene Leute, und alle Versuche von Dritten, nach dem Krieg in Bonn zu einer Aussöhnung beizutragen, scheiterten, weil der ansonsten friedfertige und wenig nachtragende, mittlerweile zum Wirtschaftsminister aufgestiegene Erhard dazu einfach nicht die Bereitschaft aufbrachte.
Auch mit der nationalsozialistischen Stadtverwaltung von Nürnberg hatte es sich Ludwig Erhard verscherzt. Als er sich nach Etablierung seines eigenen »Instituts für Industrieforschung« im Sommer 1943 um Aufträge aus dem Rüstungsministerium bemühte, wurde dies vom Nürnberger Oberbürgermeister Liebel in seiner Tätigkeit beim Reichsminister für Bewaffnung und Munition, Albert Speer, vereitelt, nachdem ihm Bürgermeister Eickemeyer, der von Erhards entsprechenden Bemühungen gehört hatte, eingedenk der zurückliegenden heftigen Auseinandersetzungen am 5. Juni geschrieben hatte: »Ich glaube nicht, daß Dr. Erhard, der jetzt nicht mehr Exponent eines wissenschaftlichen Instituts, sondern reiner Privatunternehmer ist und dessen Verflechtungen und Verfilzungen mit allen möglichen privaten Wirtschaftskreisen nicht durchschaut werden können, besondere Eignung dafür besitzt, von Ihrem Ministerium mit derartigen Aufträgen bedacht zu werden.«
Auf die Unterstützung der überzeugten Nürnberger Nationalsozialisten Liebel und Eickemeyer konnte Erhard also nicht mehr zählen. Seinen entscheidenden Rückhalt bildeten jetzt tatsächlich nicht braune Netzwerke und Seilschaften von Parteigenossen und -bonzen, sondern das, was Eickemeyer abschätzig »Verflechtungen und Verfilzungen« mit privaten Wirtschaftskreisen genannt hatte. Das sollte Erhard aber nicht davon abhalten, nach dem Krieg im Entnazifizierungsverfahren von Eickemeyer diesem ein durchaus wohlwollendes Zeugnis in seinem erbetenen »Persilschein« auszustellen und dadurch mit dazu beizutragen, dass aus einem »Hauptschuldigen« ein »Mitläufer« wurde. Allerdings nutzte der Streit nach Kriegsende auch ihm selbst, denn er belegte seine Bereitschaft, sich unerschrocken mit lokalen NS-Größen anzulegen – auch wenn es dabei nicht um politische Differenzen gegangen war. Das aber hatten tatsächlich im Dritten Reich nur wenige gewagt.