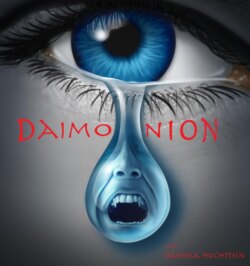Читать книгу Daimonion - Daniela Hochstein - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 6
ОглавлениеIch hatte mich in dem Ostviertel der Stadt, dort wo nachts bloß noch loses Pack und Huren anzutreffen waren, in einer engen Gasse auf die Lauer gelegt; meinen Blick hungrig an einen schmächtigen Mann geheftet. Seit Stunden hatte ich ihn nun schon beobachtet, war ihm wie ein Schatten gefolgt, auf Schritt und Tritt. Er war eine Ratte und erfüllte mich schon durch sein äußerliches Erscheinungsbild mit Widerwillen, mit seinem fliehenden Kinn, der langen, spitzen Nase und dem verschlagenen Blick. Wieselflink huschte er an den Freiern der Huren vorbei, rempelte sie zufällig an und zog ihnen dabei unbemerkt die Börsen aus den Taschen. Nicht, dass ich Mitleid mit den Freiern gehabt hätte, sie waren nicht minder abstoßend. Doch diese Ratte hier erschien mir einfach schlecht. Ihn erlaubte ich mir, zu töten und jetzt war der geeignete Zeitpunkt dafür.
Es bedurfte kaum eines Aufwandes und noch weniger Kraft, mir die Ratte zu packen und in eine finstere Nische zwischen zwei Häusern zu ziehen. Ich hielt meine Hand auf seinen Mund gepresst, so dass er keinen Mucks von sich geben konnte, und kümmerte mich nicht um seine panisch aufgerissenen Augen, als ich meine Zähne in seinen Hals grub und sein Blut verschlang.
Die Aufschreie meines Gewissens blieben aus und ich glaubte mich tatsächlich in meiner Idee bestätigt. So einfach schien es zu sein und Hoffnung keimte in mir auf. Hoffnung, meinen Durst kontrolliert löschen zu können, ohne mich danach wie ein Verdammter zu fühlen.
Doch die Hoffnung sollte schnell zunichte gemacht werden.
Während ich noch trank, fühlte ich, wie zunächst Nebelschleier vor meinem inneren Auge aufzogen. Sie nahmen Farben und Formen an und verdichteten sich schließlich zu fließenden Bildern. Und da erkannte ich die Ratte. Er war noch klein, ein dürres, in Lumpen gekleidetes Kind, das auf seinen sterbenden Vater blickte und seinen Worten lauschte, mit denen er ihm die Sorge für die Mutter und die drei jüngeren Geschwister übertrug. Das Bild verwischte, fügte sich neu zusammen und ich sah, wie die kleine Ratte in einer Gasse von den größeren, stärkeren Straßenjungs verprügelt und ausgeraubt wurde. Was blieb ihm zuletzt anderes übrig, als überall möglichst unbemerkt zu bleiben? Was blieb ihm anderes, als heimlich zu stehlen? Er hatte eine große Verantwortung und nie eine andere Chance gehabt.
Als die Ratte in meinen Armen hing, durch mein Saugen inzwischen seines tristen Lebens beraubt, hörte ich den Schrei wieder. Den Schrei meines Gewissens...
Nach dieser Erfahrung beschloss ich, mich in Enthaltsamkeit zu üben. So waren mir wenigstens ein oder zwei – wenn auch hungrige - Nächte am Stück gegönnt, die ich ohne den Akt des Tötens verbringen konnte. Darüber hinaus jedoch blieb ich auf das Blut der Menschen angewiesen.
Um meine Urteilskraft zu verbessern, begann ich, die Menschen zu beobachten, bevor ich mich entschied, sie zu töten. Mit der Zeit wurde ich darin immer akribischer, denn je länger ich einem Menschen folgte, desto mehr Facetten erkannte ich plötzlich an ihm. Und irgendwann diente dies nicht mehr allein der Auswahl meiner Opfer, sondern es wurde eine Art Beschäftigung für mich. Auf diese Weise konnte ich noch Anteil an dem Leben der Menschen haben, wo es mir darüber hinaus doch leider versagt blieb, wie Ihresgleichen unter ihnen zu leben.
Manchmal kam es sogar vor, dass ich mein anfängliches Opfer mit der Zeit lieb gewann und über eine gewisse Dauer wie einen Freund begleitete, wobei ich jedoch stets bloß ein unsichtbarer, stummer Verfolger blieb, sodass derjenige mich nicht bemerkte.
Ja, sie bemerkten mich nicht, aber ich lud sie in meiner Vorstellung häufig ein zu mir in meine Gruft. Dort sprach ich sogar zu ihnen, erzählte ihnen von mir, von meinen Gedanken über die Menschen, die ich auf diese Weise kennengelernt hatte, von meinen Ideen bezüglich des Sinns meiner Existenz. Ich gestand ihnen meine absonderliche Natur, versicherte ihnen dabei aber auch stets mein Bemühen, meine Moral trotz allen Umständen zu erhalten; und zuletzt ließ ich sie wieder gehen. Ohne sie zu töten.
Es vergingen schließlich Monate. Monate, in denen ich die Fähigkeit erlangte, die Grundhaltung eines Menschen intuitiv zu erspüren. Das war sehr hilfreich, wenn ich meinen Durst einmal schnell stillen wollte, ohne mich danach ewig mit Selbstvorwürfen zu quälen.
Aber es waren auch Monate der tiefsten Einsamkeit, und letztendlich waren es wohl insbesondere die Gespräche zu meinen imaginären Freunden, die mir halfen, diese Zeit zu überdauern; jede Nacht - eine wie die andere - von den Toten aufzuerstehen, mich wie der nächtliche Unhold aus meinem Sarg zu erheben, dem Durst nach Blut zu widerstehen oder aber auf die Jagd danach zu gehen, und zuletzt zum Schlafen wieder in meine kleine Gruft zurückzukehren, die bald eine Art `zu Hause´ für mich geworden war. Ein `zu Hause´, vor dessen Eingang ich jeden Abend und jeden Morgen verharrte, um wehmütig zu dem Haus meiner Eltern hinüber zu schauen und mir die Frage zu stellen, was sie wohl über meinen Verbleib denken mochten.
Suchten sie noch nach mir? Oder waren sie gar böse auf mich, weil ich einfach verschwunden war?
Diese Fragen quälten mich immerzu, doch nie fand ich den Mut, mich heimlich an das Haus heranzuschleichen, um dort vielleicht Antworten zu finden oder meine Familie wenigstens einmal sehen zu können. Zu sehr fürchtete ich mich davor, von ihnen entdeckt zu werden. Außerdem hatte ich Angst, meine Einsamkeit als noch schmerzhafter zu empfinden, wenn ich sie zusammensitzen sehen würde, ohne mich. Zuletzt blieb mir nichts, als mich notgedrungen damit zu trösten, wenigstens in ihrer Nähe sein zu dürfen.
Dann kam der Winter und machte seinem Namen alle Ehre.
Ende Dezember begann es, ohne Unterlass zu schneien und bald schon lag das ganze Land unter einer dicken Schneeschicht begraben. Die Äste der Bäume bogen sich unter der weißen Last und drohten sogar vereinzelt zu brechen. Die Tiere in den Wäldern hatten sich ein dichtes Winterfell zugelegt und die Menschen hüllten sich in warme Mäntel und Stiefel, bevor sie, möglichst nur für kurze Zeit, ihre Häuser verließen.
Mir hingegen schien die eisige Kälte nichts anzuhaben. Trotz meiner inzwischen zerrissenen, dünnen Kleidung, die ich trug, fror ich nicht im Geringsten. Längst schon waren meine Schuhe löchrig geworden, so dass ich zuletzt gänzlich auf sie verzichtete, doch der Schnee tat meinen nackten Füßen nicht weh. Wenn ich auf Jagd ging, wurden meine Haare sowie meine Kleidung häufig nass, waren manchmal sogar zu Eis gefroren, doch es machte mir nichts aus. Ebenso wenig wurde ich jemals krank dadurch. Nicht einmal der Anflug eines Schnupfens ereilte mich.
Es mag sein, dass mich die wenigen Menschen, denen ich mich in jener Zeit zeigte, für einen Irren hielten, denn mein verlottertes Erscheinungsbild musste äußerst eigentümlich auf sie wirken. Da sie jedoch unsere Begegnung zuletzt nicht überlebten, war es mir gleichgültig.
Der Winter zog eine gläserne Mauer zwischen mir und den Menschen. Zumeist konnte ich sie nur noch durch Fensterscheiben beobachten konnte, sodass ihr Leben für mich bloß aus Fragmenten bestand - wie ein Buch, aus dem man ganze Seiten herausgetrennt hatte. Ich fühlte mich so weit von ihnen entfernt, wie nie zuvor und begann mich zunehmend als eine eigene Spezies zu begreifen, von welcher ich allerdings das einzig existierende Exemplar zu sein schien. Und so zog ich mich immer mehr von den Menschen zurück in die Einsamkeit der Wälder, die ich wie ein einzelgängerischer Wolf durchstreifte.
Ganze Nächte lang durchstapfte ich die unberührte, im Mondlicht glitzernde Schneedecke, blickte zurück auf meine verlorenen Fußabdrücke, beobachtete die Eulen, Füchse, Mäuse und all die anderen selten gewordenen Kreaturen der Nacht bei ihrer Futtersuche. Ja, manchmal half ich ihnen sogar dabei, indem ich ihnen einen Leckerbissen in den Schnee legte und ihnen zusah, wie sie sich, vom Hunger getrieben, immer näher an mich heran wagten, um ihn sich zu schnappen.
Andere Nächte – zumeist die Enthaltsamen – verschlief ich einfach, und wieder andere nutzte ich, mich der Abwechslung halber in entferntere Städte oder Dörfer zu wagen, um dort auf die Jagd zu gehen.
So verging die kalte Jahreszeit, und als eines Tages der Schnee zu schmelzen begann und der Duft nach feuchtem Grün die Luft belebte, schien auch mein vor Einsamkeit gefrorenes Herz langsam wieder aufzutauen. Eine schreckliche Sehnsucht nach meinen Eltern und meiner Schwester fing an, sich zehrender als je zuvor in mir auszubreiten. Viele Nächte lang spielte ich mit dem Gedanken, mich nun doch näher an das Haus heranzuwagen, um sie wenigstens einmal wiedersehen zu können. Jedoch verwarf ich ihn nach einigem Abwägen stets wieder. Aber diese Idee geisterte seither unermüdlich in meinem Kopf herum und nahm dort immer mehr Raum ein, bis sie mich zuletzt ganz und gar beherrschte; bis ich irgendwann soweit war, dass ich mich dem Wunsch nicht mehr länger verschließen wollte. Und so schlich ich mich eines Nachts, direkt nachdem ich erwacht war, an den westlichen Flügel des Hauses heran; dorthin, wo meine Familie um diese Zeit zu speisen pflegte.
Vorsichtig und mit vor Aufregung zittrigen Gliedern näherte ich mich einem der breiten Fenster des Speisesaals, das sich ein wenig abseits der Tafel befand, sodass man mich von drinnen nicht so leicht bemerken konnte, und lugte neugierig hinein.
Da saßen sie, wie ich es erwartet hatte, alle auf ihren gewohnten Plätzen, und der Tisch war, wie stets, reich gedeckt. Bloß mein Platz – neben Elisabeth - war nicht, wie ich gedacht hatte, leer. Nein, dort saß jemand, dessen Gesicht mir gänzlich unbekannt war.
Mein Herz begann zu klopfen, als befände sich statt seiner ein aufgebrachter Vogel in meiner Brust, und als hätte ich ein Recht darauf, empfand ich bei dem Anblick des Fremden plötzlich eine bohrende Eifersucht.
Wer, verdammt, war dieser Kerl und warum saß er auf meinem Platz neben Elisabeth?
Ich konzentrierte mich darauf, dem Gespräch, in das sie gerade vertieft waren, zu lauschen, was mir glücklicherweise trotz geschlossener Fenster keine Mühe bereitete. Leider jedoch drehte es sich darin durchweg um Belanglosigkeiten, die mir nur wenig interessante Informationen vermitteln konnten. Bald aber war es für mich schon anhand der Zwischentöne, der Gesten und Blicke erkennbar, dass der Fremde mit meiner Familie vertraut zu sein schien. Insbesondere die Art, wie er meine Schwester zwischendurch betrachtete sowie er mit ihr sprach, zeigte mir, dass sie in einer besonderen Beziehung zu ihm stehen musste. In einer Beziehung, die mich besorgt stimmte, denn ich fürchtete, dass sie für Elisabeth bald Anlass sein würde, von zu Hause fortzuziehen, und allein diese Vorstellung war für mich kaum zu ertragen, weil ich sie damit letztendlich endgültig verlieren würde. Das mag vielleicht absurd klingen, da ich sie ja in gewisser Hinsicht bereits verloren hatte. Aber solange sie hier lebte, konnte ich sie zumindest noch sehen, wenn ich es wollte.
Es war nun zwar keine Neuigkeit, dass meine Eltern schon lange auf Elisabeths Vermählung gedrängt hatten. Doch dass sie nun, wo ich verschwunden war, so schnell dabei waren, sie auch in die Tat umzusetzen, verwunderte mich und ich hatte kein gutes Gefühl dabei. Nur zu gerne wäre ich hinein gegangen und hätte mich dem offensichtlichen Anwärter vorgestellt, allein um ihn wissen zu lassen, dass ich auf Elisabeth aufpassen würde und er sie gut behandeln sollte. Aber stattdessen stand ich hier draußen, gefangen in einer anderen Welt; einer Welt, die weit, weit entfernt von der Ihren war, und die es mir unmöglich machte, die kurze Strecke zwischen uns zurückzulegen und mich ihnen zu zeigen. Genauso hätte ich tot sein können. Und in diesem Moment hätte ich beinahe nichts dagegen gehabt, es tatsächlich zu sein, denn es war fast schlimmer, diese Machtlosigkeit ertragen zu müssen.
Gerade jedoch, als ich mich schwermütig von dem Fenster und dem Anblick meiner Familie losreißen wollte, um sie wohl oder übel ihrem Schicksal zu überlassen, in das ich ohnehin nicht eingreifen konnte, hörte ich den Fremden meinen Namen nennen. Noch mitten in der Bewegung hielt ich inne und trat neugierig wieder an das Fenster heran, um besser zuhören zu können.
`... Ich hatte vorhin zum ersten Mal die Gelegenheit gehabt, Ihre Ahnengalerie eingehender betrachten zu können. Dabei stieß ich auf ein Portrait von ihm in der Reihe Ihrer Kinder... Ich war ein wenig verwundert, hatte ich seinen Namen zuvor noch nie gehört. Ist er... ein Sohn der Familie?´ Der - meines Erachtens taktlosen und indiskreten - Frage folgte eine betretene Stille und dem Fremden wurde die Situation sichtlich unangenehm. Sei es, dass ihm seine Unverfrorenheit erst jetzt bewusst wurde, oder dass er tatsächlich geglaubt hatte, meine Existenz sei bisher eher zufällig unter den Tisch gefallen. Seine Wangen röteten sich und er blickte hilfesuchend zu Elisabeth herüber, die seinen Blick jedoch nicht erwiderte, sondern bloß betrübt auf ihren Teller starrte.
`Es tut mir Leid´, stammelte er daraufhin eilig, als könne er seine Worte damit rückgängig machen. `Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Ich erwarte selbstverständlich keine Antwort, wenn über dieses Thema besser geschwiegen werden sollte...´
Meine Mutter, die auf die Frage des Fremden hin ihren Blick niedergeschlagen hatte, sah nun wieder zu ihm auf und machte eine abwehrende Geste.
`Nein, nein, Sie können nicht wissen, dass Ihre Frage eine Wunde aufreißt, die nicht heilen will. Ich weiß Ihre Anteilnahme zu schätzen und möchte versuchen, Ihnen eine offene und ehrliche Antwort zu geben, soweit es mir möglich ist.´ Sie räusperte sich kurz und ihre Stimme verriet, dass sie mit den Tränen kämpfte, als sie zögernd weiter sprach: `Unser jüngster Sohn ist seit einigen Monaten verschwunden. Sein Pferd sowie sein Gewehr wurden draußen im Wald gefunden, doch von ihm selbst fehlt bis heute jede Spur... Wir haben Wochen lang nach ihm suchen lassen. Zunächst hatten wir noch die Hoffnung, dass er eines Tages wiederkehren würde. Doch dann kam der kalte Winter...´ Meine Mutter schluckte schwer, sprach aber tapfer weiter. `Alle behaupten, dass er ihn unmöglich da draußen überlebt haben kann...´ Bei diesen Worten senkte meine Mutter den Kopf und hob ihre Hand vor die Lippen, als wolle sie ihnen verbieten, weiter zu sprechen.
`Verzeihen Sie´, presste sie hervor, stand auf und verließ eilig das Zimmer, wohl - ich kannte sie gut genug, um das zu wissen - weil sie ihre Tränen nun nicht mehr zurückhalten konnte. Aber nicht nur sie, sondern auch Elisabeth begann daraufhin zu schluchzen. Schnell zog sie ein Taschentuch aus ihrem Ärmel hervor, um ihr Gesicht darin zu verbergen. Mein Vater hingegen starrte einfach geradeaus, mit einem Gesicht, wie eine empfindungslose Maske, fast als wäre er maßlos enttäuscht von mir.
Diese Szene mit anzusehen, versetzte mir einen brennenden Stich mitten ins Herz. Die Brust vor Kummer eng zusammengeschnürt, riss ich mich von dem Anblick los und floh mit blutender Seele in die dunkle Nacht, wo ich mich hinter dem nächsten Busch verkroch und nun selbst meinen aufgestauten Tränen freien Lauf ließ.
Es war eine Sache gewesen, sich den Schmerz, den mein Verschwinden meiner Familie bereitete, nur in etwa vorzustellen - konnte man sich dabei noch vor der schlimmsten Betroffenheit verschließen. Nun aber in ihre Gesichter zu schauen und die quälende Ungewissheit in ihrem gesamten Ausmaß darin zu erblicken, hatte noch einmal eine ganz andere Qualität, und es grämte mich zutiefst, dies zu erkennen.
Angestrengt grübelte ich darüber nach, ob und wie ich wenigstens ihrem Leid noch Linderung verschaffen konnte, wenn es für Meines schon keine gab. Doch je mehr ich mir den Kopf darüber zerbrach, desto leerer fühlte er sich paradoxer Weise an. Letztlich hockte ich einfach bloß da, starrte zwischen den kahlen Ästen hindurch auf das Haus meiner Eltern und kämpfte gegen das Bollwerk meiner Ideenleere, errichtet aus schlechtem Gewissen, betäubender Trauer und zuletzt auch noch meinem langsam hindurchsickernden Durst, der bald schon an Intensität zunahm und jeden Gedanken, den ich aufnahm, bloß in die all zu bekannte Richtung lenkte...
Schließlich sah ich ein, dass es keinen Sinn mehr hatte, hier an Ort und Stelle auf den grandiosen Einfall einer überzeugenden Lösung zu hoffen. Daher stand ich seufzend auf und machte mich schweren Schrittes auf den Weg Richtung Stadt. Dort, so hoffte ich, könnte ich wenigstens dieses eine, stets beharrlich wiederkehrende, dabei aber zutiefst verhasste Bedürfnis rasch befriedigen.“
***
Armon spürte, wie der Druck von Ambriels Hand auf seiner Schulter sich verstärkte, und verstummte. Fragend schaute er ihn an, fand seinen Blick aber nicht erwidert. Stattdessen waren die Augen des Engels auf den Richter geheftet. Dieser griff die Pause sogleich auf.
„Was gibt es, Ambriel?“, fragte er.
„Euer Ehren, ich bitte Euch, an dieser Stelle nun selbst einen Zeugen aufrufen zu dürfen.“
Erschrocken weiteten sich Armons Augen und er starrte den Engel mit offen stehendem Mund an. Was hatte Ambriel vor? Wen konnte er denn schon als Zeugen laden, der für ihn sprechen würde? Sollte Ambriel ihn vielleicht getäuscht haben über seinen Glauben an ihn und seiner Gesinnung, für Armons Seele zu kämpfen? Würde Armon gleich ganz alleine vor dem Tribunal stehen und geradewegs der Hölle in ihr feuriges Antlitz blicken?
„Ich bitte Ludwig, den Nachtwächter herein“, sprach Ambriel und warf Armon dabei so flüchtig, dass es keiner sonst wahrgenommen haben mochte, ein Augenzwinkern zu. Jetzt verstand der Vampir.
Als der Nachtwächter den Saal betrat, lugte Armon verstohlen zu Cheriour hinüber, der den behäbigen Gang des Zeugen mit skeptischem Blick verfolgte. Geräuschvoll nahm der Nachtwächter im Zeugenstand Platz, erwartungsvoll den Fragen entgegen sehend, die gleich an ihn gerichtet würden.
Ambriel verzichtete darauf, an den Zeugen heranzutreten, hätte er dazu ja Armons Schulter loslassen und ihn damit wieder seinen üblen Verbrennungen und den Schmerzen anheim geben müssen. Daher fragte er von seinem Platz aus.
„Ludwig, ich nehme an, dass Sie diesen Mann hier wieder erkennen?“
Grimmig starrte der Nachtwächter in die Richtung des Vampirs.
„Und ob.“
„Er hat Sie getötet, nicht wahr?“
Das Gesicht des Zeugen verdüsterte sich.
„Allerdings hat er das. Ich war auf der Wache eingenickt und er hat mich geweckt. Mit seinen...“
„Vielen Dank für Ihre Antwort“, unterbrach Ambriel den Zeugen abrupt. „Sie brauchen die Details nicht näher erläutern. Mein Taktgefühl gebietet mir, Ihnen dies zu ersparen. Vielmehr möchte ich wissen, ob Sie sich den Grund erklären können. Haben Sie eine Vermutung, warum mein Schützling Ihnen das angetan haben könnte?“
Fassungslos sah der Nachtwächter Ambriel in die Augen.
„Was ist das für eine Frage? Dieser Mann da, ist ein Monster. Mein Blut wollte er. Meine Seele! Es gab sonst keinen Grund...“
Ambriel nickte.
„Mhm. Ihnen kommt also gar nichts in den Sinn, was ihn vielleicht zu seinem Handeln getrieben haben könnte? Sie haben sich ihm gegenüber stets vollkommen anständig und korrekt verhalten?“
Empört schaute der Zeuge in die Runde, auf der Suche nach Beistand. Ein Raunen erhob sich in der Menge und Ambriel hoffte, noch ein wenig Zeit zu haben, bis Cheriour, der bereits unruhig von einem Fuß auf den anderen trat, eingreifen würde.
„Was hätte ich denn anderes tun sollen? Er war in diesen Laden eingebrochen. Es hatte eine Schießerei gegeben. Der Schuss war es ja gewesen, der mich erst herbeigerufen hat... Er war schuldig! Außerdem...“
„Wessen war er schuldig?“
Der Nachtwächter stutzte, unwillig, weil er nicht hatte ausreden dürfen.
„Diebstahl.“
„Hat er tatsächlich etwas gestohlen?“
Wieder zögerte der Nachtwächter.
„Nein“, gab er schließlich missmutig zu.
„Wessen also war er schuldig?“
„Einbruch.“
„Und sagen Sie mir: haben Sie meinen Schützling gemäß dieses Vergehens, Einbruch, tatsächlich angemessen behandelt?“
Hilfesuchend sah der Zeuge sich um. Jetzt reichte es Cheriour. Energisch trat er hervor und erhob seine Stimme.
„Euer Ehren, ich weiß nicht wohin diese Befragung führen soll. Vielmehr nimmt sie Formen an, die ich nicht länger akzeptieren möchte. Ich bitte Euch, die Zeugenvernehmung hier zu beenden.“
Hoffnungsvoll wanderte Ambriels Blick von Cheriour zu dem Richter, doch dieser hob bloß seine Hand und signalisierte damit, dass Cheriours Einwand stattgegeben wurde. Enttäuscht ließ Ambriel seinen angehaltenen Atem entweichen. Betrübt musste er erkennen, dass selbst der Richter dem gewünschten Urteil ferner war, als Ambriel geglaubt hatte. Dennoch, selbst wenn er seine Vernehmung nicht hatte zu Ende führen können, so war er doch entscheidend weit gekommen. Den Rest würde hoffentlich Armon selbst liefern, der nun wieder aufgefordert wurde, weiter zu berichten.