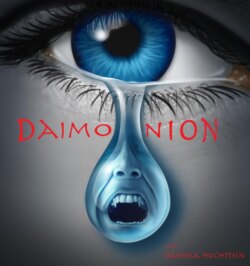Читать книгу Daimonion - Daniela Hochstein - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wieder unter Menschen – Kapitel 1
Оглавление„Den ersten Abend in der fremden Stadt verbrachte ich damit, durch die Straßen zu schlendern und meine neue Umgebung zu erkunden.
Alles hier war ein Stück größer, als ich es aus meiner Heimat kannte. Die Straßen waren breiter und überall gepflastert. Es gab Bürgersteige, die Platz genug boten, bequem zu dritt nebeneinanderher spazieren zu können, ohne dabei fürchten zu müssen, versehentlich in den Rinnstein zu treten. Die Häuser waren überwiegend drei- oder gar vierstöckig und drängten sich beidseits der Hauptstraße zu einem undurchdringlichen Wall zusammen.
Trotz der bereits eingetretenen Dunkelheit, gab es noch genug Menschen, die scheinbar kein Interesse hatten, sich bald in ihre Häuser zurückzuziehen, um sich zur Ruhe zu legen. Vielmehr tummelten sie sich noch fröhlich auf der Straße, saßen schwatzend und trinkend in Tavernen, begaben sich ins Theater, die Oper oder was die Stadt ihnen sonst noch zu bieten hatte.
Selbst als ich mich zunehmend in die Seitenstraßen absetzte, wo die Häuser kleiner und ärmlicher wurden und die Sträßchen schmaler und schmutziger, fand ich dort noch immer reichlich Leben, wenn auch auf deutlich niedrigerem sozialen Niveau.
An Nahrung jedenfalls würde es mir in dieser Stadt nicht mangeln, jedoch – wie ich schon fast befürchtete - an Gelegenheiten, diese möglichst unentdeckt zu mir zu nehmen... Aber ich war mir sicher, zu späterer Stunde würde sich auch dieses Problem rasch erledigen.
Alles zusammen betrachtet, gefiel es mir an diesem Ort und ich entschied mich daher sehr schnell, vorerst hier zu bleiben und mir – am liebsten mittendrin und möglichst anonym - eine dauerhafte Bleibe einzurichten. Eine Aufgabe, die ich mir für die kommenden Abende auferlegte.
Heute jedoch wollte ich mich einfach dem Treiben der Menschen hingeben und darin eintauchen wie in ein Bad nach einer langen, staubigen Reise. Allerdings musste ich zuvor noch dafür sorgen, dass mich dieses Eintauchen nicht am Ende Kopf und Kragen kosten würde, denn meinen Durst hatte ich noch nicht gestillt und auch wenn er jetzt noch nicht sehr drängte, so wollte ich es nicht darauf ankommen lassen.
Also musste ein betrunkener Bettler, den ich schlafend in einer verlassenen Gosse fand, sein Leben für mich lassen. Glücklicherweise merkte er nicht viel davon, er schlief einfach weiter und würde nun lediglich nie wieder erwachen. Nebenbei war dies eine wunderbare Gelegenheit, meine gerade erst neu entdeckte Gabe direkt auszuprobieren. Denn ich war fest entschlossen, in meiner neuen Heimat keine Spuren zu hinterlassen, die sonst bloß wieder Anlass für Gerüchte über Dämonen oder Vampire gegeben und mir nur zu bald das Leben hier deutlich erschwert hätten.
Bevor ich mir also die Mühe machte, die Leiche zu beseitigen – ich hätte sie entweder im Fluss versenkt oder irgendwo vergraben, allerdings mit der Schwierigkeit, sie zuerst unbemerkt bis dorthin transportieren zu müssen – biss ich mir nach einem kurzen Moment der Überwindung einmal kräftig auf die Zunge. Sofort schmeckte ich einen warmen, süßlichen Schwall daraus hervorschießen, der unmittelbar darauf einen imperativen Schluckreflex bei mir auslöste. Schließlich leckte ich mit meiner blutenden Zunge über die Bisswunden, die ich am Hals des Bettlers hinterlassen hatte, und beobachtete danach gebannt, was nun geschehen würde.
Jedoch vergeblich, denn die Wunden blieben unverändert und unverkennbar. Es gab nicht den geringsten Hinweis darauf, dass sich daran in Kürze noch etwas ändern würde. Bei Toten schien meine Gabe also nicht zu wirken.
Enttäuscht hockte ich vor dem verblichenen Bettler und stellte mich mit einem tiefen Seufzer schon auf eine mühselige Nacht ein, da geschah es: Die unheilvoll aufklaffende Bissspur, die meine Zähne in seine Haut geschlagen hatten, zog sich langsam von ihrem Rand her zusammen, bis sie sich bald vollständig geschlossen hatte, und ebenso verblasste die hiernach zurückgebliebene, rosige Narbe in Windeseile, sodass auch sie zuletzt spurlos verschwunden war. Verblüfft strich ich noch einmal mit meinen Fingern über die Stelle, die vorhin noch so wonnevoll geblutet hatte, doch auch zu tasten war dort nun nichts weiter mehr, als unversehrte, bloß von den Ausläufern eines Bartes behaarte Haut. Erleichtert atmete ich auf und nachdem ich noch einen Moment abgewartet hatte, als traute ich diesem Phänomen noch nicht recht, erhob ich mich zufrieden und ging meiner Wege, ohne mich noch weiter um den Leichnam zu scheren.
Ein bestimmtes Ziel hatte ich dabei nicht vor Augen. Doch aus der Ferne wehte ein Konzert aus Geräuschen zu mir herüber, die mir menschliche Geselligkeit versprachen und von denen ich mich plötzlich magisch anzogen fühlte. Also folgte ich ihnen und gelangte auf diese Weise bald in ein Viertel, in dem es eine reiche Auswahl an engen Tavernen und kleinen Gasthäusern gab, welche sich gegenseitig ohne Zweifel scharfe Konkurrenz lieferten. Allerdings wohl nicht an einem warmen Frühlingsabend wie diesem, denn es waren genug Menschen unterwegs, dass keiner der Wirte um seinen Gewinn zu fürchten brauchte.
Beschwingt ließ ich mich durch die, aus dutzenden Fenstern heraus erleuchteten Gassen treiben. Wie ein Verdurstender schwamm ich in einem See aus fröhlicher Musik, lautem Stimmengewirr und Gelächter, das aus den geöffneten Türen der Schänken zu mir hinaus drang.
Anfangs genügte mir das noch. Aber bald schon, als der erste Hunger nach Lebendigkeit gestillt war, verspürte ich das unbändige Verlangen, in eines der Wirtshäuser hinein zu gehen, um dort dem ausgelassenen Treiben der Menschen noch ein Stück näher zu sein. Ganz willkürlich wählte ich mir daher eines von ihnen aus und steuerte geradewegs darauf zu. Vor dem Eingang zögerte ich zwar noch einen Augenblick, denn ich hatte noch keine Ahnung davon, wie sich eine derart große, beengte Menge von Menschen auf mich auswirken würde. Doch die beruhigende Tatsache, dass ich vorerst gesättigt war, ließ mich letztendlich das Wagnis eingehen und die einzige Stufe zu der Wirtschaft hinaufsteigen, um sie zu betreten.
Als ich eintrat, schlug mir warme, verbrauchte Luft entgegen, geschwängert von einem Gemisch aus ranzigen, muffigen, wie auch würzigen, holzigen und schmackhaften Gerüchen, an deren Intensität sich meine empfindliche Nase erst einmal gewöhnen musste. Ich verharrte noch einen Moment im Eingangsbereich und ließ meinen Blick durch den kleinen, in schummriges Licht getauchten Raum schweifen.
Überall, wo ich auch hinsah, waren Menschen. Sie standen an der Theke, saßen an den Tischen, redeten aufeinander ein, brüllten vor Lachen oder schunkelten und sangen zu der Musik, mit der ein Harmoniumspieler, der an einem Barhocker lehnte, für heitere Stimmung sorgte. Die Wirtin bahnte sich, beladen mit dampfenden Speisen, die sie geschickt auf ihren Unterarmen balancierte, ihren Weg durch die Reihen der kartenspielenden, biertrinkenden und scherzenden Männer.
Ich stand da und war im Nu voller Begeisterung. Mein Herz sprang in meiner Brust, als wolle es gleich eifrig mittanzen und ein Kitzeln breitete sich in meiner Kehle aus, dass ich am liebsten laut gelacht hätte. Wie schön war es, fröhliche Menschen um sich zu haben und sich von ihrer Lebensfreude anstecken zu lassen! All die erdrückende Trübsal, die sich in den letzten Monaten in meiner Brust angesammelt, ja, sich bis in die letzte Pore meines Körpers festgesetzt hatte, löste sich auf einmal in fast kindliche Unbeschwertheit auf. Bald war ich so mit der Menge um mich herum verschmolzen, dass ich beinahe vergaß, was ich in Wirklichkeit war. Es kam sogar soweit, dass ich mir, sobald ich mich an einen freigewordenen Tisch gesetzt hatte, aus einer seltsamen Laune heraus ein Bier sowie, nach kurzem Zögern, auch noch eine Portion Bratkartoffeln bestellte.
Seit meiner Verwandlung hatte ich noch kein einziges Mal probiert, etwas anderes zu mir zu nehmen als Blut, und auf einmal wunderte ich mich, warum ich bisher noch nicht einmal darüber nachgedacht hatte... Plötzlich war ich fast besessen von dem Wunsch, Bratkartoffeln mit einem Bier dazu zu essen, und während ich ungeduldig darauf wartete, dass die Wirtin mir die ersehnte Mahlzeit endlich servierte, versuchte ich angestrengt, mir den Geschmack wieder in Erinnerung zu rufen. Doch ich hatte ihn vergessen.
Als dann das Gericht schließlich vor mir stand und mir sein in kleinen Wölkchen aufsteigender Duft verlockend um die Nase strich, erfüllte mich eine wohlige Vorfreude. Um den Geruch noch intensiver auszukosten, beugte ich mich über den Teller und sog genussvoll die Luft durch die Nase. Doch ich hatte den Atemzug noch nicht ganz zu Ende getan, da wurde meine Freude durch einen jähen Anfall von Übelkeit schlagartig wieder zunichte gemacht. Zunächst irritiert, doch dann zutiefst enttäuscht, schob ich das Essen ein Stück von mir fort.
Sollte es das gewesen sein? Würde ich in meinem ganzen restlichen Leben – und wer wusste, wie lange das noch dauern würde – niemals mehr etwas anderes kosten dürfen als Blut? Waren all die Geschmäcker dieser Erde für mich nun tatsächlich unwiederbringlich verloren, während meine feine Nase sie jedoch in all ihren vielversprechenden Facetten zu durchdringen vermochte und sie mir auf einem silbernen Tablett präsentierte?
Nein! Das wollte ich nicht einfach so hinnehmen!
Fest entschlossen, das Essen - allen inneren Widerständen zum Trotz - zu probieren, zog ich den Teller wieder an mich heran, spießte einen Stapel Bratkartoffeln auf meine Gabel und hob sie an. Doch während die Speise durchaus noch in der Lage war, mir Appetit zu bereiten, solange sie sich in sicherer Entfernung zu mir befand, so nahm dieser nun rapide ab, je näher sie meinen Lippen kam. Als ich mir schließlich die Gabel mit den Bratkartoffeln in den Mund führte, musste ich dabei sogar die Luft anhalten, damit der Geruch mich nicht zuletzt davon abhielt, die Bewegung auch zu Ende zu bringen.
Schließlich aber hatte ich es geschafft und kaute pflichtschuldig auf ihnen herum, bloß um letztlich betrübt feststellen zu müssen, dass der Geschmack bei Weitem nicht das widerspiegelte, was mir der Duft zuvor versprochen hatte. Am Ende kostete es mich wirklich erhebliche Willenskraft, den Bissen auch noch herunterzuschlucken. Mir gelang es zwar, aber kaum hatte er meine Mundhöhle Richtung Speiseröhre verlassen, da begann ich bereits, unvermittelt zu husten, gefolgt von einem erbarmungslosen Brechreiz. Sofort sprang ich auf und rannte, die Hand auf meinen Mund gepresst, hinaus auf die Straße, wo ich mich schwallartig übergab. Und obwohl damit der eine Bissen, den ich bloß zu mir genommen hatte, mehr als wieder heraus befördert worden war, wurde ich noch von einigen Würgekrämpfen geschüttelt, bevor es irgendwann endlich aufhörte.
Frustriert starrte ich auf die nun sehr unansehnlichen Bratkartoffeln zu meinen Füßen und wartete darauf, dass sich mein brennender Magen wieder beruhigte. Dabei gestand ich mir ein, dass mein Interesse an menschlicher Nahrung soeben deutlich nachgelassen hatte, um nicht zu sagen: ich war davon kuriert.
Da ich zum einen meine Rechnung noch nicht bezahlt hatte und zum anderen diesen Abend nicht auf diese ernüchternde Art und Weise ausklingen lassen wollte, kehrte ich, nachdem es mir etwas besser ging, in das Wirtshaus zu meinem Platz zurück und setzte mich. Den Teller mit dem von mir verschmähten Essen, drückte ich allerdings bei der nächsten Gelegenheit der Wirtin in die Hand, da ich weder den Anblick, noch den Geruch länger ertrug. Das Bier hingegen behielt ich, um so wenigstens den Anschein zu wahren, ich sei ein ganz gewöhnlicher Gast. Auch wenn dieses kleine Intermezzo zumindest mich selbst bedauerlicherweise wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückgeworfen und mir auf peinliche Weise vor Augen geführt hatte, dass ich eben doch anders war, als alle hier Anwesenden.
Durch diese unglückliche Eskapade nahezu vollständig meiner anfänglichen Hochstimmung beraubt, saß ich nun da, nippte hin und wieder an meinem Becher, ohne wirklich daraus zu trinken, und beobachtete dabei die Menschen, in der Hoffnung, dadurch wenigstens etwas von dem vorhin noch empfundenen Glücksgefühl wieder heraufbeschwören zu können. Und wie ich mich so beiläufig umschaute, bemerkte ich auf einmal, dass einer der Menschen mich beobachtete.
Es war ein älterer Mann, kostbar, aber ohne viel Zierde gekleidet. Er trug keine Perücke, wie es sonst in höheren Kreisen, gerade bei den älteren Herrschaften noch weit verbreitet war. Doch sein immer noch volles, wenn auch vollständig ergrautes Haar war nach zeitgemäßer Manier frisiert. Allerdings hatte er sich auch hier eher für die schlichte Variante entschieden. Sein blasses Gesicht strahlte beim ersten Hinsehen eine fast lehrmeisterliche Strenge aus, die mir unweigerlich ein gewisses Unbehagen bereitete und dazu führte, dass ich es nach Möglichkeit vermied, seinem Blick zu begegnen.
Und doch, irgendetwas darin machte mich neugierig. Es war eine gewisse Unstimmigkeit, eine Diskrepanz seiner Falten, die sich bereits tief in sein Antlitz gegraben hatten. Denn konzentrierte ich mich bloß auf seine Mundwinkel, so fand ich dort diese eben beschriebene Strenge und Bitterkeit, aber wanderte ich dann hinauf zu seinen Augen, wich diese zunehmend einer Lebendigkeit, die sowohl von tiefgründiger Heiterkeit, wie auch von resignierter Traurigkeit kündete.
Anfangs kreuzte ich seinen Blick stets scheinbar zufällig, in der Hoffnung, mir den Herrn in einem unbeobachteten Moment einmal eingehender betrachten zu können. Aber je öfter ich dies versuchte, desto deutlicher musste ich erkennen, dass er mir selbst unverhohlen dabei zusah, wie ich alleine dasaß, aus meinem Becher trank, ohne dass dieser sich leerte, und mich meinen Betrachtungen hingab.
Zunächst bemühte ich mich, einfach darüber hinwegzusehen und mich auf die Wirtin zu konzentrieren, die wieder einmal ein halbes Dutzend überschäumende Bierkrüge durch den Raum schaukelte. Dann lenkte ich meine Aufmerksamkeit auf zwei zankende Männer, die sich gegenseitig beim Kartenspielen übers Ohr gehauen hatten und es nun jeder für sich abstritten. Auf diese Weise tat ich es noch mit vielen anderen Szenen, die sich um mich herum abspielten. Doch seit ich wusste, dass der Alte mich dabei beobachtete, fühlte ich mich zunehmend befangen, sodass ich schließlich beschloss, zu zahlen und die Taverne zu verlassen.
Mit einem verärgerten Blick in seine Richtung stand ich auf und wollte gerade gehen, als er mich mit einem entschuldigenden Lächeln und einem kurzen Wink dazu aufforderte, mich doch zu ihm zu setzen.
Ich zögerte.
Der Alte bemerkte dies und erhob sich förmlich, um mir mit einer angedeuteten Verbeugung einen Stuhl anzubieten, den er etwas von dem Tisch zurückzog. Dabei sah er mich auf eine Weise an, die einerseits sein besonderes Interesse an mir, als auch eine anziehende Warmherzigkeit verriet.
Hin- und hergerissen zwischen dem Ärger über die fehlende Diskretion des Alten sowie der Wissbegier, was er sich wohl von mir versprechen mochte, entschloss ich mich schließlich dazu, seinem Angebot zu folgen.
Stumm ging ich zu ihm hinüber, setzte mich auf den angebotenen Stuhl, lehnte mich betont lässig zurück und betrachtete ihn fragend mit einer hochgezogenen Augenbraue, als wolle ich ihn dadurch zur Rechenschaft ziehen. Schmunzelnd und ohne auch nur im Geringsten Anstoß an meiner Gebärde zu nehmen, streckte der Alte mir zum Gruß seine Hand entgegen.
`Mein Name ist Heinrich von Schwarzenstein.´ Die Stimme des Alten hatte etwas von einer rostigen, frisch geölten Radnabe: sie klang widerstandslos dahin gleitend und doch rau.
Schweigend erwiderte ich die Geste und reichte ihm auch meine Hand.
`Und wie nennt man Sie?´, fragte er, während er um den kleinen Tisch herumging und mir gegenüber wieder Platz nahm.
`Warum beobachten Sie mich?´, erwiderte ich bloß grob und überging damit die Vorstellung einfach.
Heinrich allerdings zeigte sich nicht weiter durch meine Unhöflichkeit beeindruckt. Er lächelte bloß milde, als sehe er sie mir verständnisvoll nach.
`Wollen Sie mir nicht doch Ihren Namen verraten, bevor wir das Gespräch beginnen?´
`Wenn ich es gewollt hätte, hätte ich es wohl getan, nicht wahr?´ Um meine strikte Haltung noch zu unterstreichen, verschränkte ich meine Arme vor der Brust und blickte Heinrich direkt in die Augen. Dieser aber grinste nur darüber und für einen kurzen Moment fühlte ich mich an einen Lehrer erinnert, der sich über seinen trotzigen Schüler amüsiert.
`Nun gut, Namenloser, dann erfahre ich Ihren Namen vielleicht später?´, fragte er und zwinkerte mir dabei zu.
`Also, warum beobachten Sie mich?´ beharrte ich, ohne weiter auf seine Bemerkung einzugehen.
Ich wollte es in der Tat brennend gerne wissen und je mehr ich mich von Heinrich wie ein kleiner Schuljunge vorgeführt fühlte, desto ungehaltener wurde ich darüber. Zuletzt überlegte ich ernsthaft, ob ich überhaupt bereit war, noch auf eine Antwort zu warten oder ob ich nicht einfach aufstehen und gehen sollte. Sollte er sich doch über jemand anderes lustig machen...
`Sie sind anders als die Anderen hier´, antwortete Heinrich dann aber so unvermittelt und mit solch überraschend plötzlichem Ernst, dass ich ihn bloß anstarrte. Er erwiderte meinen Blick und aus seinem Gesicht war dabei jedweder Schalk gewichen.
`Ich sehe den Tod in Ihren Augen´, fuhr er ohne Umschweife fort.
Das verschlug mir nun vollends die Sprache. Ich muss zugeben, dass ich in dem ersten Moment einfach nur verblüfft, ja, sogar betroffen war. Und während ich noch darüber nachdachte, wie Heinrich diese Worte wohl gemeint haben könnte, spürte ich, wie er mich interessiert betrachtete, fast als untersuche er mich, ohne sich darüber bewusst zu sein, dass sein Gegenüber kein Forschungsobjekt, sondern – na ja, zumindest dem Anschein nach – ein Mensch darstellte.
`Ich fürchte, ich verstehe nicht, was Sie da reden´, flüchtete ich mich aus der Situation heraus.
`Oh, verzeihen Sie!´ Heinrich rückte noch etwas näher an den Tisch heran und stützte sich mit den Armen darauf ab, während er sich ein Stück zu mir vorbeugte.
`Lassen Sie mich meine Äußerung genauer erklären!´
Ich nickte bloß kurz.
`Nun, wie soll ich beginnen...´ Nachdenklich runzelte er die Stirn und blickte dabei versonnen auf seine Hände, die er vor sich gefaltet hatte. Dann, als wisse er jetzt die Worte, mit denen er anfangen wollte, hob er den Kopf, um mir wieder ins Gesicht zu schauen.
`Ich habe den Tod in schon vielen Gesichtern gesehen. Ich sah ihn beispielsweise bei meiner Frau und leider auch bei meinem einzigen Sohn... Ich sah ihn außerdem noch bei vielen anderen Menschen: Freunden, Verwandten, Kameraden. Dabei hatten jedoch alle etwas gemeinsam: sie waren zu diesem Zeitpunkt entweder ernsthaft erkrankt oder schwer verletzt. Und...´, Heinrich machte eine betretene Pause, `...sie sind alle bald darauf verstorben.´
Erneut schwieg Heinrich und betrachtete seine furchigen Hände, die noch immer wie zwei verschlungene Baumwurzeln auf dem Tisch ruhten. Dann richtete er seinen stahlblauen Augen wieder auf mich.
`Doch es ist nicht nur das... Ich bin nun selber alt und meine Jahre auf dieser Erde sind gezählt... Glauben Sie mir, nicht zuletzt auch dies schärft meinen Blick.´
Ich hatte Heinrich aufmerksam zugehört und doch fehlte mir die Verbindung zu dem, was er nun über mich behauptet hatte. Er konnte doch unmöglich wissen, was ich war...
Heinrich bemerkte meine Skepsis und bemühte sich, rasch fortzufahren.
`Sie allerdings fallen vollkommen aus dem Rahmen! Wenn ich in Ihre Augen schaue, dann erkenne ich darin den Tod, doch alles an Ihnen erscheint bei bester Gesundheit, strotzend vor Kraft und Energie. Ein junger Mann in seinen besten Jahren...´
Heinrich kniff die Augen zusammen, als hoffe er, auf diese Weise durch meine äußere Erscheinung hindurch in mein Inneres blicken zu können. So sah er mich eine Weile an. Dann jedoch gab er seinen Versuch mit einem leichten Kopfschütteln auf und sprach endlich weiter: `Nein, es ist nicht allein in Ihren Augen... Das ist falsch! Es ist nicht der Tod, der Sie bedroht... Es ist eher...´ Heinrich zögerte einen Moment und auf einmal weiteten sich seine Augen, `...es ist eher der Tod, der Sie umgibt... oder begleitet... Ja, das ist es!´
Heinrich sah mich an, als habe er plötzlich etwas an mir entdeckt, das ihn erschreckte, aber ebenso auch faszinierte, und ich selbst war schlicht weg beeindruckt.
Woran genau konnte er den Tod erkennen? Und wie konnte er ihn so exakt begreifen? Wusste er womöglich mehr über mich, als er vorgab?
Ich saß skeptisch zurückgelehnt auf meinem Stuhl und beobachtete Heinrich aufmerksam, ohne dabei auch nur eine Miene zu verziehen. Ich beobachtete ihn dabei, wie er mich eingehend studierte und auf meine Reaktion wartete. Doch ich hielt es für klüger, nur ihn sprechen zu lassen und blieb daher stumm.
Plötzlich lächelte Heinrich. Er lächelte mir unverwandt ins Gesicht, ohne den Anflug eines Misstrauens oder der Ablehnung. Es lag nichts als ein zutiefst ehrlicher Ausdruck darin und ich merkte, dass ich geneigt war, ihm blindlings zu vertrauen; allein wegen dieses Lächelns.
Dann nahm Heinrich seinen Becher, der noch einen Rest Bier enthielt, und leerte ihn mit einem Zug. Zufrieden stellte er ihn ab und wandte sich wieder an mich.
`Was halten Sie davon, mich in mein Haus zu begleiten. Dort können wir in Ruhe reden. Wenn Sie mögen, spielen wir auch eine Partie Schach?´
Ich zögerte abermals.
Was wollte Heinrich von mir? Wollte er mich vielleicht in eine Falle locken? Das abschreckende Erlebnis mit dem Nachtwächter hatte mir mehr als ausgereicht, um Respekt vor den Menschen zu haben, ja sogar, um mich davor zu fürchten, von ihnen durchschaut zu werden. Auf der anderen Seite konnte ich mir eigentlich sicher sein, dass Heinrich gar nichts über mich wissen konnte. Ich war gerade erst in dieser Stadt angekommen und ein weiteres Wesen wie mich gab es nicht. Wenn die Menschen über Vampire sprachen, schienen sie keine Ahnung zu haben, wie diese überhaupt aussahen. Was also hatte ich zu befürchten? Vielleicht war es wirklich einfach bloß Interesse, das Heinrich an mir hatte, aus eben den Gründen, die er mir vorhin genannt hatte; und eine unglaublich feinsinnige Intuition, die ihm ein präzise zutreffendes Gefühl vermittelte, ihm aber keine Erklärung dazu liefern konnte...
Dazu kam, dass ich mich ebenso von ihm angezogen fühlte. Und auch ich konnte noch nicht genau erklären, warum das so war. Aber aus irgendeinem Grund war ich geblieben, als ich ebenso gut noch hätte gehen können.
Nein, eigentlich war es keine Frage mehr, ob ich ihn begleiten würde oder nicht. Die Entscheidung hatte ich bereits getroffen, und zwar in dem Moment, in dem ich mich zu ihm gesetzt hatte.
`Also gut, ich nehme Ihre Einladung an´, sagte ich schließlich und Heinrich nickte mit einem sichtlich erfreuten Grinsen um die Mundwinkel.
Mit einer knappen Handbewegung winkte er die Wirtin heran, um zu bezahlen und verließ anschließend mit mir die Wirtschaft.
Draußen stand eine Berline bereit. Der Fahrer kauerte mit verschränkten Armen auf seinem Sitz und war wohl während der langen Wartezeit eingenickt. Als Heinrich ihn anrief, schreckte er zusammen und schaute sich für einen kurzen Moment lang etwas verwirrt um, als habe er gerade etwas geträumt. Dann aber besann er sich, sprang von seinem Sitz herunter und öffnete die Kabinentür, um uns einsteigen zu lassen. Kurze Zeit später setzte sich die Kutsche in Bewegung und trug uns laut klappernd über das holprige Straßenpflaster zur Stadt hinaus und dann auf einer kleinen unbefestigten Landstraße Richtung Süden. Während der Fahrt saßen Heinrich und ich uns gegenüber und ich bemerkte aus dem Augenwinkel, dass Heinrich mich immer wieder interessiert musterte. Ich selbst hingegen bevorzugte es, die meiste Zeit über aus dem Fenster zu schauen, und zwischendurch folgte Heinrich meinem Blick, als wüsste er gerne, was ich dort draußen in der für seine Augen fast undurchdringlichen Dunkelheit zu sehen vermochte.
Nach ungefähr einer halben Stunde Fahrt näherte sich unsere Kutsche einem kleinen Schlösschen, dessen Fenster im Erdgeschoss noch vereinzelt erleuchtet waren. Zuletzt bog sie auf einen Weg ein, der direkt darauf zuführte, und hielt schließlich vor dem Eingangsportal an.
Der Kutscher stieg ab und öffnete uns abermals die Kabinentür, worauf Heinrich mir mit einer einladenden Geste gebot, vor ihm auszusteigen. Zögernd kam ich dem nach, blieb aber dann staunend vor der Kutsche stehen, um das Schloss, das sich vor uns erhob, genauer zu betrachten.
Wie zwei Wächter, war beidseits eines verspielten, zweigeschossigen Haupttrakts jeweils ein runder, oben spitz zulaufender Turm postiert, jeder angeschlossen an einen ebenerdigen Seitenflügel. Zu dem zentral gelegenen Eingangsportal wand sich von beiden Seiten eine geschwungene Treppe hinauf, um sich dort zu einer kleinen, halbrunden Terrasse zu vereinigen. Überall, wo ich auch hinsah, krochen blühende Sträucher und Ranken die Wände empor, was dem Gebäude etwas Märchenhaftes verlieh.
Hätte man mich vorher gefragt, wie ich mir Heinrichs Heim vorstellte, so hätte ich viele Ideen gehabt, die aber allesamt mit der Wirklichkeit wenig gemeinsam gehabt hätten. Kurzum: ich war überrascht, aber es gefiel mir.
`Wollen Sie mir nicht folgen?´, fragte Heinrich nach einer Weile leise, als wolle er mich nur ungern stören. Durch seine Worte aus meiner Versunkenheit gerissen, schüttelte ich den Kopf.
`Aber natürlich´, sagte ich bloß und stieg daraufhin hinter ihm die Stufen zum Eingang hinauf.
Kaum waren wir vor der Tür angekommen, wurde diese von einem Diener geöffnet und wir betraten eine großzügige Eingangshalle, beherrscht von einer breiten, sich nach oben verjüngenden Treppe. Ein roter Teppich lief ihre Stufen hinauf, bis zu der Galerie, in die sie mündete, und führte von dort aus zu den obigen Zimmern.
Zu unserer Linken wie zur Rechten befanden sich riesige, zweiflügelige Türen, die gerade offen standen, sodass ich einen Blick hindurch werfen konnte. Präsentiert wurde mir zu jeder Seite ein großräumiger Salon, über den man wiederum in das nächste Zimmer gelangte.
Nun war ich ja selber nicht verarmt aufgewachsen, aber ich musste zugeben, dass dies hier das Gut meiner Eltern doch um einiges an Größe und Ausstattung übertraf.
Heinrich führte mich durch den Salon des rechten Flügels zu seinen privaten Räumlichkeiten, die kleiner und viel wohnlicher eingerichtet waren als der Salon selbst. Dort betraten wir eine kleine Bibliothek – seine ganz Persönliche, wie er erwähnte; denn es gab ebenso noch eine Große in dem anderen Flügel, die er jedoch eher zu repräsentativen Zwecken zu nutzen pflegte, auch wenn diese mittlerweile sehr selten geworden waren.
Drei der vier Wände waren bis zur Decke mit Regalen bekleidet, lückenlos ausgefüllt mit Büchern, und die Vierte war auch nur deswegen frei geblieben, weil sich dort ein großes Fenster befand, das dem Leser am Tage das Kerzenlicht ersparen sollte. Dementsprechend waren darunter zwei rot gepolsterte Lehnstühle, eine Chaiselongue sowie ein zierlich geschwungener Tisch gruppiert; alles, ebenso wie die Regale, aus dunkler Eiche gefertigt. Auf dem Tischchen thronte ein großes Schachbrett aus schwarzem Holz. Die weißen Felder hingegen waren aus Perlmutt gearbeitet und die Figuren dazu bestanden aus dem entsprechend gleichen Material.
Eine nahe stehende Leuchte sowie ein kleiner Kronleuchter an der Decke waren dazu gedacht, auch nach Sonnenuntergang noch für ausreichendes Licht zum Lesen zu sorgen und so waren sie auch jetzt entzündet.
Heinrich lud mich ein, Platz zu nehmen, doch ich bat darum, mich noch etwas umsehen zu dürfen.
Langsam schritt ich die Regale entlang, las die Titel mancher Bücher, zog das ein oder andere heraus, um es näher zu betrachten, und stellte es dann wieder zurück. Dabei versuchte ich mir ein Bild von Heinrich zu machen, der all diese Bücher gelesen hatte und indes höflich abwartete, bevor er schließlich wieder das Wort ergriff.
`Darf ich Ihnen etwas anbieten? Einen Wein vielleicht?´
Ich drehte mich zu ihm um und schüttelte den Kopf.
`Nein, vielen Dank, ich bin gerade nicht... durstig.´
Dann wandte ich mich wieder den Büchern zu. Heinrich griff derweil nach einer mit Rotwein gefüllten Karaffe, die auf einem kleinen Servierwagen nahe der Tür bereitstand, und goss sich selbst daraus etwas in ein Kristallglas ein.
`Sie haben so unglaublich viele und insbesondere kostbare Bücher hier´, stellte ich fest, ohne mich dabei zu Heinrich umzudrehen.
`Es hat sich im Laufe meines Lebens so einiges angesammelt. Und ich muss zugeben, dass die Bücher in den letzten Jahren häufig meine einzige Gesellschaft waren. Die meiste Zeit des Tages verbringe ich in der Tat hier bei ihnen.´
Überrascht drehte ich mich um und sah Heinrich an. In seinen Zügen lag etwas Melancholisches und als mein fragender Blick dem Seinen begegnete, wich er ihm aus und betrachtete stattdessen die Bücherwand hinter mir.
`Wollen Sie damit sagen, dass Sie ganz alleine hier leben?´, fragte ich.
Er nickte bloß und senkte für einen Moment den Blick, um in ein imaginäres Loch im Boden vor sich zu starren. Ganz offensichtlich hatte ich einen wunden Punkt bei ihm berührt und nun wagte ich es nicht, noch weiter zu fragen, auch wenn es mich brennend interessierte.
Da aber begann Heinrich ganz von selbst zu erzählen.
`Seit ich vor einigen Jahren meine Frau und nur wenig später auch noch meinen einzigen Sohn verloren habe, steht mir der Sinn nicht mehr oft nach Gesellschaft... Es kommt nur selten vor, dass ich, wie heute Abend, einmal ausgehe und mich irgendwo hinsetze, um die Menschen zu beobachten. Dabei mag ich mich nicht einmal mit ihnen unterhalten. Ich habe ihnen nicht viel zu sagen und sie mir nicht.´
Heinrich machte eine Pause, als würde er sich selbst gerade erst gewahr, wie trübselig seine Worte klingen mussten. Nach einem tiefen Atemzug sprach er schließlich weiter: `Für mich allein brauche ich zudem nicht viel Dienstpersonal, sodass ich auch das auf das Nötigste reduziert habe. Mein alter Diener Christian ist einer der Wenigen, mit denen ich ab und an freundschaftliche Gespräche pflege oder auch mal eine Partie Schach spiele.´
Heinrich, der bis jetzt so gewirkt hatte, als habe er sich in weiter Ferne verloren, schien auf einmal wieder zurückzukehren, um mich geradewegs anzusehen. Dabei nahm sein Gesicht so plötzlich den Ausdruck eines freudigen Lächelns an, dass ich mich für einen kurzen Moment innerlich schütteln musste.
`Nun, jetzt aber habe ich Sie getroffen und ich muss sagen, Sie sind seit langem der erste Mensch, der mich neugierig macht! Denn obgleich Sie im Gegensatz zu mir jung sind und Ihnen das ganze Leben noch offen steht, so erkenne ich doch bei Ihnen die gleiche Einsamkeit wie bei mir... Wenn ich sie ansehe, erkenne ich mich selbst in Ihnen. Und dann wieder kommt es mir vor, als blicke ich meinem Sohn in die Augen. Sie sind mir seltsam vertraut, ohne dass ich sie kenne. Einzig den Tod, den ich bei Ihnen spüre, kann ich mir nicht erklären...´
Heinrich musterte mich mit seinem scharfen Blick, als versuche er durch die Art meiner Reaktion herauszufinden, was genau ich hinter meiner Fassade verbarg, die zu lüften ich allerdings ganz und gar nicht gewillt war, und um ihn möglichst von seiner Erklärungssuche abzubringen, schaute ich nun betont interessiert auf das Schachbrett, neben dem ich gerade stand. Wie beabsichtigt, folgte Heinrich meinem Blick.
`Wollen wir spielen?´, fragte ich.
`Gerne´, antwortete er – vielleicht ein wenig enttäuscht, noch keine befriedigende Antwort auf seine Fragen erhalten zu haben. Und so setzten wir uns an den Tisch mit dem Brett und eröffneten das Spiel. Dabei sprachen wir zwar nicht, doch während wir die schwarzen und weißen Figuren für uns kämpfen ließen, nutzten wir jeweils den Zug des anderen, um einander verstohlen zu beobachten. Ab und zu begegneten sich unsere Blicke auch dabei, aber stets nur kurz, denn keiner wollte seinem Gegenüber in diesem Moment zu nahe treten.
Bei aller Neugier, die Heinrich für mich aufbrachte, so ging es mir nicht anders. Auch ich fragte mich, was sich hinter Heinrich verbarg. Welche Tiefe musste seine Seele besitzen, dass er so genau erkennen konnte, wen oder was er vor sich hatte. Was war er für ein Mensch?
Jetzt mochte er einsam sein, alt, zurückgezogen und häufig melancholisch, aber ich nahm noch etwas ganz anderes bei ihm wahr. Etwas durchaus sehr Lebendiges. Hin und wieder konnte ich ganz deutlich einen Funken in seinen Augen glimmen sehen, der zwischendurch an Kraft gewann und aus dem – da war ich mir sicher – noch immer ein Feuer erwachsen konnte.
Wie war er wohl gewesen, als er so alt war wie ich?
`Schach!´
Heinrich riss mich aus meinen Gedanken. Ich hatte unkonzentriert gespielt und war nun unfähig zu reagieren, sodass er beim nächsten Zug gewonnen hatte. Ein siegreiches Lächeln erhellte sein Gesicht.
`Und, darf ich denn nun erfahren, gegen wen ich soeben gewonnen habe?´, fragte er charmant.
`Armon... Armon von Dargun´, antwortete ich diesmal, ohne noch viel Aufhebens darum zu machen, denn ich hatte inzwischen beschlossen, das Risiko einzugehen und Heinrich zu vertrauen. Ich hatte ihm das Tor zu meinem Herzen geöffnet, ohne zu ahnen, welch Unheil daraus erwachsen würde.
Wir spielten noch eine Revenge, die ich leider abermals verlor, und verwickelten uns danach in ein Gespräch, das bis tief in die Nacht hinein dauerte. Dabei war Heinrich allerdings so diskret, keine weiteren persönlichen Fragen mehr an mich zu richten, und ich sah mich vor, nicht zu viel von mir preiszugeben. Dennoch boten sich genug andere Themen, über die wir uns angeregt unterhielten und ich genoss es einfach, endlich wieder mit einem Menschen Gedanken, Ideen und Humor zu teilen.
Anfangs fühlte ich mich ihm gegenüber zwar noch etwas befangen. So hatte ich beispielsweise die Sorge, dass Heinrich durch irgendwelche Äußerlichkeiten - wie zum Beispiel meiner spitzen Eckzähne - Verdacht schöpfen könnte, und ich versuchte mich daher insbesondere beim Lachen zurückzuhalten. Aber nach einer Weile gab ich es auf und dachte mir bloß: Sei es drum; jemand, der nicht wusste, was ein Vampir ist, würde auch nicht aufgrund etwas absonderlicher Eckzähne darauf kommen, dass dieser unmittelbar vor ihm sitzt.
Und in der Tat, Heinrichs zunehmend heitere Stimmung schien durch nichts getrübt zu werden, was er an mir zu sehen vermochte. Im Gegenteil, er versicherte mir mehrmals, dass er schon lange nicht mehr so fröhlich gewesen war.
Gegen frühen Morgen jedoch merkte ich, dass Heinrich langsam müde wurde und entschied aufgrund dessen, mich auf den Heimweg zu begeben. Der Abschied fiel mir allerdings schwer, denn ich hätte gerne noch mehr Zeit mit Heinrich verbracht. Umso glücklicher war ich daher, als er vorschlug, sich bald wieder zu treffen.