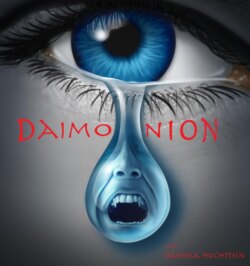Читать книгу Daimonion - Daniela Hochstein - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 4
ОглавлениеDie Sonne riss mich mit einer Grausamkeit aus dem Schlaf, die eher an eine Folter denken ließ.
Zuerst wusste ich gar nicht, wie mir geschah. Ich hatte das Gefühl, als würde mein Blut wie ein feuerroter Strom aus glühender Lava unaufhaltsam durch meine Adern kriechen und meinen Körper von innen verzehren. Davon erschrocken und im Nu hellwach, sprang ich auf und blickte hektisch an mir herunter, wobei ich allerdings äußerlich nichts Ungewöhnliches an mir entdecken konnte. Von dieser Tatsache allerdings nur wenig beruhigt, fragte ich mich, woher dieser Schmerz in mir rührte? Was hatte er zu bedeuten? Und würde er etwa noch schlimmer werden?
Besorgt schaute ich mich in der Kammer um, ob hier möglicherweise irgendwo die Ursache für dieses unheilvolle Phänomen zu finden war, und dabei trat ich unwillkürlich in den Lichtkegel aus Sonnenstrahlen, die zaghaft durch eine kleine Luke hereintropften. Zum Glück, muss ich sagen, war das Fenster nicht größer gewesen, denn als mich die wenigen Strahlen daraufhin mitten ins Gesicht trafen, stachen sie mir wie spitze Dornen in meinen Augen. Sofort riss ich meinen Arm in die Höhe, um sie zu schützen, doch dies führte bloß dazu, dass die Sonne jetzt dort meine Haut verbrannte, als hätte mir jemand kochendes Wasser darüber gegossen. Mit einem kurzen Aufschrei duckte ich mich hastig unter den plötzlich so bedrohlichen Strahlen hinweg, um ihnen zu entgehen. Aber auch wenn danach wenigstens meine Haut nicht mehr verbrannte, so blieb das Kochen in meinen Adern doch weiterhin bestehen, ja es schien sich sogar noch zu steigern und versetzte mich zunehmend in Panik. Wie vom Teufel gejagt, blickte ich mich eilig in der Kammer um, in der Hoffnung, dabei irgendeine Zuflucht zu finden, und letztendlich war es das Bett, unter dem ich mich wie ein völlig verstörter Maulwurf verkroch, um in dessen dunklen Schatten endlich Erlösung von dieser entsetzlichen Pein zu finden.
Mit dieser Erlösung kam auch der Schlaf. Allerdings war dieser nun anders als vorhin, denn da hatte ich geschlafen wie ein Mensch, mit einem Unterbewusstsein, das noch über mich wachte, mich mit Träumen unterhielt und mir ein Gefühl von Zeit schenkte. Nun jedoch schlief ich wie ein Toter.
Wie konnte ich wissen, dass es so war? Ich kann es nicht erklären, aber ich fühlte es. Dieser Todesschlaf, in den ich seither jeden Morgen falle, ist absolut imperativ und völlig leer. Es gibt kein Zeitgefühl, keine Träume, kein Erwachen zwischendurch, keine Form des Bewusstseins. Auch nicht in der Nachbetrachtung. Es ist, als sei ich über diesen Zeitraum einfach nicht existent; als hätte ich die Augen bloß für einen kurzen Moment geschlossen... Genauso ist das Erwachen. Wie eine Uhr zur vollen Stunde schlägt, so werde ich wach. Immer zur Abenddämmerung. Unabhängig allerdings von der Uhrzeit. Ich könnte nicht früher aufstehen, selbst wenn ich es mit aller Kraft gewollt hätte. Ebenso obliegt es nicht meiner Willenskraft, länger in diesem Todeszustand zu verharren. Mein Körper gehorcht ganz einfach Gesetzen, auf die ich selbst keinen Einfluss habe. Und so bin ich seit jener Nacht vom Tage und somit auch von dem Alltag der Menschen unwiederbringlich ausgeschlossen.
Allerdings wurde mir erst viel später klar, was das für mein weiteres Leben bedeutete...
Als ich am kommenden Abend wieder erwachte, war ich zunächst erleichtert, dass die Sonne untergegangen und die Marter, die sie mit sich gebracht hatte, vorüber war. So sehr ich die Sonne bis dahin geliebt hatte, so war mir nun doch schmerzlich bewusst, dass ich sie in meinem derzeitigen Zustand strikt meiden musste, wie lange dieser sich auch noch hinziehen mochte.
Um mich noch einmal der Folgen ihrer Strahlen zu vergewissern, untersuchte ich meinen Arm, den sie verbrannt hatte. Doch zu meiner Überraschung stellte ich fest, dass die Haut vollständig wieder verheilt war. Zum Glück schien sich mein Körper ungewöhnlich rasch von seinen Wunden zu erholen, oder aber die wenigen Strahlen hatten einfach nicht ausgereicht, um ihm nachhaltig zu schaden.
Wie dem auch war, ich war jedenfalls nicht im Geringsten daran interessiert, derartiges noch einmal zu erleben.
Jetzt, wo es draußen dunkel geworden war, fühlte ich mich nicht mehr so müde und schwer wie noch am Morgen, sondern vielmehr stark und voller Vitalität. Gleichzeitig jedoch begann auch wieder dieser unnatürliche Durst nach Blut beharrlich in meinen Adern zu wühlen. Noch war er allerdings nicht groß genug, als dass er fähig gewesen wäre, das bedrückende Gefühl von Verzweiflung und Verwirrung zu überdecken, das ich nun empfand, wo ich die nötige Ruhe hatte, mir der Geschehnisse der letzten Nacht bewusst zu werden. Noch hatte ich die Muße, mich mit allerlei Fragen zu quälen. Zum Beispiel mit der Frage, was aus mir geworden war? Was hatte zu dieser befremdlichen Veränderung geführt, die sich mit meinem Körper vollzogen hatte? War es etwa eine seltene Krankheit, die mich befallen hatte? Konnte ich von diesem Zustand wieder genesen? War das überhaupt alles wirklich geschehen?
Noch immer befand ich mich unter dem Bett in der kleinen Kammer dieses verfluchten Hauses – was für meine Befürchtung sprach, dass dieser Albtraum Wirklichkeit war - und der Geruch nach beginnender Verwesung, der mich umgab, verriet mir, dass die Leichen nebenan keinesfalls einer kranken Phantasie, sondern der schonungslosen Realität entsprachen.
Langsam - wohl, um einfach etwas zu tun - kroch ich unter dem Bett hervor, wie der Beelzebub aus seiner Hölle, stand auf, klopfte mir den Staub von den Kleidern - eigentlich eine alberne Geste in Anbetracht der ganzen Situation - und war schlicht weg aufgeschmissen. Ohne diesen erbarmungslosen Durst wäre ich wohl wie paralysiert gewesen; hätte mich einfach nicht mehr bewegt, nicht mehr nachgedacht oder wäre vielleicht einfach verrückt geworden. Aber dieser eigenartige, existenzielle Durst, den ich in dieser Form noch nie erlebt hatte - war es doch vielmehr eine untrennbare Kombination aus Hunger, Durst und triebhaftem Verlangen - spornte mich an, füllte meine Gedanken und gab mir ein unverkennbares Ziel: Blut!
Zuerst aber musste ich fort von hier! Der Leichengestank, der unter dem Türspalt herein quoll wie der unheilversprechende Geist einer Seuche, war kaum zu ertragen und ich wollte ihn so schnell wie möglich hinter mir lassen. Doch als ich das Schlafzimmer verließ und den Wohnraum auf meinem Weg nach draußen durchqueren wollte, traf mich der Schlag.
Das, was ich dort vorfand, machte mich derart betroffen, dass ich selbst den hartnäckigen Durst für eine Zeit lang in den Hintergrund drängen konnte: Auf dem Boden, neben den Leichen, kauerten eng aneinander zwei Kinder. Das ältere, ein Junge, musste ungefähr zehn Jahre alt gewesen sein und das jüngere war ein Mädchen von schätzungsweise fünf Jahren. Erschrocken schnellten ihre Köpfe in die Höhe, als ich die Tür der Schlafkammer öffnete, und sie starrten mich aus ihren tränenverschmierten Gesichtern an, als sei ich mit einem Donnerschlag vor ihren Augen aus dem Boden aufgefahren.
Was glaubten sie wohl, in diesem Moment vor sich zu sehen? Erkannten sie in mir das Monster, das letzte Nacht hier gewütet hatte? Oder hatten sie mich gar dabei beobachtet?
Langsam schritt ich auf sie zu und ging in noch sicherer Entfernung vor ihnen in die Hocke.
`Habt keine Angst!´, sagte ich, bemüht darum, beruhigend zu klingen. `Ich habe keine bösen Absichten.´
Der Junge betrachtete mich skeptisch. Er schien mir nicht zu trauen, was mit Blick auf seine ermordeten Eltern auch nicht gerade verwunderlich war. Mutig und mit der Todesverachtung eines Kindes reckte er sein Kinn vor und fragte mit zorniger Stimme: `Wer hat unsere Eltern getötet?´
Ich zögerte. Was sollte ich ihm antworten? Der Anblick der Leichen erfüllte mich selbst noch mit Schrecken und Abscheu.
`Warst du es?´, setzte er schließlich nach.
Schnell insistierte ich: `Nein!... Nein, es war... jemand anderes! Ich... ich konnte es leider nicht mehr verhindern.´ Der Junge sah mich mit zu einem schmalen Spalt zusammengekniffenen Augen an, sagte jedoch nichts weiter, obwohl er, davon war ich überzeugt, mir nicht glaubte.
Ich erwiderte seinen Blick schuldbewusst und fragte mich dabei, wie ich nun mit diesen Kindern verfahren sollte. Ich hatte schon Elend genug über sie gebracht und hätte mir selbst nicht mehr ins Gesicht sehen können, wenn ich sie jetzt einfach ihrem unseligen Schicksal überlassen hätte.
Nein, ich fühlte mich vielmehr dazu verpflichtet, ihnen etwas zurückzugeben für das, was ich ihnen so selbstsüchtig und grausam gestohlen hatte!
Auf der anderen Seite aber spürte ich, wie der Durst bedrohlich in mir nagte und diesen beiden leichten Opfern gegenüber nicht gerade abgeneigt war. Glücklicherweise jedoch waren Anstand und Mitgefühl im diesem Moment noch stark genug, um diesem Impuls empört zu widerstehen. Allerdings aber führte mir dieser Umstand auch nur all zu deutlich vor Augen, dass es für die Kinder einem Himmelfahrtskommando gleichgekommen wäre, wenn ich mich selbst Ihrer angenommen hätte.
Nach einigem Überlegen kam mir jedoch eine Idee, mit der ich auch gleichzeitig die Hoffnung verband, mich anschließend wieder halbwegs menschlich fühlen zu können. Denn bis hierhin war ich mir immer mehr wie eine seelenlose Bestie vorgekommen.
Ich wandte mich daraufhin an den Jungen und begann mit wohl bedachten Worten: `Es wird euch sicherlich schwer fallen, aber hier könnt ihr nicht bleiben, Kinder. Ich werde euch fortbringen, an einen Ort, wo man sich um euch kümmern wird.´
Ich hatte gehofft, mit meinem Vorhaben auf gewisse Einsicht zu treffen, aber der Junge starrte mich bloß wütend an und ballte dabei seine Fäuste, als hätte er gerne gegen mich aufbegehrt. Doch mit einem abwägenden Blick auf seine kleine Schwester, die sich zitternd an ihn drängte, schien ihm klar zu werden, dass sie letztlich keine andere Wahl hatten, und so fügte er sich mit zusammengepressten Lippen meinem Plan, ohne noch weiter zu widersprechen.
`Habt ihr auf diesem Hof ein Pferd?´, fragte ich ihn weiter, worauf er mich jedoch bloß wortlos ansah, als schien er zu überlegen, welche Antwort nun die Klügste wäre. Schließlich aber nickte er verhalten.
`Es ist hinten im Stall. Aber es ist alt... Es ist bloß ein Ackergaul...´
`Du meinst, es ist zum Reiten nicht geeignet?´
Wieder nickte der Junge, worauf ich ihn nachdenklich betrachtete. Aber mir fiel keine bessere Möglichkeit ein. Einen Fußmarsch von der Länge, wie ich es beabsichtigte, hätten die Kinder - insbesondere das Mädchen - nicht in der Zeit bewältigen können, die uns bis zum Morgengrauen zur Verfügung stand.
`Führ mich zu dem Pferd´, wies ich den Jungen also an, der daraufhin zögernd aufstand, wobei sich das Mädchen schreckhaft an ihm festklammerte.
`Ich will mit´, rief sie aus und bedachte mich dabei mit einem ängstlichen Blick aus ihren großen grauen Augen, sodass wir schließlich zu dritt gen Stall wanderten.
Das Pferd, das wir dort antrafen war tatsächlich ein alter, bereits klappriger Gaul. Aber ich war mir sicher, dass er noch in der Lage war, die Kinder bis zu dem angedachten Ziel zu tragen. Entschlossen nahm ich daher Halfter und Trense von dem Haken an dem Eingang der Box und ging auf das Tier zu, um es aufzuzäumen, denn ich wollte so schnell als möglich aufbrechen. Doch als ich es berührte, um ihm die Trense in das Maul zu schieben, begann es plötzlich zu scheuen. Schnaubend riss es den Kopf in die Höhe und glotzte mich mit angelegten Ohren aus weit aufgerissenen Augen an. Ich verharrte in meiner Bewegung und wartete einen Moment, bis es sich wieder etwas beruhigt hatte. Aber als ich schließlich einen erneuten Versuch unternehmen wollte, wich es nervös tänzelnd vor mir zurück.
Ich wunderte mich über dieses Verhalten, denn in den ganzen Jahren, die ich im Grunde mit Pferden aufgewachsen war, hatte noch nie eines vor mir gescheut. Spürte es etwa, welche Gefahr von mir ausging?
Auch der Junge, der das Schauspiel bis dahin stumm, aber neugierig beobachtet hatte, schien überrascht über die ungewohnt heftige Reaktion des Tieres zu sein, so dass ich bald die Sorge hatte, die Unruhe dieses dummen Kleppers könnte sich auf die Kinder übertragen und die ohnehin bereits bestehende Skepsis noch weiter verstärken. Etwas, das ich in Anbetracht der verrinnenden Zeit und meines stetig anwachsenden Durstes wirklich nicht gebrauchen konnte!
Verärgert biss ich meine Zähne zusammen und bemühte mich, ruhig zu bleiben. Mit leiser Stimme sprach ich auf den Gaul ein, um ihn endlich gefügig zu machen. Es dauerte zwar eine Weile, aber es wirkte zum Glück, sodass ich dem Vieh zuletzt mit langsamen Bewegungen das Zaumzeug anlegen, die Kinder auf seinen Rücken setzen und es sogar aus dem Stall führen konnte, ohne dass es weiteren Widerstand leistete.
Als wir den Hof überquerten und dabei noch einmal an der Hütte vorbei kamen, fiel mir ein, dass die Kinder frieren mussten. Sie waren nur leicht bekleidet und die herbstlichen Nächte waren inzwischen empfindlich kalt geworden. Mir selbst allerdings, dessen wurde ich mir dabei gewahr, machte die Kälte erstaunlich wenig aus, obwohl auch meine Kleidung nicht sonderlich wärmend war. Aber wie so viele Dinge, die sich bei mir seit dem eigenartigen Ereignis verändert hatten, nahm ich es einfach zur Kenntnis und hinterfragte es nicht mehr weiter.
Kurzerhand band ich das Pferd an einen Zaunpfosten, gebot den Kindern zu warten und eilte noch einmal zurück in die Hütte. Suchend blickte ich mich um und entschied mich dann für das Lammfell, das auf dem Bett lag, sowie einen Wollumhang aus dem Kleiderschrank. Dies, so hoffte ich, würde den Kindern genügend Schutz gegen die Kälte bieten.
Rasch packte ich die Sachen zusammen und wollte gerade wieder hinausgehen, da fiel mein Blick noch einmal auf die beiden Leichen, die noch immer auf dem Boden lagen. Ihre Augen waren mittlerweile trüb geworden und ihre Wangen schon ein wenig eingefallen. Ein paar Fliegen hatten sich bereits auf ihnen versammelt und krabbelten über ihre fahlen Gesichter.
Dieser Anblick, vermengt mit dem erdrückend süß-fauligen Verwesungsgeruch, der sich derweil in dem Raum ausgebreitet hatte, wie ein dickflüssiges Sekret, ließ mich unwillkürlich würgen. Schnell wandte ich mich ab und ging zur Tür. Dabei kam mir für einen Moment der Gedanke, die Hütte einfach zu verbrennen, um die Spuren meiner ruchlosen Tat nachhaltig zu beseitigen. Doch ich entschied mich zuletzt dagegen. Allein aus Rücksicht auf die Kinder, die ich damit nicht noch mehr schockieren wollte.
Also verließ ich die Hütte unverrichteter Dinge wieder und ging rasch zu dem Pferd zurück, wo ich den Kindern Fell und Umhang reichte. Stumm nahm der Junge die Sachen entgegen und hüllte seine kleine Schwester in das Fell sowie sich selbst in den Umhang. Für einen kurzen Augenblick glaubte ich, auf seinem Gesicht einen Anflug von Dankbarkeit erkennen zu können, doch es konnte ebenso bloß ein aufmunterndes Lächeln für seine Schwester gewesen sein. Und während ich die Beiden so beobachtete, breitete sich ein bohrendes Gefühl in meinem Magen aus, das schwer wie ein Stein darin liegen blieb. Wie gerne hätte ich alles ungeschehen gemacht!
Nun, da die Kinder für den Weg gerüstet waren, nahm ich die Zügel des Pferdes und ging raschen Schrittes voran. Ich kannte den Weg, den ich einschlagen musste, und hoffte sehr, dass mich der Marsch, dank des Pferdes nicht die ganze Nacht kosten würde, denn diesen weiterhin in mir schwelenden Durst konnte ich nicht verleugnen. Irgendwann in dieser Nacht brauchte ich frisches Blut! So abstrus mir dieses Verlangen auch nach wie vor erschien...
Es war noch eine Stunde bis Mitternacht. Der Himmel über uns war sternenklar und der gerade abnehmende Vollmond tauchte die reifüberzogene Landschaft in silbriges Licht. Die kalte Luft ließ den Atem der Kinder sowie des Pferdes in kleinen Wölkchen aufsteigen, meinen eigenen jedoch nicht. Mein Körper war schlichtweg selbst zu kalt, als dass er meine Atemluft noch anzuwärmen vermochte. Verstohlen schaute ich mich zu den Kindern um und fragte mich, ob es ihnen ebenfalls aufgefallen war. Plötzlich kam ich mir vor, wie ein Gespenst, das seinen toten Körper nicht verlassen mochte und nun verloren durch die Nacht wandelte, während es ihm unentwegt nach Blut gelüstete.
Dieser schreckliche Durst begleitete mich tatsächlich äußerst hartnäckig, ja, er bohrte sich in immer schmerzhafteren Wellen meine Kehle hinunter bis in meinen Magen, und ich war bald froh, dass die Kälte und der leichte Wind, der uns entgegenschlug, den Geruch der Kinder weitestgehend von mir fernhielt. Dennoch würde das alleine nicht mehr lange ausreichen und ich vermochte diesem Dämon – so nannte ich den Trieb in mir, der immerzu von mir Besitz zu ergreifen versuchte - in den schwachen Momenten noch zu wenig entgegenzusetzen, als dass ich dafür hätte garantieren können, den Kindern nicht bald doch an die Gurgel zu gehen.
Wir trotteten gerade einen schmalen Pfad am Rande eines dichten Waldes entlang und ich sann mittlerweile fieberhaft darüber nach, wie ich dieses wachsende Problem möglichst bald lösen konnte, da weckte plötzlich etwas meine Aufmerksamkeit.
Zunächst war es nur ein Geruch. Ein menschlicher Geruch. Jedoch ging er nicht von den Kindern aus. Das konnte ich mit Sicherheit sagen, denn er kam aus einer anderen Richtung und entsprach eher dem eines Mannes.
Ich konzentrierte all meine Sinne auf diese eine Quelle und in der Tat, kurz darauf vernahm ich auch Geräusche: Ein verhaltener Atem und das langsame Schlagen eines Herzens, nein, genau genommen waren es vier. Vier Männer, die sich, für uns noch nicht sichtbar, ein Stück weiter am Wegesrand aufhielten und sich dabei auffällig still verhielten, als würden sie auf jemanden warten, von dem sie zuvor jedoch nicht bemerkt werden wollten.
Obwohl es für mich keine Frage war, auf wen sie da warteten, denn zu solch später Stunde befand sich außer uns niemand mehr auf diesem Pfad, so erstaunte mich doch dieser Umstand an sich. Denn was versprachen wir schon an Beute? Ein unbewaffneter, ärmlich gekleideter Mann und zwei verfrorene Kinder auf einem gebrechlichen Gaul... Mag sein, dass es schlicht die Not und der Glaube war, mit uns leichtes Spiel zu haben und schon irgendetwas von Wert bei uns finden zu können. Sei es das Mädchen, das sie verkaufen konnten oder der Gaul, der ihnen noch als zähe Mahlzeit dienen konnte. Vielleicht war es auch bloßer Zufall gewesen, der sich unsere Wege hatte kreuzen lassen, wobei sich die Gauner die Gelegenheit nicht entgehen lassen wollten. Mir jedenfalls war das einerlei, denn was sie natürlich nicht ahnen konnten, war die Tatsache, dass sie in diesem Moment genau das waren, was ich brauchte.
Mein Herz machte einen Freudensprung und hämmerte wild gegen meine Rippen, wie ein eigenständiges Lebewesen, das hungrig nach dem kurz bevorstehenden Leckerbissen lechzte; genauer gesagt: vier davon. Ich konnte mein Glück kaum fassen!
So als hätte ich die Wegelagerer nach wie vor nicht bemerkt, näherte ich mich raschen Schrittes ihrem Versteck. Sie sollten sich ruhig noch in Sicherheit wiegen, während sich hingegen jeder Muskel meines Körpers ungeduldig anspannte und meine Gedanken mehr und mehr einem raubtierhaften Instinkt wichen, mit dem ich meine Beute abschätzte, jeden Moment bereit zu dem entscheidenden Sprung.
Und dann endlich war es soweit.
Mit lautem Gebrüll stürmten die Männer hervor und verstellten uns den Weg. Doch als sie uns schließlich vor sich sahen, verstummten sie von dem einen Moment auf den anderen. Fast enttäuscht musterten sie uns und brachen dann in grölendes Gelächter aus. Einer von ihnen, womöglich ihr Anführer, schritt gemächlich und siegessicher auf mich zu, während ein breites Grinsen eine lückenhafte Reihe verfaulter Zähne in seinem vernarbten, von einem krausen Bart wild überwucherten Gesicht freilegte und bei diesem Anblick nur eine Bezeichnung zuließ: abstoßend.
Einerseits.
Für mich aber war er wunderbar! Er war schlecht, bösartig, hässlich; kurz: sein Tod wäre kein Verlust für irgendjemanden, sein Blut dagegen aber ein Segen für mich!
Inzwischen war mein darbendes Verlangen nach Blut zu einem bedrohlich großen, ständig saugenden Loch in meinem Magen herangewachsen, zusätzlich noch angeheizt von der Vorfreude auf diese vier netten Herren, die geradezu dafür geschaffen waren, diese Loch bald wieder zu stopfen, und ich wollte nun auf keinen Fall mehr länger warten! Der Wegelagerer war jetzt nah genug.
Gerade wollte er zum Sprechen ansetzen, doch kein Laut sollte mehr über seine Lippen kommen. Denn blitzschnell sprang ich auf ihn zu, riss ihn dabei zu Boden und setzte mich auf seinen Brustkorb. Völlig überrascht von meinem unerwarteten Angriff, versuchte der Bärtige, mich mit wild umherschlagenden Armen und unermüdlich windenden Bewegungen wieder abzuschütteln. Aber es nutzte ihm nichts. Zielstrebig umfasste ich mit einer Hand seinen Unterkiefer und drehte seinen überstreckten Kopf entgegen seinem Widerstand mit einem Ruck zur Seite. Wie ein halb verhungertes Tier verbiss ich mich in seiner Halsschlagader, entschlossen, verlangend, unnachgiebig, und trank sein Blut in tiefen Zügen, ungeachtet seiner langsam nachlassenden Schläge gegen meinen Kopf.
Oh, sein Blut war so unglaublich wohltuend! Mit jedem Schluck, den ich tat, entspannte sich mein von Hunger und Durst gepeinigter Körper mehr und mehr. Ich hätte vor Glückseligkeit laut seufzen und einfach dahin fließen mögen. Doch dieser berauschende Zustand sollte leider nicht lange anhalten. Denn plötzlich fühlte ich etwas Spitzes, Schneidendes, das sich tief in meinen Rücken bohrte und mich vor Schmerz jäh zusammenzucken ließ. Sofort hielt ich inne, unfähig noch eine Bewegung zu tun. Sogar das Schlucken war mir auf einmal unmöglich, weswegen mir das Blut einfach wieder aus meinem Mund heraus lief. Ich wollte unwillkürlich Luft holen, doch auch der Atem versagte mir, und zuletzt wurde mir schwindelig. Der Ohnmacht nah, riss ich mich zusammen und wollte mich aufrichten, was mir mit größter Mühe sogar noch gelang. Doch kaum, dass ich auf meinen Beinen stand, wurde mir auf einmal schwarz vor Augen und ich geriet ins Straucheln. Verzweifelt suchte ich Halt, ohne ihn jedoch zu finden, auf dass ich schließlich bewusstlos zu Boden stürzte.
Aber schon während ich aufschlug, spürte ich, wie meine Sinne zurückkehrten und mein Herz plötzlich wütend in meiner Brust zu schlagen begann, fast als wollte es sich von etwas Lästigem befreien. Endlich war ich in der Lage, einen tiefen Atemzug zu tun, und als ich meine Augen wieder öffnete und den Kopf hob, erblickte ich unmittelbar über mir einen der übrigen Männer, nicht weniger ungepflegt und abstoßend als der Erste. Er stand mit hängenden Schultern vor mir und starrte entgeistert auf mich herab, als begreife er nicht, wessen Zeuge er da gerade wurde.
Stöhnend setzte ich mich auf. Und weil ich in meinem Rücken immer noch diesen stechenden Schmerz verspürte, tastete ich umständlich mit meiner rechten Hand danach. Zu meinem eigenen Entsetzen fand ich dort tatsächlich den Griff eines Dolches, der bis zum Heft in meiner Haut steckte. Hastig umschloss ich ihn mit zittrigen Fingern und zog ihn mit zusammengebissenen Zähnen und einer raschen Bewegung heraus, um ihn dann fassungslos in meinen Händen zu halten und ungläubig seine blutverschmierte, lange Schneide zu betrachten.
Wie konnte es sein, dass diese Waffe mich nicht auf der Stelle getötet hatte? Sie musste ohne Zweifel meine Lunge und wahrscheinlich sogar mein Herz durchstoßen haben... Verwundert tastete ich nochmals nach der Wunde, die der Dolch hinterlassen hatte, und musste zu meinem erneuten Erstaunen feststellen, dass sie sich noch unter meinen tastenden Fingern schloss, bis meine Haut zuletzt wieder unversehrt war, als habe der Dolch sie nie auch nur berührt. Und mit der Wunde verschwand auch der Schmerz.
Es herrschte bestürztes Schweigen. Jeder der Anwesenden hatte mit meinem sicheren Tod gerechnet, das konnte ich an ihren Gesichtern ablesen, und nun starrten sie mich an, als sei ich der leibhaftige Teufel, völlig unschlüssig, was sie jetzt tun sollten. Ich hingegen nutzte diesen günstigen Moment, sprang auf und stürzte mich auf den Mann, der noch immer verwirrt vor mir stand. Dabei verfuhr ich mit ihm wie mit dem ersten, bloß dass ich jetzt keine Zeit hatte, es bis zuletzt auszukosten, denn inzwischen hatten die anderen Beiden ihre Fassung wiedererlangt und die Flucht ergriffen. Hektisch bahnten sie sich einen Weg durch das Dickicht in den Wald hinein.
Sofort ließ ich von meinem Opfer ab und verfolgte die Flüchtenden, denn es durfte niemand entkommen, der Zeugnis über diese sonderbaren Ereignisse hätte ablegen können. Und dank meiner enormen Schnelligkeit hatte ich im Nu einen von ihnen eingeholt. Durch einen kräftigen Hieb mit der Handkante in den Nacken, schlug ich ihn noch im Vorbeilaufen bewusstlos, sodass er schlaff zu Boden sank. Dort ließ ich ihn zunächst einfach liegen, um dem Letzten nachzusetzen.
Nur wenige Augenblicke später hatte ich dann auch diesen erreicht und mich ihm in den Weg gestellt. Wie vom Blitz getroffen blieb er stehen und starrte mich mit irren Augen an. Dann drehte er sich abrupt um und wollte erneut davon rennen, doch mit einer schnellen Handbewegung kam ich ihm zuvor und packte ihn so fest am Oberarm, dass er sich, gleich wie er sich in seiner Panik wand und dagegenstemmte, nicht mehr befreien konnte. Dabei war ich selbst überrascht, welche Kraft ich auf einmal besaß. Als der Kerl sich schließlich der Aussichtslosigkeit seiner Lage bewusst wurde, hörte er endlich auf, sich zu wehren und begann, mich um Gnade anzuflehen. Doch ich betrachtete ihn bloß ungerührt.
Er war ein schmutziger, hagerer Mann mit faulen, stinkenden Zähnen und vergilbter Haut. Sein ungeschnittenes Haar war verfilzt und es klebte allerlei Dreck darin. Eigentlich war es widerlich, sich seinem Hals zu nähern, um davon zu trinken, dachte ich, und derweil schien der Wegelagerer diesen kurzen Moment meines Zögerns als Hoffnungsschimmer zu deuten. Denn auf einmal begann er, mich mit einem Schwall von dummen Versprechungen überreden zu wollen, sein Leben zu verschonen. Es war alles so absurd, und plötzlich musste ich darüber schmunzeln.
Irritiert hielt der Mann inne.
Noch immer hielt ich seinen Oberarm fest in meinem Griff und nun näherte ich mich langsam seinem Gesicht bis ich nah genug war, dass er meinen kalten Atem spüren musste. Ich merkte, wie sich seine Muskeln verspannten und sein Widerstand gegen mich wuchs.
`Lügen! Nichts als Lügen´, flüsterte ich. `Das einzig Wahre, was du noch zu geben hast, liegt hier unter deiner Haut...´ Dabei fuhr ich ihm mit meinen Fingerspitzen über den Hals, auf dass sich die Härchen seiner Haut senkrecht aufstellten. Dann schlug ich zu. Flink wie eine Schlange verbiss ich mich in seine Kehle, bis das Blut herausströmte. Dreck hin, Gestank her. Das Blut des Mannes entlohnte mich jedenfalls reichlich für all diese Unannehmlichkeiten.
Danach wandte ich mich dem letzten Überlebenden zu. Er lag noch bewusstlos am Boden und so hatte ich mit ihm besonders leichtes Spiel. Ohne Eile ging ich zu ihm und kniete mich neben ihn nieder. Nicht ohne eine gewisse Vorfreude, beugte ich mich über seinen Hals, biss zu und saugte ihn in aller Ruhe aus, bis sein Herz den Dienst verweigerte und der Tod meiner Mahlzeit ein Ende setzte.
Danach war mein Hunger gestillt. Endlich!
Langsam hob ich meinen Kopf, wobei ich meine Augen geschlossen hielt, um den süßlichen Nachgeschmack, das belebende Prickeln, das Kraft spendende Pulsieren in meinem, von dem Blut der Männer erhitzten Körper noch etwas zu genießen. Es fühlte sich diesmal alles so richtig an, als hätte es für mich nie etwas Richtigeres gegeben. Endlich war ich frei von diesem bedrückenden Gefühl der Schuld, denn diese Opfer waren selbst nicht besser gewesen als ich. Ja, wahrscheinlich hatten sie sogar schon mehr Leben auf dem Gewissen, als man mir bis dahin nachsagen konnte...
Obwohl dieser köstliche Moment zwar bald wieder verebbt war, blieb meine Stimmung dennoch euphorisch. Ich hätte am liebsten laut gelacht und gesungen, als ich mir den Weg durch das Gestrüpp zurück zu dem Pfad bahnte, wo die Kinder noch immer auf dem alten Gaul saßen und warteten. Aber ihretwegen beherrschte ich mich. Was sie gesehen hatten, genügte bereits, um sie in Schrecken zu versetzen und das kleine Häuflein Vertrauen in mich zu verlieren, das sie möglicherweise trotz allem hatten fassen können. Ich wollte sie nicht noch zusätzlich mit meiner vollkommen unpassenden Ausgelassenheit konfrontieren.
So ergriff ich, als ich bei ihnen angekommen war, wortlos und ohne sie dabei anzusehen die Zügel des Pferdes, um unseren Weg endlich fortzusetzen. Ich wollte nicht wissen, was sie über mich dachten, und ich wollte schon gar nicht die Erkenntnis in ihren Augen lesen, was ich war. Wenigstens hielt ich mich an meinen Vorsatz, ihnen nichts zu Leide zu tun und ihnen ein Leben zugänglich zu machen, das ihnen auf andere Weise vielleicht versagt geblieben wäre. Dafür nahm ich hin, dass sie die Geschehnisse dieser Nacht jemandem berichten und mich damit verraten könnten. Ich hoffte einfach darauf, dass ihnen niemand Glauben schenken und es schlichtweg als kindliche Phantasterei abgetan würde. Der Gedanke, dass diese Kinder mit ihrer Erinnerung auch erwachsen werden würden, kam mir damals unbedachter Weise gar nicht in den Sinn. Und dennoch, ich glaube, selbst wenn ich gewusst hätte, in was ich mich dadurch viele Jahre später verwickeln würde, ich hätte nicht anders gehandelt.
Nach einigen Stunden erreichten wir endlich das Ziel. Es war ein Kloster, das recht abgelegen auf dem Gipfel eines kleinen Hügels lag, umgeben von Obstbäumen und Weinstöcken, die von den Mönchen bewirtschaftet wurden. Zu seinen Füßen wand sich, gleich einer im Mondschein silbrig glitzernden Schlange, ein schmaler Fluss durch das verschlungene Tal.
Es war inzwischen tiefe Nacht geworden und die Kinder fielen vor Müdigkeit fast von dem Pferd herunter, mit dem ich mich nun auf den letzten Schritten den Pforten des Klosters näherte. Endlich davor angekommen, trat ich an die dicke, schwere Eichentür heran, ergriff den riesigen Eisenring, der sie auf Augenhöhe zierte, und klopfte mehrmals kräftig dagegen.
Stille.
Noch einmal schlug ich mit dem Ring gegen die Tür, diesmal allerdings noch fester, und wartete dann abermals eine Weile, ohne dass sich etwas zu rühren schien.
Gerade aber, als ich die Hand erneut an das Eisen gelegt hatte, um ein weiteres Mal zu klopfen, vernahm ich ein leises Rascheln innerhalb der Klostermauern, so leise, dass ein menschliches Gehör es noch nicht wahrgenommen hätte. Es folgten verschlafene Schritte und das Knarren einer Tür. Dann jedoch wurde es wieder ruhig, als habe jemand Zweifel, ob er das Klopfen wirklich gehört oder doch nur geträumt hatte. Schnell pochte ich abermals gegen die Tür, um sofort jegliche Bedenken zu vertreiben, und es zeigte seine Wirkung. Die Person setzte sich wieder in Bewegung. Ihre Schritte näherten sich eilig dem Tor und schließlich wurde ein schwerer Riegel geräuschvoll zurückgeschoben. Quietschend öffnete sich die Tür einen Spalt breit und das schmale Gesicht eines hageren Mannes tauchte dahinter auf. Aus seinen grau-blauen Augen schaute er mich neugierig an.
`Wir pflegen zwar, früh aufzustehen, aber zu solcher Stunde, erwarten wir doch äußerst selten Gäste... Was ist Euer Begehr?´ Die Stimme des Mönchs klang warm und geduldig. Doch die Art, wie er mich musterte, war mir unangenehm. Nicht, weil sie feindselig gewesen wäre, oder verärgert. Nein, das war sie ganz und gar nicht. Vielmehr strahlte das gesamte Wesen dieses Mannes Güte und Wissen aus. Sein Blick drang so tief in meine zerteilte Seele, dass mein Innerstes zu zittern begann und ich es kaum vermochte, ihm noch länger stand zu halten. Rasch überspielte ich meine Unsicherheit, in dem ich über die Schulter zu den Kindern hinüber sah, die hinter mir noch immer auf dem Gaul saßen. Das Mädchen hatte die Arme um ihren Bruder geschlungen und den Kopf an dessen Rücken angelehnt, die Augen bereits halb geschlossen, während der Junge mich lauernd beobachtete.
`Ich...´, begann ich stockend und wandte mich wieder dem Mönch zu, der nun selbst die Kinder über meine Schulter hinweg betrachtete. `Ich habe diese zwei Kinder auf einem Bauernhof gefunden, als ich dort um ein Nachtquartier bitten wollte... Sie saßen vor ihren toten Eltern.´ Ich konnte spüren, wie sich der zornige Blick des Jungen in meinen Rücken bohrte und hoffte inständig, der Mönch würde ihn nicht bemerken. Schnell sprach ich weiter. `Nun, was hätte ich mit ihnen tun sollen, mitten in der Nacht? Ich konnte sie doch nicht einfach dort hocken lassen. Mir fiel nur Euer Kloster ein und ich bitte Euch, sie in Euren Mauern aufzunehmen. Zumindest solange, bis die Frage nach Verwandten, die sich ihrer annehmen könnten, geklärt ist...´
Der Mönch reagierte nicht sofort, sondern nahm sich noch einen Augenblick Zeit, um seine Antwort zu überdenken. Schließlich aber nickte er und öffnete das Tor für uns.
`Gut, ich will Ihnen Ihre Bitte nicht abschlagen. Wir werden diese Waisen vorerst bei uns beherbergen und alles Weitere in ihrem Interesse in die Wege leiten.´
Ein Stein fiel mir vom Herzen. Ich lächelte dankbar, ging zu dem Pferd und führte es an ihm vorbei in den Hof. Gerade wollte ich den Kindern helfen, abzusteigen, da trat der Mönch neben mich und sprach scheinbar beiläufig, aber mit eindringlichem Blick: `Ach, würden Sie mir vielleicht noch eine Frage erlauben?´
Nervös hielt ich inne. Hatte der Geistliche mich etwa durchschaut? Hatte er den Blick des Jungen vorhin gesehen und den richtigen Schluss daraus gezogen? Oder hatte der Junge ihm gar hinter meinem Rücken ein Zeichen gegeben?
`Fragen Sie´, erlaubte ich ihm schließlich widerstrebend, fest entschlossen, mir dennoch nichts anmerken zu lassen.
`Gab es Hinweise darauf, wie die Eltern zu Tode gekommen sind?´
Mir wurde zunehmend unbehaglich zu Mute. Was sollte ich dem Mönch antworten? Ich warf einen flüchtigen Blick auf den Jungen, der unser Gespräch aufmerksam verfolgte. Glücklicherweise blieb er still, so dass ich mich beeilte, eine Antwort zu liefern, bevor er mir noch dazwischen kommen und mich in ernsthafte Schwierigkeiten bringen konnte.
`Sie waren schwer verletzt, so dass ich beinahe von einem Mord ausgehen würde. Mehr jedoch kann ich nicht dazu sagen... Warum aber wollt Ihr das wissen? Sicher wird sich die örtliche Polizei darum kümmern...´
Der Mönch zuckte mit den Schultern und winkte ab.
`Reine Neugier... Es ist gut, wenn man Antworten für fragende Kinder hat.´ Dabei lächelte er freundlich, trat an mir vorbei auf das Pferd zu und streckte seine Hände nach dem Mädchen aus.
`Dann steigt einmal von eurem Pferd´, sprach er zu den Kindern und hob das Mädchen hinunter, derweil ich vor Erleichterung am liebsten laut geseufzt hätte.
`Ich werde euch ein Bett zeigen, wo ihr schlafen könnt; und wenn ihr noch hungrig seid, habe ich auch ein Stück Brot für euch.´
Der Mönch setzte das Mädchen behutsam auf dem Boden ab, doch müde, wie sie war, stand sie nach dem stundenlangen Ritt nur sehr wacklig auf den Beinen, sodass er sie direkt wieder auf seinen Arm nahm. Daher ging ich zu dem Pferd und wollte dem Jungen herunter zu helfen. Ich hielt ihm meine Arme entgegen, doch er ignorierte diese Geste glatt und sprang ohne meine Hilfe ab. Schnurstracks lief er an mir vorbei auf den Mönch zu, ohne mich dabei eines Blickes zu würdigen.
`He´, rief ich ihm nach, worauf er sich umdrehte und mich verächtlich ansah. Ich trat auf ihn zu und beugte mich zu ihm herunter, bis wir auf gleicher Augenhöhe waren.
`Wie heißt du?´
Ich kann nicht genau erklären, warum mir diese Frage in diesem Moment so wichtig war. Vielleicht wollte ich dem Jungen damit mein Wohlwollen demonstrieren und eine Art Frieden schließen. Vielleicht aber wollte ich auch nur einen Namen für das Grauen haben, das ich in meiner ersten Nacht als Dämon angerichtet hatte.
`Jonathan´, antwortete er knapp und dann setzte er mit hasserfüllter Stimme nach: `Merke dir den Namen gut, denn eines Tages werde ich meine Eltern rächen und dich töten!´
Als hätte Jonathan mir soeben eine Ohrfeige verpasst, zuckte ich vor ihm zurück. Bisher hatte er zwar stets geschwiegen, aber natürlich hatte er alles genau beobachtet. Er war alt genug, zu verstehen, welch Ungeheuer ich war, und jung genug, um an solche zu glauben...
Ich bemerkte, dass der Mönch unser kleines Gespräch aufmerksam verfolgt hatte. Rasch richtete ich mich daher wieder auf und lächelte nachsichtig.
`Er ist verstört und müde... Ich bin froh, dass die Kinder nun in Ihrer gütigen Obhut sind. Vielen Dank!´
Bei diesen Worten verbeugte ich mich kurz, wünschte den Kindern noch Lebewohl und verließ schließlich zügig das Kloster, bevor es noch zu irgendwelchen ungewollten Verwicklungen kommen konnte.
Außerdem war da noch eine Angelegenheit, die ich in dieser Nacht abzuschließen beabsichtigte.
So schnell ich konnte - und das war zu meinem eigenen Erstaunen sehr schnell - lief ich zurück zu dem nun verwaisten Hof. Schon weit vor der Hütte kroch der üble Geruch nach Verwesung in meine empfindliche Nase, sodass es mich Überwindung kostete, mich ihm noch weiter zu nähern. Ich dachte sogar für einen Moment darüber nach, einfach von meinem Plan abzulassen, doch schließlich nahm ich mich zusammen, ging auf die Hütte zu und öffnete die Tür.
Das Surren aufgeschreckter Fliegen erfüllte den Raum, als ich eintrat, und ein furchtbares Ekelgefühl ließ mich zunächst für einen Moment lang innehalten. Sobald es wieder etwas abgeklungen war, sammelte ich eilig sämtliches brennbares Zeug zusammen und warf es über die inzwischen fleckig gewordenen Leichen. Dabei versuchte ich, so wenig wie möglich zu atmen, um mich diesem schrecklichen Gestank weitestgehend zu entziehen. Zuletzt griff ich mir einen Fetzen Stoff, hielt ihn in die zum Glück noch schwach glimmende Glut der Kochstelle und schleuderte ihn, sobald er Feuer gefangen hatte, auf den zusammengetragenen Haufen, welcher daraufhin innerhalb kürzester Zeit in Flammen stand. Hungrig knisternd breiteten sie sich zu allen Seiten hin aus, in der unerschütterlichen Absicht, die Hütte sogleich mit Haut und Haaren aufzufressen.
Schnell rannte ich hinaus, um aus sicherer Entfernung fasziniert zu beobachten, wie innerhalb weniger Augenblicke die gesamte Hütte lichterloh brannte. Rotgoldene Funken stoben, gejagt von laut knallenden Schlägen wie aufgeregte Glühwürmchen in die Höhe, wurden dort unverwandt von einem Windstoß erfasst und ein Stück davongetragen bis sie schließlich noch im Fluge auf immer erloschen.
Jetzt erst, in dem zuckenden Schein des lodernden Feuers, begriff ich, dass mein altes Leben wohl unwiederbringlich verloren war. Langsam begann ich das Ausmaß meiner Veränderung zu begreifen, die sich erst vor einer Nacht in jener Höhle ereignet und doch so fulminant in mein Leben eingegriffen hatte. Ich dachte an meine neuen Kräfte und Sinnesgaben, ebenso wie an meine seltsamen Fangzähne, die mir gewachsen waren; an das Blut, nach dem ich mich seither verzehrte; an den Dolch, der mich nicht töten konnte sowie die Wunden, die unmittelbar wieder verheilten; an den totenähnlichen Schlaf, der mich am Tage ereilte; an die Sonne, die mich verbrannt hatte. Und ich stellte mir die Frage, mit welchen Veränderungen ich noch rechnen musste. Der Glaube, bloß von einer vorübergehenden Krankheit befallen zu sein, begann langsam, wie das zu Asche verbrannte Holz vor mir zu zerfallen und zunehmend der Gewissheit zu weichen, dass eine Verwandlung mit mir vorgegangen sein musste, die nicht mehr rückgängig zu machen war.
Zu was aber war ich nun geworden? Gab es einen Namen für das, was ich jetzt war? Gab es jemanden, der genauso war wie ich?
Ich schaute hinauf in den Himmel, der von Qualm und langsam heraufziehenden Wolken zugedeckt wurde. Gab es dort oben wirklich einen Gott, der mich sehen konnte? Und wenn ja, was für Schlüsse und Konsequenzen würde er mir und insbesondere meinen Taten gegenüber ziehen?
Ich kann nicht beschreiben, wie verloren ich mich in diesem Moment fühlte. Eine gähnende Leere begann in meinem Bauch zu keimen, die in rasender Geschwindigkeit Wurzeln in meine Seele schlug und zu einem riesigen Baum aus Verzweiflung und Traurigkeit heranwuchs. Wohin sollte ich denn nun gehen? Wo gehörte ich hin? Könnte ich trotz allem mein Leben einfach so fortführen wie bisher?
Während ich noch dort mitten auf dem Feld auf dem Boden hockte und, versunken in den Anblick der ersterbenden Flammen, meinen trüben Gedanken nachhing, hatte ich dummerweise völlig vergessen, auf die Dämmerung zu achten. Ich hatte zwar schon seit einer Weile die langsam aufsteigende, zunehmend lähmende Müdigkeit gespürt. Doch erst jetzt erkannte ich, dass sie bereits der Vorbote des bevorstehenden Sonnenaufgangs gewesen war, der sich nun am Horizont abzuzeichnen begann und mich warnte, mich schnellstens in Sicherheit zu bringen.
Zu Tode erschrocken sprang ich auf und sah mich um. Vor mir lagen verbrannter Schutt und glühende Asche. Darüber hinaus gab es bloß noch Feld und Wiese weit und breit. Nirgends fand sich auch nur der Lichtblick eines Verstecks für mich.
Mein Herz begann unvermittelt zu rasen und ich drehte mich hastig im Kreis, in der Hoffnung, doch noch irgendetwas zu entdecken, was mir womöglich weiterhelfen konnte. Doch es gab nichts!
Sollte nun alles hiermit schon ein Ende haben? Würde ich gleich hilflos in der Sonne verbrennen? War das Gottes gerechte Strafe für mich?
Fast war ich bereit, sein Urteil über mich zu akzeptieren und meinem Tod - traurig und ängstlich zwar, aber doch um die Unausweichlichkeit wissend - entgegen zu blicken, da kam mir plötzlich, aus der schieren Not geboren, eine rettende Idee. Auch wenn sie mir ganz und gar nicht gefiel.“
***
Der Richter hob die Hand und gebot dem Vampir damit, seinen Bericht zu unterbrechen. Cheriour, der ihn darum gebeten hatte, nickte dankbar. Ihm gefiel es nicht, das Verständnis in den Augen der anwesenden Engel und ja, sogar in denen des Richters aufkeimen zu sehen und er war entschlossen, ihre Sicht wieder auf den richtigen Weg zu lenken.
„Ich möchte an dieser Stelle gerne meinen nächsten Zeugen aufrufen“, sagte er und nach der Zustimmung des Richters, wurde ein junger Mann in den Saal geführt. Sein Erscheinungsbild war äußerst gepflegt und er zählte sicher nicht mehr als fünfundzwanzig Jahre. Bedächtig nahm er im Zeugenstand Platz und richtete dabei seinen grimmigen Blick auf den Vampir, der seinen Kopf reuevoll gesenkt hielt.
Armon wusste, welcher Teil nun folgen würde und welches Licht es auf ihn werfen würde. Niemals würde er es schaffen, seine Seele vor der Unterwelt zu retten. Niemals.
Flüchtig, der Hoffnung beinahe gänzlich beraubt, schaute er auf Ambriel, der seine Hand weiterhin unbeirrbar auf Armons Schulter ruhen ließ und ihm nun mit einem sanften Druck versuchte, Zuversicht zu spenden. Mehr konnte Armon wohl auch nicht von ihm erwarten. Mit einem stummen Seufzer wandte er seine Augen wieder nach vorne.
Cheriour war inzwischen vor den Zeugen getreten.
„Ihrem Blick nach zu urteilen, erkennen sie diesen Mann, habe ich Recht?“
Der Zeuge nickte.
„Und ob ich den erkenne!“
„Dann berichten Sie uns doch einmal, in welchem Zusammenhang er Ihnen begegnet ist.“
Der Zeuge schnaubte verächtlich.
„Hier mag er erscheinen, wie ein Mann. Doch in Wahrheit ist er ein Ungeheuer, eine Höllengeburt!“
„Aha.“
„Wir, das heißt, meine Verlobte und ein guter Freund der Familie, waren am Abend noch ein wenig spazieren gegangen. Es war eine der letzten lauen Nächte des Jahres und wir hatten sie noch einmal auskosten wollen. So hatten wir die Stadt verlassen und uns über die Wiese an den Waldrand begeben, als diese Bestie plötzlich vor uns auftauchte. Seine Augen leuchteten wie zwei glühende Kohlen und er hatte seinen geifernden Mund aufgerissen, so dass wir seine mörderischen Fangzähne sehen konnten. Meine Verlobte schrie auf vor Schreck und ich nahm sie in den Arm, um sie zu beruhigen, während mein Freund diesen Dämon vor uns zu beschwichtigen suchte. Aber ich glaube, das Ding hatte nichts von unseren Worten verstanden. Es stürzte sich unversehens auf meinen Freund und... oh Gott, es war so schrecklich... es verbiss sich knurrend in seinen Hals und riss ihm mit einem Ruck die Kehle heraus. Das Blut spritzte wie eine Fontäne und dieses Ungeheuer fing es gierig mit seinen Lippen auf... Dann...“ Der Zeuge schluckte. „Dann umfasste es den Kopf meines Freundes und... und riss ihn einfach ab...“ Wieder machte der Zeuge eine Pause, während er sichtlich um seine Fassung rang. Cheriour legte vorsichtig seine Hand auf die des Zeugen.
„Es tut mir Leid, sie mit der Aussage so zu quälen. Doch was sie sagen, ist sehr wichtig. Wenn sie können, so erzählen sie uns doch auch bitte noch den Rest.“
Der Zeuge sah Cheriour in die Augen, worauf seine aufgeregte Atmung sich wieder beruhigte. Entschlossen nickte er und sprach weiter.
„Mein Freund war dem Dämon nicht genug. Danach kam er auf uns zu. Auf mich und meine Verlobte, die er anstarrte, als wolle er sie bereits mit seinen Blicken verschlingen. Schützend stellte ich mich vor sie, doch er stieß mich einfach fort. Er war so stark, dass ich dem nichts entgegensetzen konnte. Dann packte er sie und auch ihr biss er in den Hals, um ihr Blut zu trinken. Doch als sie schon weiß wie Kreide war, da...“ Der Zeuge tat einen tiefen Atemzug. „... da stieß er plötzlich seine Hand in ihren Brustkorb... und... und riss ihr...“ Wieder musste der junge Mann den Kloß überwinden, der fest in seiner Kehle steckte. „Er riss ihr das Herz heraus, um auch das noch auszusaugen... Da verlor ich das Bewusstsein...“
Heimlich, so dass niemand es auch nur erahnen konnte, grinste Cheriour in sich hinein. Der Ausdruck des Entsetzens und des Widerwillens auf den Gesichtern der Zuhörer, erfüllte seine Brust mit einem nicht zu leugnenden Triumphgefühl.
„Vielen Dank für Ihre Aussage“, wandte er sich noch einmal an den Zeugen und sah ihm hinterher, als er den Saal verließ.
Ambriel konnte fühlen, wie Armon unter seiner Hand zitterte.
„Die Verhandlung ist noch nicht zu Ende“, raunte er ihm ganz leise zu. Dann sprach er an den Richter gewandt: „Euer Ehren, darf ich nun darum bitten, meinen Schützling fortfahren zu lassen? Es mag grausam klingen, was er getan hat, aber bedenkt, dass er das Opfer eines Dämons ist, und das Bild seiner Seele ist hiermit noch lange nicht vollständig.“
Der Richter hielt seine Augen auf den Vampir gerichtet. Härte spiegelte sich darin. Ambriel fürchtete fast, die Verhandlung könne nun abgebrochen werden, das Urteil verkündet; und es würde an dieser Stelle weiß Gott nicht gut für sie beide aussehen. Da jedoch erklang die Stimme des Richters.
„Sprich weiter, Vampir.“
Armon, konnte Ambriel die Gedanken seines Schüztlings hören. Mein Name ist Armon. Aber er wusste, dass Armon nicht wagte, es laut zu sagen, obgleich es ihm so wichtig war.
Stattdessen tat er, wozu der Richter ihn aufgefordert hatte.