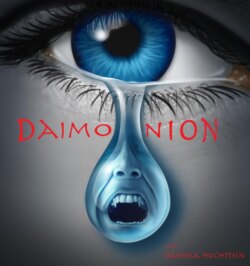Читать книгу Daimonion - Daniela Hochstein - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Verwandlung – Kapitel 1
Оглавление„Der Tag, an dem es geschah, begann mit einem wunderschönen Herbstmorgen im Jahre 1722.
Ich schaute aus dem Fenster des elterlichen Anwesens, auf dem ich als dritter Sohn einer landadeligen Familie aufgewachsen war. Meine Gemächer lagen im zweiten und damit obersten Stockwerk des östlichen Flügels unseres bereits vor Generationen errichteten Schlösschens, welches auf einer kleinen, grün bewachsenen Anhöhe thronte. Von hier aus hatte ich einen phantastischen Ausblick auf die Ländereien, Felder, Wiesen und Wälder, die uns damals gehörten.
An diesem Morgen, ich sehe es noch genau vor mir, tauchte die aufgehende Sonne die Landschaft in außergewöhnlich leuchtend rotgoldene Farben, sodass ich noch eine Weile am Fenster verharrte, um diesen atemberaubenden Anblick so intensiv wie möglich auszukosten... Als hätte ich bereits den finsteren Schatten wie ein Unwetter heraufziehen gespürt, obgleich der Himmel sich von einem Horizont bis zum anderen in strahlendem, wolkenlosen Blau präsentierte.
Es war noch früh, doch die Bediensteten eilten bereits geschäftig über den Hof und gingen emsig ihrer Arbeit nach. Die frische Luft, die durch das geöffnete Fenster in mein Zimmer strömte, wurde begleitet von dem Schallen schneller Schritte, dem metallenen Schaben einer Mistgabel, den barschen Rufen des Stallmeisters sowie dem Schnauben der Pferde, die bereits ungeduldig mit den Hufen scharrten, in freudiger Erwartung, bald auf die saftig grüne Weide geführt zu werden.
Doch nicht nur draußen herrschte Betrieb. Auch im Hause waren die Dienstmädchen bereits damit beschäftigt, den Tisch für das Frühstück der Herrschaften einzudecken. Die Köchin – eine füllige, manchmal äußerst launische Frau – hatte schon längst Herd und Ofen angeheizt, Teig geknetet und das Fett in der Pfanne geschmolzen, sodass nun ein herrlicher Duft nach gebratenem Schinken, Eiern und frischem Brot durch sämtliche Ritzen des Gemäuers zog und schließlich auch meine hungrige Nase erreichte.
Ausgeruht und voller Tatendrang fuhr ich mir hastig mit einer Handvoll Wasser aus der bereitstehenden Waschschüssel durch mein Gesicht und kleidete mich in meine Reiterkluft, denn ich gedachte, noch vor dem gemeinschaftlichen Frühstück der Familie einen kleinen Ausritt zu unternehmen. Vorher wollte ich allerdings noch meinen knurrenden Magen besänftigen und schlich mich hinunter in die Küche, wo ich mir, von der Köchin unbemerkt, ein kleines Frühstück zusammenstahl.
Mit vollem Mund, aber wieder leeren Händen, betrat ich wenig später die Waffenkammer. Zielstrebig steuerte ich auf die breite Glasvitrine zu, die eine beachtliche Auswahl an Schusswaffen beherbergte. Den dazugehörigen Schlüssel fingerte ich aus seinem Versteck, einer flachen, unscheinbaren Schublade am Sockel der Vitrine, und öffnete die Tür. Ich brauchte nicht lange zu überlegen, für welche Waffe ich mich entscheiden sollte, bevorzugte ich doch für die Jagd – und wer weiß, vielleicht ergab sich auf meinem Ausritt ja die Gelegenheit dazu - eine schlicht gearbeitete Steinschlossbüchse, nach der ich direkt griff. Dazu versorgte ich mich noch mit der passenden Munition, einem kurzen Dolch und begab mich dann auf den Weg zu den Ställen.
Bei meinem ersten Schritt hinaus auf den Hof, wurde ich von einer erfrischenden Brise feuchter, von dem Schein der Sonne bereits angenehm erwärmter Morgenluft begrüßt, was meine Vorfreude auf den kleinen Ausflug noch steigerte; ich konnte ja nicht im Ansatz ahnen, wohin er mich letztlich führen würde... Gemächlich schlenderte ich über den kopfsteingepflasterten Hof zu den Ställen hinüber. Die ersten Tiere befanden sich schon auf der Koppel und Carl, der Stallknecht, war damit beschäftigt, die verlassenen Pferdeboxen auszumisten. Er schob gerade einen Karren voll Mist über den Hof, als ich unbedarft vor ihn trat und damit beauftragte, mein Pferd zu satteln. Mit der Miene eines nachsichtigen Vaters stellte er den Karren ab und kehrte in den Stall zurück, um meinem Wunsch nachzukommen. Währenddessen lehnte ich mich lässig mit gekreuzten Beinen an das Stalltor, um dort auf ihn zu warten und mir mit genießerisch geschlossenen Augen von den Sonnenstrahlen das Gesicht wärmen zu lassen.
Ich war damals 28 Jahre alt und lebte auf unserem Anwesen noch zusammen mit meinen Eltern, meiner jüngeren Schwester und einer Reihe von Bediensteten.
Meine beiden deutlich älteren Brüder hatten das Gut schon vor Jahren verlassen, um sich am Königshof – ehrgeizig wie sie waren – empor zu dienen. Ich konnte mir nur zu gut vorstellen, wie sie alles daran setzten, um sich dabei gegenseitig auszustechen.
Wie dem auch war: mittlerweile hatten sie ihre Positionen errungen, ja sie waren sogar mit eigenen Ländereien ausgestattet und es zog sie glücklicherweise nur noch selten zu dem heimatlichen Anwesen.
Ich möchte hier anmerken, dass ich nie ein besonders gutes Verhältnis zu ihnen gehabt hatte. Sie selbst waren in kurzem Abstand hintereinander geboren worden und standen sich damit auf ihre ganz eigene Art und Weise sehr nahe. Ich dagegen war bloß der kleine Nachzügler gewesen, den niemand ernst nehmen konnte - oder wollte. Obwohl meine Brüder schon als Kinder stets ihre bisweilen bösartigen Kämpfe untereinander auszufechten pflegten, so hatten sie es dennoch vermocht, sich bestens miteinander zu vertragen, wenn es darum ging, sich gegen mich zu verbünden. Daher muss ich ehrlich zugeben, dass ich nur froh gewesen war, als sie das Elternhaus endlich verließen, und ich vermisste sie seither nicht im Geringsten. Ebenso wenig interessierte mich ihr Vorankommen in der Ferne, und es ihnen womöglich irgendwann einmal nachzutun, kam mir schon gar nicht in den Sinn. Zu gut ging es mir zu Hause, und da ich der letzte verbliebene Sohn auf dem Anwesen war, blieb es ohnehin an mir, es eines Tages als rechtmäßiger Erbe zu übernehmen.
Bei meiner Schwester, Elisabeth, hingegen verhielt es sich vollständig anders. Ihre Geburt war zwar für meine Eltern wohl eher ein Versehen gewesen, doch für mich war es das Größte, was mir hätte widerfahren können. Ich weiß noch, wie mein Vater mir meine kleine, frisch geborene Schwester behutsam in den Arm legte, während meine Mutter noch erschöpft in ihrem Bett lag... Elisabeth war nur kurz gebadet und dann in ein weißes Leinentuch gewickelt worden. Ehrfürchtig schaute ich auf dieses kleine, unschuldig schlummernde Wesen herab, das sich so warm anfühlte und so eigenartig süß duftete, und das erste Mal in meinem Leben fühlte ich mich wichtig. Von nun an sollte es jemanden geben, der noch kleiner war als ich und auf den es aufzupassen galt. Eine große Aufgabe!
Im Nachhinein muss ich darüber schmunzeln, aber damals hatte ich mich mit meinen knappen fünf Jahren auf einmal so unglaublich erwachsen gefühlt und dementsprechend meine Aufgabe sehr ernst genommen. Bis zu der Zeit, wo auch Elisabeth größer geworden war und sie von meinem Schützling vielmehr zu meiner Spielkameradin wurde.
So blieb es eigentlich, bis wir erwachsen waren und ich konnte mir nicht vorstellen, irgendwann ohne Elisabeth zu sein. Daher kam es mir sehr gelegen, dass meine Eltern - nicht zuletzt dank des Einsatzes meiner Mutter - so liberal waren und meiner Schwester ein Mitspracherecht bei der Auswahl ihres zukünftigen Gatten zustanden. (Auch wenn es der damaligen Sitte, die Tochter meist ungefragt an einen vielversprechenden Mann gleichen oder womöglich höheren Standes zu verheiraten, nicht entsprach.) Dies führte nämlich dazu, dass Elisabeth auch mich bei dieser Entscheidung stets mit einbezog und ich auf diese Weise bereits so manche Heirat hatte verhindern können; mit dem Ergebnis, dass sie mit ihren 23 Jahren – obgleich unzweifelhaft von reizvoller Gestalt – noch unverheiratet und kinderlos war und die Unzufriedenheit unserer Eltern darüber wuchs. Damals hatte mich das allerdings nur wenig gekümmert, und welche unseligen Konsequenzen meine Eltern zuletzt darauf hatten folgen lassen, sollte ich erst Jahre später erfahren.
Von den Schuldgefühlen allerdings, die ich seither deswegen empfinde, werde ich mich wohl niemals lossagen können. Denn wenn ich nicht so egoistisch und eifersüchtig gewesen wäre, hätte Elisabeths Leben wahrscheinlich einen ganz anderen Lauf genommen und ich hätte sie am Ende nicht auf so abscheuliche Art verlieren müssen. Doch dazu später.
Das Schnauben meines Pferdes erklang auf einmal unmittelbar neben mir, sodass ich aus meinen dahinwandernden Gedanken wieder auftauchte. Ich öffnete meine Augen und blickte direkt in Carls belustigt schmunzelndes Gesicht, während er mir die Zügel entgegenhielt. Ich lächelte ertappt, bedankte mich und während er zu seinem Mistkarren zurückkehrte, verstaute ich das Gewehr, das ich solange an meiner Seite abgestellt hatte, in der eigens dafür gefertigten Satteltasche. Dann schwang ich mich behände auf den Rücken des Tieres und trieb es mit einem leichten Fersendruck in die Flanken an. Tänzelnd setzte es sich in Bewegung und das ungeduldige Klappern seiner Hufe auf dem Pflaster hallte über den ganzen Hof. Ich spürte, wie es nur darauf drang, endlich davon zu galoppieren, doch ich zügelte es noch so lange, bis wir den Hof durch das Tor verlassen hatten. Erst dann ließ ich es gewähren, worauf es übermütig lospreschte.
Ich liebte das kraftvolle Spiel seiner Muskeln, die sich dabei an meinen Unterschenkeln rieben, und hatte bald das Gefühl mit dem gleitenden Rhythmus des Tieres zu verschmelzen, während es mühelos über den Pfad dahinjagte. Die Geschwindigkeit versetzte mich schon bald in einen regelrechten Rausch und ich trieb es unermüdlich in wildem Galopp quer über die Felder und zuletzt auf den angrenzenden Wald zu. Ungebremst ritt ich noch ein Stück hinein, bis der Pfad zunehmend von Gestrüpp überwuchert wurde und uns damit zwang, langsamer zu werden.
Schließlich zog ich die Zügel an und stieg ab, um mir – das Pferd hinter mir herführend - mit Händen und Füßen einen Weg durch das Dickicht zu bahnen. Dabei hielt ich Ausschau nach möglichen Spuren von Rehen, Wildschweinen oder was sich sonst noch zur Jagd anbot. Und tatsächlich war ich noch gar nicht so tief in den Wald vorgedrungen, da stieß ich auf eine Fährte, welche die ganze Angelegenheit deutlich spannender gestalten sollte, als ich mir erhofft hatte.
Es handelte sich um den typischen Abdruck einer Wolfstatze, der sich frisch auf der feuchten Erde abzeichnete.
Ein wohliges Schauern lief mir über den Rücken. Etwas Besseres als ein Wolf hätte mir gar nicht passieren können... Zudem schien er nicht im Rudel unterwegs zu sein, da ich nur diese einzelne Spur fand. Was also sprach dagegen, mir dieses Tier noch heute morgen zu schnappen, auf dass es im Winter eine Bestie weniger gab, die – vom Hunger getrieben – sich in die Nähe der Menschen wagen und unser Vieh gefährden könnte.
Von dieser Idee angespornt folgte ich der Fährte eine ganze Zeit lang, ohne jedoch das Gefühl zu haben, meinem Ziel dabei nennenswert näher zu kommen. Die Enttäuschung begann langsam vor sich hin zu brodeln und sich ihren Weg an die Oberfläche zu bahnen, da spürte ich, wie sich mein Pferd plötzlich dem Zug an seinem Zügel widersetzte. Ein Blick über die Schulter auf seine angelegten Ohren und aufgerissenen Augen bestätigte meine Vermutung, dass irgendetwas das Tier nervös machte.
Abrupt blieb ich stehen.
Der Wolf musste nun ganz in unserer Nähe sein. Vermutlich beobachtete er uns sogar aus einem sicheren Versteck heraus. Suchend schaute ich mich um, kniff die Augen zusammen und versuchte, auch die leiseste Bewegung im Unterholz zu erfassen, die ihn hätte verraten können. Doch zunächst blieb alles still.
Ich war nah daran, meinen Weg fortzusetzen und zog erneut an dem Zügel. Doch mein Pferd rührte sich keinen Deut mehr von der Stelle. Stattdessen riss es bloß unruhig seinen Kopf in die Höhe, sodass ich letztlich gebannt dort verharrte, wo ich war.
Wieder tat sich nichts. Kein Geräusch, außer dem Zwitschern der Vögel und dem hin und wieder aufkommenden Rascheln, wenn eine Maus unter den abgefallenen, vertrockneten Blättern nach Bucheckern oder dergleichen suchte. Kein Zweig, der verräterisch schwankte und darauf hindeuten könnte, dass dort soeben noch ein Wolf hindurch geschlüpft war. Nichts.
Und so kam es schließlich völlig unerwartet, dass ich, nachdem ich bloß für einen kurzen Moment über meine Schulter nach hinten gesehen hatte, wieder nach vorne schaute und mich plötzlich unmittelbar vor ihm fand: Dem Wolf!
Wie vom Donner gerührt starrte ich das Tier vor mir an. Der Wolf war von beeindruckend großer, muskulöser Statur mit glänzendem, pechschwarzen Fell und wilden, ungewöhnlich schwarzen Augen, aus denen er mich neugierig beobachtete. Es war eine ganz und gar absurde Situation, in der sich wohl jeder die Frage hätte stellen können, wer hier nun gleich Jäger und wer Gejagter sein würde. In diesem Moment allerdings befand sich die Waage noch im Gleichgewicht. Weder der Wolf, noch ich rührten sich. Ein jeder stand bloß reglos da und betrachtete sein Gegenüber wie vor einem anstehenden Kampf, wartend auf die Reaktion des Anderen.
Doch nichts geschah. Der Wolf ergriff weder die Flucht, noch griff er mich an – was mich zugegebener Maßen äußerst erleichterte, denn ich war mir nicht sicher, ob ich den Dolch so schnell zur Hand gehabt hätte, um mich damit verteidigen zu können. Also machte zuletzt ich den Anfang, trat vorsichtig einen Schritt zurück, hoffend, den Wolf dadurch nicht aufzuschrecken, und zog mein Gewehr ganz langsam aus der Satteltasche heraus. Der Wolf reagierte nicht.
Ebenso langsam hob ich das geladene Gewehr auf Augenhöhe, legte den Kolben an meiner Schulter an und zielte unverwandt auf die Stirn des Tieres. Der Wolf rührte sich noch immer nicht und ich konnte kaum glauben, dass er es mir tatsächlich so leicht machen sollte.
Ich legte den Finger auf den Abzug und drückte ihn behutsam durch, bis ich den Widerstand des Anschlags spürte. Dabei blieben meine Augen fest auf die Stirn des Wolfes gerichtet, der noch immer reglos dasaß. Doch gerade als ich den Druck meines Fingers verstärken und endlich schießen wollte, sprang er - als hätte er es geahnt - auf und lief davon. Allerdings nur ein paar Schritte. Dann hielt er wieder an und beobachtete mich erneut.
Ich nahm das Gewehr herunter in dem sicheren Glauben, er würde jetzt jeden Augenblick endgültig die Flucht ergreifen, doch er verharrte still auf seinem Platz. Also legte ich die Waffe abermals an und zielte wieder auf ihn. Und auch diesmal wartete er genau so lange, bis ich beinahe schoss, bloß um just im letzten Augenblick wieder aufzuspringen und ein Stück davonzulaufen.
Dieses Spiel wiederholte sich noch ein weiteres Mal und langsam wurde ich skeptisch. Was bewog diese Bestie bloß dazu, sich derart seltsam zu verhalten?
Entschlossen trat ich schließlich auf das Tier zu, das Gewehr jetzt in der linken Hand, während ich mit der Rechten den Griff des Dolches umschloss, den ich in einer Scheide an meinem Gürtel trug. Doch auch davon blieb der Wolf unbeeindruckt und harrte weiterhin aus, wo er war. Geradewegs ging ich auf ihn zu und beschleunigte sogar meine Schritte, wissend, dass dies ein nicht ganz ungefährliches Unterfangen war. Aber meine Erregtheit ließ mich alle Vorsicht vergessen und als der Wolf auch dann noch keine Anstalten machte, zu fliehen, warf ich schließlich das Gewehr zur Seite und zog den Dolch aus der Scheide, um ihn damit anzugreifen.
Tatsächlich ließ er mich sogar so nah an sich herankommen, dass ich ihn beinahe hätte berühren können, und ich machte mich schon bereit zu dem entscheidenden Sprung. Da aber rannte er los, wenn auch wieder nur so weit, dass er in etwas größerer Entfernung abermals auf mich warten konnte.
Konsterniert blieb ich stehen und überlegte, ob ich diese aberwitzige Jagd nicht einfach abbrechen sollte, doch mein Ehrgeiz war bereits entfacht und Aufgeben kam für mich nicht mehr in Frage. Also spielte ich dieses Spielchen weiter, wobei ich dem Tier nun zunehmend aggressiver folgte.
Auf diese Weise trabte der Wolf eine ganze Weile munter vorweg, während ich ihm blindlings hinterher rannte, bis er schließlich plötzlich in einer kleinen Höhle verschwand, deren spaltförmiger Eingang sich unverhofft hinter einem umgestürzten Baum auftat. Verdutzt blieb ich stehen.
Warum lief der Wolf in diese Höhle hinein? Bis hierhin hatte ich eigentlich den Eindruck gehabt, dass er über eine außergewöhnliche Intelligenz verfügte. Wie aber konnte er dann jetzt auf einmal so dumm sein, sich unweigerlich in eine Falle zu begeben?
Oder konnte es sein, dass der Wolf mich absichtlich hier her gelockt hatte und gar nun ich drohte, in eine Falle zu tappen? Nein, bei aller Eigenart, die meine Jagd bis jetzt zwar an sich gehabt hatte, aber ein solches Denken traute ich dieser Kreatur dann doch nicht zu.
Hin- und hergerissen blickte ich noch einmal zurück und stellte dabei fest, dass ich mein Pferd sowie mein Gewehr einfach ungeachtet zurückgelassen hatte. Aber im Grunde kümmerte mich das in diesem Moment nur wenig, denn ich war der Überzeugung, dass ich nun leichtes Spiel haben würde und sich die Jagd damit endlich dem baldigen Ende näherte.
Also wandte ich mich wieder dem Höhleneingang zu und trat näher an ihn heran. Ein kühler Modergeruch schlug mir wie eine Warnung daraus entgegen und weckte in mir unweigerlich einen gewissen Widerwillen. Allerdings reichte dieser noch lange nicht aus, um mich davon abzuhalten, die Höhle in leicht geduckter Haltung und mit angriffsbereit vorgestreckter Waffe zu betreten.
Im Eingangsbereich sorgte das Tageslicht noch für genügend Helligkeit, um gut sehen zu können. Aber je tiefer ich in die Höhle vordrang, desto dunkler wurde es. Bei jedem weiteren Schritt, den ich auf dem zunehmend schlüpfrig feuchten Boden tat, wurde das Gefühl einer nicht fassbaren Bedrohung stärker, wobei ich noch nicht einmal genau erklären konnte, warum das so war. Handelte es sich doch lediglich um einen einzelnen Wolf, dem ich da auf den Fersen war...
Heute verfluche ich diesen Moment immer und immer wieder, und ich wünschte mir nichts mehr, als dass ich damals auf dieses Gefühl gehört hätte. Aber ich tat das Gegenteil.
Die unaufhaltsam an mir heraufkriechende Furcht ignorierend, die Sinne auf das Feinste geschärft und die Muskeln bis auf den Kleinsten angespannt, ging ich unbeirrt weiter. Nervös umklammerte ich den Dolchgriff mit meiner feuchten Hand und blickte mit schnellen Kopfbewegungen mal nach rechts, mal nach links, um möglichst keinen Winkel außer Acht zu lassen, in dem sich der Wolf möglicherweise verkrochen und auf die Lauer gelegt haben könnte. Glücklicherweise gewöhnten sich meine Augen bald ein wenig an die Dunkelheit, sodass ich mich ihm, den ich nach wie vor nicht entdecken konnte, wenigstens nicht mehr so blind ausgeliefert fühlte. Aber wo zum Teufel steckte er?
Plötzlich hörte ich, nicht weit von mir, ein kurzes, schnaubendes Geräusch. Schlagartig fuhr ich herum und hob den Dolch, bereit mich im Falle eines Angriffs sofort zu verteidigen. Unvermittelt begann mein Herz zu rasen, so dass der Pulsschlag wild in meinen Ohren pochte. Kalter Schweiß brach mir aus und ließ mich unwillkürlich erschauern. Auf einmal hatte ich das Gefühl, viel zu weit gegangen zu sein! Wie sehr ich allerdings Recht damit hatte, ahnte ich zu diesem Zeitpunkt bei Weitem noch nicht.
Mit zusammengekniffenen Augen versuchte ich mühsam, die Finsternis zu durchdringen, bis ich darin endlich die schemenhaften Konturen einer Gestalt wahrnehmen konnte. Ich war mir sicher, dass es sich dabei um den besagten Wolf handeln musste. Erschrocken wich ich ein Stück zurück und verstärkte reflexartig den Griff um meinen Dolch. Ich rechnete eigentlich fest damit, jeden Moment von dem Tier angesprungen zu werden, doch überraschender Weise verhielt es sich vollkommen ruhig. Sofort nutzte ich dieses Zögern zu meinem Vorteil und sprang mit vorgestreckter Klinge auf den Wolf zu. Dieser aber duckte sich bloß unter meinem Angriff und wich kriechend vor mir zurück. Unnachgiebig setzte ich ihm nach, doch er brachte sich bloß abermals durch ein paar Schritte rückwärts vor mir in Sicherheit. Dabei knurrte und winselte er, als mache ihm etwas große Angst.
Verwundert hielt ich inne, denn im Vergleich zu vorhin schien sich das Tier nun beinahe gegensätzlich zu verhalten. Durch diese Tatsache stutzig geworden, betrachtete ich es mir daher etwas genauer und dabei fiel mir auf, dass dieser Wolf hier deutlich kleiner und zierlicher war. Zudem schien er ein helleres Fell zu haben, ja, es war fast weiß und wenn man genau hinschaute, dann fiel sogar ein eigenartiges Leuchten auf, das von ihm auszugehen schien.
Fasziniert starrte ich auf den schimmernden Wolf und merkte dabei nicht, wie ich, ganz in seinen Bann geschlagen, einen weiteren Schritt auf ihn zutrat. Erneut wich er ein Stück vor mir zurück. Doch dies schien das entscheidende Stück zu viel gewesen zu sein, denn plötzlich ertönte ein gewaltiges, anschwellendes Grollen, welches fortwährend von den Höhlenwänden reflektiert wurde und sich dadurch spiralartig steigerte, bis es zuletzt schmerzhaft in meinen Ohren dröhnte. In demselben Moment, ganz unvermittelt, verschwand der Wolf vor mir, als habe der Erdboden ihn einfach verschluckt.
Bis aufs Mark erschüttert blickte ich wild um mich, um zu erfassen, was da gerade in der Höhle vor sich ging. Doch mir blieb keine Zeit mehr, es recht zu begreifen, denn nur einen Bruchteil von Sekunden später verlor auch ich den Boden unter den Füßen und stürzte haltlos einen Hang aus spitzem Geröll herunter, hinab in eine dunkle, undurchdringliche Tiefe.
Meine Erinnerung daran ist zwar bloß noch sehr bruchstückhaft, aber das Letzte, was ich spürte, war ein harter Schlag gegen meine Schläfe, womit schlussendlich mein Bewusstsein erlosch.