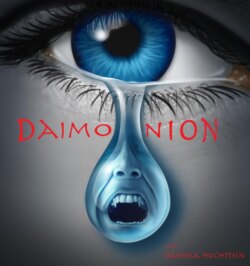Читать книгу Daimonion - Daniela Hochstein - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 5
Оглавление„Ohne noch länger zu zaudern, rannte ich los, so schnell es in meiner Macht stand, und als ich mein Ziel endlich erreicht hatte, war ich erstaunlicherweise nicht einmal außer Atem. Ich schaute noch einmal zum östlichen Horizont hinüber und als ich dort bereits den obersten Rand der Sonne flimmernd hinter einem Hügel auftauchen sah, konnte ich nur mit äußerster Erleichterung feststellen, dass ich es gerade noch rechtzeitig, aber keine Sekunde zu früh geschafft hatte. Schon begann sich eine zunehmende innere Hitze langsam in mir auszubreiten und meine Haut fing empfindlich an zu brennen. Die Müdigkeit, die ich in meiner Panik zwar für kurze Zeit hatte unterdrücken können, kehrte nun mit noch größerer Macht zurück und war kaum noch zu ertragen. Bald würde ich ihr nichts mehr entgegensetzen können und auf der Stelle einschlafen. Also machte ich, dass ich in das Innere der Höhle kam.
Ja, ich war wieder zu der Höhle zurückgekehrt, in der alles begonnen hatte. Ich hasste diesen Ort zwar zutiefst, aber mir war in der Eile keine andere Wahl geblieben.
Mit dem Wissen, dass nur die ewig dunkle Grube, in der ich zuvor fast gestorben wäre, mir jetzt zum sicheren Überleben dienen konnte, taumelte ich betäubt ihrem Abgrund entgegen. Ich hatte ihn schon fast erreicht, da trübte mir jedoch der nahende Schlaf zunehmend das Bewusstsein und schließlich verlor ich vollends die Besinnung.
Als mein Bewusstsein am nächsten Abend zurückkehrte, fand ich mich in einer äußerst unbequemen Position auf dem Boden der Grotte wieder und schloss daraus, dass ich gestürzt war und so zuletzt noch im Schlaf mein Ziel erreicht hatte.
Allerdings schien ich während dieses Schlafs - wenn er denn dann eingetreten war - tatsächlich wie ein Toter zu sein, der sich weder bewegt, noch irgendwelche Schutzreflexe besitzt, denn ich lag gerade so da, wie ich unten aufgetroffen sein musste. Eine unheimliche Vorstellung, wie ich fand, und ich war froh, dass ich mich am Tage nicht selber sehen konnte.
Schließlich sortierte ich meine Glieder und setzte mich auf. Ich wollte meine Hand auf den Boden aufstützen, um aufzustehen, da berührte ich jedoch zufällig etwas, das sich ganz und gar nicht wie der erwartete Steinboden anfühlte. Überrascht blickte ich herunter und erschrak.
Rings um mich herum kauerten mindestens zehn dieser hässlichen, fledermausartigen Kreaturen, die mir noch vor zwei Nächten mit ihren gierigen Bissen zugesetzt hatten. Diesmal allerdings machten sie keine Anstalten, mich damit zu quälen. Vielmehr waren sie um mich versammelt wie ein Rudel Wölfe um ihr Leittier. Reglos hockten sie da und beobachteten mich neugierig aus dutzenden Augenpaaren. Ein Anblick, der mich eigenartiger Weise anrührte.
`Ihr wisst, was ich bin, nicht wahr?´, sagte ich zu ihnen, wie ein einsamer Mensch, der mit seinem Hund spricht, und meine Worte hallten seltsam verloren von den felsigen Wänden wieder.
Natürlich antworteten die Wesen nicht, aber dennoch gaben sie mir das Gefühl, trotz meiner verachtenswerten Natur, Zuneigung für mich zu empfinden (sofern Tiere zu so etwas überhaupt in der Lage sind). Und das wollte etwas heißen. Denn nicht einmal ich mochte das, was ich nun war...
Plötzlich fröstelte ich. Jedoch nicht aufgrund der niedrigen Temperatur, die in der Höhle herrschte. Die machte mir nichts aus. Nein, dieses Frösteln kam tief aus mir selbst heraus und kroch unaufhaltsam wie eine eisgraue Spinne in jeden Winkel meines Körpers. So eng ich konnte, zog ich meine Knie an mich heran und legte meine Arme darum, als könne ich mich dadurch dieser inneren Kälte wenigstens ein bisschen entziehen. Ich muss aber wohl nicht erwähnen, dass es mir nicht wirklich gelang.
Ich sehnte mich nach jemandem, dem ich von all diesen Ereignissen hätte erzählen können. Oder wenigstens jemandem, der einfach bei mir war, um mir Mut zuzusprechen. Ich dachte an Elisabeth und meine Eltern. Ich dachte daran, wie schön es wäre, nun bei ihnen zu sein.
Aber so, wie es jetzt war, so, wie ich jetzt war, wäre es so tatsächlich schön? Was würde meine Familie wohl von der Kreatur halten, zu der ihr Bruder und Sohn geworden war? Würden sie mich nicht letztendlich dafür verabscheuen und am Ende verstoßen?
Oder noch viel schlimmer: was würde geschehen, wenn ich dem Drängen des Dämons nach Blut nicht länger standhalten konnte und meine Familie gar zuletzt tötete?
Nein, ich konnte nicht zu ihnen zurückkehren! Nicht so!
Wohl oder übel blieb mir vorerst nichts anderes übrig, als für mich allein zu bleiben. Allein mit meinem einzigen, dafür aber umso treueren Begleiter: meinem Durst. Ruhelosen, unbeugsamen, lüsternen, hungrigen Durst. Einem Durst, wie ich ihn ganz und gar nicht spüren wollte! Würde es wohl je wieder eine Nacht geben, in der ich einmal ohne diesen unheilvollen Durst erwachen durfte?
Mit zusammengepressten Lippen vergrub ich den Kopf in meinen Armen und merkte, wie sich Tränen hinter meinen Lidern sammelten. Kalte Tränen... War denn gar nichts an mir mehr warm? Würde ich nun für immer auf das Blut von Menschen angewiesen sein, um mich lebendig und warm anzufühlen, während meine Opfer ihr Leben dafür hingeben mussten?
Eine furchtbare Trübsal nahm auf einmal von mir Besitz und drückte mir mit ihrer mächtigen Faust die Kehle zu, sodass ich kaum noch in der Lage war, zu schlucken. Schließlich ertrug ich diese Enge nicht mehr länger und ließ meinen Tränen ihren Lauf. Und als hätten sie schon viel zu lange auf diesen Moment gewartet, schossen sie plötzlich hervor wie ein unaufhaltsamer Strom aus Bitterkeit.
Ich weinte so lange, bis von meinem Berg aus Trauer bloß noch ein hohles Gefühl in meinem Bauch übrig geblieben war. Zuletzt saß ich wie betäubt da und beschloss, meinem Durst heute Nacht nicht nachzugeben. Ich wollte kein Mörder sein! Vielleicht würde ich sterben, wenn ich nichts mehr trinken würde... Ja, fast hoffte ich es! Und so legte ich mich, meiner schauderhaften Existenz überdrüssig, auf die Seite, rollte mich zusammen, schloss die Augen und versuchte, in den Schlaf zu finden.
Obwohl mir dies zwar nicht gelang, so blieb doch immerhin mein Kopf leer. Keine Gedanken, keine Gefühle, bloß ein Zustand des unbewussten Schwebens, in dem ich bis zum erlösenden Morgen verharrte.
Am nächsten Abend wiederholte sich das gleiche Spiel. Wieder erwachte ich und war umlagert von meinen neuen Gefährten. Wieder brannte und wühlte der Durst, diesmal allerdings fordernder. Wieder gab ich ihm nicht nach, sondern blieb auf dem kalten Höhlenboden liegen, die Augen ins Nichts gerichtet, den Kopf taub, bis der kommende Tag mich wieder von jeglicher Wahrnehmung befreite.
Als ich am dritten Abend erwachte, war ich noch durstiger als zuvor. Ich war kaum noch in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen, so sehr beherrschte mich das Verlangen nach Blut. Aber auch diese Nacht beabsichtigte ich, nicht auf die Jagd zu gehen, so schwer es mir auch fiel. Ich war immer noch geistesgegenwärtig genug, um mir das Töten von Menschen – die ich noch immer als meinesgleichen betrachtete – zu versagen. Allerdings merkte ich, dass mein Körper zunehmend schwächer und mein Geist unkonzentrierter wurde, bis ich bald nur noch vor mich hindämmerte und immer häufiger von Phantasien heimgesucht wurde. Es tauchten Bilder von blutenden Wunden vor mir auf, die ich mit meinen Fangzähnen weiter aufreißen und deren Blut ich auflecken wollte. Das Blut floss, erst in Rinnsalen, dann in Bächen und irgendwann in Strömen. Ich geriet zunehmend in ein Delirium, bis ich irgendwann nicht mehr recht zwischen Phantasie und Wirklichkeit unterscheiden konnte. Wie ein verstörtes Tier kauerte ich auf dem Boden und begann verzweifelt, mich selbst in die Arme zu beißen und mein eigenes Blut zu trinken. Ich glaubte schon, nun bald wahnsinnig zu werden. Doch da brach bereits der neue Tag an, begleitet von dem ewig geduldigen Schlaf, und kam dem Wahnsinn letztendlich zuvor.
Dafür aber trieb mich der Irrsinn umso gnadenloser in der folgenden Nacht.
Ich schlug die Augen auf und war nicht mehr ich selbst. Wie eine ausgehungerte Bestie sprang ich auf, kletterte in Windeseile aus der Grotte heraus und rannte in die Nacht hinaus, auf der besessenen Suche nach Menschenblut. Meine ohnehin schon empfindlichen Sinne übernahmen dazu die Führung mit übernatürlicher Schärfe. Von dem puren Instinkt eines Raubtiers gesteuert, spürte ich meine Opfer auf und fiel über sie her. Dabei machte ich keine Unterschiede zwischen ihnen. Jeder Mensch, der leichtsinnig genug war, sich nach Einbruch der Dunkelheit noch außerhalb der Stadtmauern herumzutreiben, war mir recht. Ich habe dabei keine klare Erinnerung an irgendwelche Einzelheiten. Ich weiß nicht einmal, wie viele Menschen ich in jener Nacht tötete - oder sollte ich besser sagen: abschlachtete?
Aber irgendwann hörte es dann endlich auf. Die Bestie war satt. Mein Verstand klarte auf, wie der Himmel nach einem schweren Gewitter, und nun durfte ich mir die Reste dessen betrachten, was ich angerichtet hatte.
Ich schaute mich um, als wäre ich gerade erst aus einem schlafwandlerischen Albtraum erwacht und war entsetzt über das, was ich vor mir erblickte.
Vor mir lagen drei grausam zugerichtete Leichen von Menschen, die dem äußeren Anschein nach – oder dem, was noch davon übrig war - keine bösen Absichten oder Gedanken gehabt hatten, als sie unglücklicherweise meinen Weg kreuzten. Ich hingegen war mit ihnen in meinem Blutrausch nicht zimperlich umgegangen. Einem Mann hatte ich die Kehle so zerfetzt, dass der Kopf abgerissen neben seinem Körper lag. Einem weiteren Mann hatte ich, wie es aussah, sämtliche Knochen, einschließlich des Genicks gebrochen. Er lag schneeweiß und völlig verdreht am Boden. Die Dritte im Bunde war eine Frau. Ihr hatte ich den Brustkorb auf und das Herz herausgerissen, welches nun, bloß noch ein schlaffes Häuflein Fleisch, leergesaugt neben ihr lag.
Dieser grauenvolle Anblick war genug dessen, was ich ertragen konnte. Abrupt wandte ich mich von dem Zeugnis meiner unzweifelhaften Grausamkeit ab und schaute erschüttert hinauf zu den Sternen.
`Was, Gott, hast du mir angetan?´, flüsterte ich zunächst fassungslos, doch dann packte mich plötzlich eine noch nie gekannte Wut. Ich ballte meine Hände zu Fäusten und schrie in den Himmel: `Verdammt, was hast du nur aus mir gemacht?´
Ich schrie diese Worte so laut, dass mir die Kehle brannte, aber meine Stimme verhallte bloß ungehört in der alles überdeckenden Dunkelheit. Eine Antwort bekam ich nicht. Allein eine der mir bereits bekannten Fledermäuse hing an einem Ast und schaute mich stumm an.
`Siehst du das?´, herrschte ich in Ermangelung eines Schuldigen nun sie an und zeigte mit meinem Finger auf das Schlachtfeld hinter mir. `Siehst du, was ihr aus mir gemacht habt? Sieh dir das an! IHR HABT MIR DAS ANGETAN!´ Und weil ich nicht wusste, wohin mit meinem rachesüchtigen Zorn, bückte ich mich, griff nach einem faustgroßen Stein und schleuderte ihn mit meiner ganzen Kraft nach ihr. Doch sie blieb bloß stoisch an ihrem Platz, als wüsste sie bereits, dass der Stein sie verfehlen würde. Er prallte letztlich mit einem lauten Knall an dem Baumstamm ab, wo er eine tiefe Kerbe hinterließ, und schoss raschelnd ins Gebüsch, in dem er nichtsnutzig verschwand. Überschäumend vor Wut stürmte ich davon. Ich rannte einfach drauf los, ohne zu wissen, wohin. Ich rannte, so schnell ich konnte, in der Hoffnung dieses elende Szenario damit hinter mir lassen zu können. Ich rannte und rannte, durch den Wald, über Wiesen und Felder. Ich rannte solange, bis ich mich auf einmal vor dem Anwesen meiner Eltern wieder fand.
Überrascht blickte ich auf. Ich hatte gar nicht vorgehabt, hier her zu kommen, denn ich wollte nicht, dass meine Familie erfuhr, welch abscheuliches Wesen aus mir geworden war. Noch viel weniger wollte ich sie in Gefahr bringen. Und doch, nach dem größten Unheil, das ich angerichtet hatte, war ich, ohne es zu bemerken, nach Hause gerannt.
Nach Hause... Wie sehr fehlte mir mein zu Hause! Nun stand ich davor, und doch schien es für mich unerreichbar fern zu sein. So gerne wollte ich bei meiner Familie sein, und doch durfte ich mich ihr unter keinen Umständen zeigen.
Suchend schaute ich mich daher nach einem nah gelegenen Unterschlupf um, in dem ich mich verkriechen und wenigstens der Illusion hingeben konnte, daheim zu sein! Aber wo konnte ich mich vor der Sonne schützen, ohne entdeckt zu werden?
Mein Blick fiel auf den kleinen, längst nicht mehr benutzten Friedhof, der einstmals unseren Vorfahren als Grabstätte gedient hatte. Er lag etwas abseits des Haupthauses, am Rand eines kleinen Wäldchens, umgeben von hochgewachsenen Sträuchern, die schon lange nicht mehr zurecht geschnitten worden waren. Dort – das wusste ich noch von meinen Streifzügen mit Elisabeth aus Kindertagen - gab es eine kleine versteckte Gruft, die damals noch gut erhalten gewesen war. Seit Jahren war ich nun nicht mehr dort gewesen und ich war mir nicht sicher, ob sie überhaupt noch existierte.
Lautlos eilte ich zu dem Friedhof hinüber, wobei ich darauf achtete, mich nach Möglichkeit von Schatten zu Schatten zu hangeln, um nicht zufällig gesehen zu werden. Dort angekommen, fand ich die Gruft in der Tat noch unversehrt vor, obgleich die Dornensträucher den Eingang mittlerweile unpassierbar gemacht hatten. Aufgeregt griff ich mit der bloßen Hand nach dem Gestrüpp und riss es zur Seite, um mir Zugang zu verschaffen. Die Dornen stachen mir dabei zwar in das Fleisch meiner Hände und hinterließen dort blutige Wunden, doch innerhalb von wenigen Augenblicken schlossen sie sich wieder und Schmerzen spürte ich immer bloß für einen kurzen Moment.
Bald schon erkannte ich den schmalen Spalt, den eine schwere steinerne Platte von dem Eingang übrig gelassen hatte. Damals, als wir noch kleine Kinder waren, hatte uns dieser Spalt ausgereicht, um uns hindurchzuzwängen. Jetzt aber war ich zu groß dafür. Daher griff ich mit den Fingern hinein und zog die Platte zur Seite. Einem gewöhnlichen Menschen wäre das wohl kaum alleine gelungen. Aber für mich war es zu meiner eigenen Verblüffung ein Kinderspiel.
Sobald die Öffnung groß genug war, duckte ich mich und trat ein. Drinnen konnte ich wieder aufrecht stehen und als ich mich umblickte, stellte ich zufrieden fest, dass der Platz für mich ausreichen würde, obwohl mir der Innenraum größer in Erinnerung geblieben war. Aber es sollte ja nichts weiter sein als eine Schlafstätte. Also schob ich die Steinplatte wieder vor den Eingang und schloss mich in der Gruft ein, welche hiernach absolut dunkel war. Natürlich konnte ich trotzdem noch ausreichend sehen, aber von außen drang kein Lichtstrahl herein, was bedeutete, dass ich hier auch vor der Sonne keine Furcht zu haben brauchte.
Die Mitte der Gruft wurde von einem Sarkophag aus Marmor ausgefüllt. Auf dem Deckel war unser Familienwappen eingemeißelt, ein von einem Schwert gekreuztes Eichenblatt. Unter dem Wappen befanden sich Name und Daten des Verstorbenen, die mir allerdings nicht viel sagten. Sein Tod lag bereits zu lange zurück, als dass er in der Erinnerung unserer Familie noch präsent gewesen wäre.
Nachdenklich betrachtete ich den Sarg. Was wäre, wenn am Tage doch noch ein winziger Sonnenstrahl durch eine kleine, in der Nacht leicht zu übersehende Lücke im Gestein herein gelangen würde? Wäre in diesem Fall ein zusätzlicher Schutz nicht doch besser?
Kurz entschlossen hob ich schließlich den schweren Marmordeckel an und schob ihn etwas zur Seite, um skeptisch in den Sarg hinein zu lugen. Wie erwartet, fand ich darin die kläglichen Reste meines Vorfahren, wobei von diesem nun vielmehr bloß Staub und ein paar vereinzelte Knochen übrig geblieben waren. Dennoch war mir etwas mulmig zumute, als ich den Sarg noch ein Stück weiter öffnete und schließlich mit einem durchaus beachtlichen Maß an Überwindung begann, die Überreste mit meinen bloßen Händen herauszuschaufeln. Als ich dabei meine Finger zum ersten Mal in die mehlig, fettige Masse grub, überkam mich unwillkürlich ein plötzlicher Brechreiz, den ich nur mit Mühe unterdrücken konnte und der mich dazu zwang, meinen Plan noch einmal grundlegend zu überdenken. Zuletzt aber führte ich mir meine Taten aus den letzten Nächten vor Augen und kam zu dem Schluss, dass ich mir den Luxus des Ekels derzeit wohl kaum erlauben konnte. Und so fuhr ich denn fort, meinen Ururgroßvater Schub für Schub aus seiner letzten Ruhestätte heraus zu expedieren. Da ich mich allerdings dennoch nicht mit dem Gedanken anfreunden konnte, die sterblichen Überreste meines Vorfahren einfach auf den Boden zu werfen und womöglich auch noch darauf herum zu trampeln, öffnete ich noch einmal die Gruft, um sie schließlich handvollweise nach draußen zu schaffen und sie unter den umgebenden Sträuchern zu verteilen. Mochte sein Geist sie im Frühling zum Erblühen bringen...
Als ich endlich mit meiner Arbeit fertig war, dämmerte es bereits. Müde schob ich die Steinplatte wieder vor den Eingang, ging hinüber zu dem Sarg und legte mich etwas widerstrebend hinein.
Bis dahin hatte ich mir noch keine Vorstellung davon gemacht, wie es sein würde, sich lebendig in solch ein muffiges Totenbett zu legen, und es stieß mir zunächst unangenehm auf, dass es viel zu eng war, um mich, wie gewohnt auf der Seite liegend zusammenrollen zu können. Stattdessen war ich gezwungen, in gerader Haltung dazuliegen, die Hände über der Brust gefaltet, wie ein Leichnam. Für einen erholsamen Schlaf war das Ding auf jeden Fall nicht geeignet. Doch da ich tagsüber ohnehin wie ein Toter schlief, war der Sarg für diesen Zweck grotesker Weise ganz passend und insbesondere eben auch sicher.
Anfangs lag ich bei noch geöffnetem Sarg da, um mich zunächst an den Gedanken gewöhnen zu können, gleich hier drinnen zu schlafen. Der Geruch nach Moder und verfaulten Knochen lud nicht gerade zum Verweilen ein. Aber das war noch gar nichts gegen den Moment, in dem ich den schweren Marmordeckel über mir zuschob. Denn sobald sich der letzte Spalt geschlossen hatte, und die bisherige Finsternis einer undurchdringlichen Schwärze gewichen war, begann mein Herz plötzlich zu rasen, als sei der Teufel hinter ihm her. Hektisch schnappte ich nach Luft, in der Furcht, gleich ersticken zu müssen. Leider führte das dazu, dass mein Herz seine Geschwindigkeit noch steigerte und ich zuletzt glaubte, es müsse jeden Augenblick zerspringen. Ich versuchte, mich zusammenzureißen und mich strikt darauf zu konzentrieren, ruhig ein- und auszuatmen, allerdings mit wenig Erfolg. Schließlich stemmte ich mich panisch gegen den Deckel, um ihn eilig fort zu schieben und erleichtert aufzuatmen, als mir endlich wieder frische Luft entgegenschlug. Niemals hätte ich geglaubt, dass diese Enge eine derartige Furcht bei mir auslösen könnte.
Es bedurfte noch einiger Versuche, bis es mir endlich gelang, den Sarg über mir zu schließen und halbwegs ruhig darauf zu warten, dass der Tag mich von diesem Elend erlöste.
Als der folgende Abend mich wieder in die Welt der Lebenden zurückholte und ich meine Augen aufschlug, war ich für einen kurzen Moment irritiert, denn ich konnte trotz meiner übernatürlichen Sehkraft nichts erkennen außer tiefster Dunkelheit. Keine Konturen, keine Schattierungen, bloß eine Fläche von Schwarz. Unwillkürlich fuhr ich hoch, was jedoch auf halber Strecke für meinen Kopf mit einem schmerzhaften Rumms gegen den verdammten Sargdeckel endete, der sich mir dadurch wieder in Erinnerung brachte. Ich fluchte laut und schlug zornig mit der Hand gegen die Wand meines steinernen Gefängnisses. Dann aber schob ich rasch den Deckel zur Seite und sprang heraus, als fürchtete ich, diesem Ding sonst nie wieder entkommen zu können. Draußen holte ich erst einmal tief Luft und streckte erleichtert meine Glieder aus, die sich noch ganz unbeweglich und steif anfühlten.
`Was für ein Leben´, dachte ich dabei bloß sarkastisch, wurde aber kurz darauf von meinem treuen abendlichen Schatten wieder auf den Boden der grausamen Tatsachen zurück geholt, so dass mir selbst der Sarkasmus verging: Mein Durst nach Blut.
Der letzte Versuch, ihn zu ignorieren, hatte mir bloß demonstriert, dass seine Rache dafür grausam und unausweichlich war. Also beschloss ich, ihm nun rechtzeitig nachzugeben. Diesmal aber wollte ich ihn kontrollieren, und dazu erlegte ich mir bestimmte Regeln auf, welche die Tatsache des Trinkens – wenn es sich schon nicht vermeiden ließ - für mein Gewissen halbwegs erträglich machen sollten.
Die wichtigste Regel dabei lautete für mich, niemals von `guten´ Menschen zu trinken oder von solchen, deren Tod ganze Existenzen vernichtet hätte. Die Einzigen, die zu töten ich mir gestatten wollte, waren bösartige oder lasterhafte Menschen, die allein schon durch ihr bloßes Dasein Unheil oder Zerstörung über andere brachten. Und an diesem Abend wollte ich mit meiner Suche nach diesen `schlechten´ Menschen beginnen.