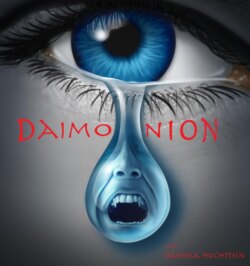Читать книгу Daimonion - Daniela Hochstein - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2
ОглавлениеWie lange ich dort ohnmächtig gelegen hatte, konnte ich nicht einschätzen. Sofern es noch Tag war, wusste ich es nicht, denn diesen düsteren Ort vermochte kein Tageslicht mehr zu erreichen. Ich hätte ebenso gut blind sein können.
Geweckt wurde ich von Schmerzen; zum einen in meiner Kehle, die so ausgetrocknet war, als bestünde sie bloß noch aus heißem Staub, und zum anderen an meiner rechten Schläfe, die bei näherem Betasten eine Platzwunde aufwies. Blut war mir über die rechte Wange gelaufen und dort angetrocknet, sodass es nun unter meinen Fingern abbröselte.
Damit hatte ich wenigstens eine Erklärung für den gemein pochenden Schmerz, der meinen ganzen Kopf ausfüllte und sich in Form einer hartnäckigen Übelkeit in meinen Magen fortpflanzte. Ein Zustand, in dem ich mich nach nichts mehr sehnte als nach frischer Luft! Jedoch vergeblich, denn wie das Sonnenlicht, hatte wohl auch kein einziger Windhauch je diese Grotte erreicht. Ich hatte den Eindruck, ein schwerer Ring läge um meine Rippen, gegen den ich stetig anatmen musste.
Das brennende Stechen oder Zwicken, das mich immer wieder befiel, konnte ich mir hingegen nicht erklären. Es trat jedes Mal an einer anderen Körperstelle auf, einmal am Arm, dann an der Hand und kurz darauf wieder an den Beinen, so dass ich vermutete, es könne etwas Lebendiges sein, was mir da zusetzte. Vielleicht Insekten oder gar Ratten?
Plötzlich spürte ich einen Biss an meinem Hals und zuckte unvermittelt zusammen. Hastig versuchte ich mich aufzusetzen, aber selbst schon der Versuch führte dazu, dass ich glaubte, mein Kopf müsse jeden Augenblick zerbersten. Würgend ließ ich mich zurück auf den Boden sinken, bloß bestrebt, den Schmerz rasch wieder unter Kontrolle zu bringen, ohne dabei auf der Stelle erbrechen zu müssen.
So lag ich mit geschlossenen Augen da, bemüht, nur auf die Kälte des Bodens unter mir zu achten, um für einen Moment alles andere vergessen zu können, was mich umgab und langsam begann, meinen Verstand gefährlich ins Wanken zu bringen.
Sobald ich den ersten Anfall von Übelkeit niedergerungen hatte, streckte ich – möglichst ohne dabei den Kopf zu bewegen - vorsichtig meine Hand aus, um nach meinem Peiniger zu tasten. Ich musste wissen, was mich da stach. Ich musste es unbedingt wissen! Doch gleich, wo ich auch hinlangte, dieses Wesen wich mir stets erfolgreich aus und piesackte mich dafür an anderer Stelle weiter. Dabei hinterließ es, wie ich fühlen konnte, blutige Wunden auf meiner Haut... Es waren also gar keine Stiche, nein es waren Bisse! Dieses Wesen fraß mein Fleisch! Oder trank es gar mein Blut?
Diese Erkenntnis brachte mich nun vollkommen aus der Fassung. Hektisch schnappte ich nach Luft und mein Herz hämmerte bis in meinen Hals hinauf, als wolle es gleich davon springen. Schweiß rann mir kalt die Achseln hinunter und ich fühlte bloß noch den drängenden Impuls, von hier zu fliehen. Ich wollte aufstehen, wurde aber auf halber Strecke von meinem Schwindel eingeholt, der mich dazu zwang, inne zu halten und mich bloß auf alle Viere zu stellen.
Zitternd stand ich da und versuchte in meiner Hilflosigkeit, mich wenigstens umzusehen. Ich weiß nicht, was ich mir in der hier herrschenden Finsternis überhaupt davon versprach, aber manchmal zahlt es sich eben aus, die Hoffnung nicht zu verlieren. So war es auch diesmal, denn zu meiner größten Erleichterung konnte ich nun einen seichten Lichtschimmer erkennen. Allerdings handelte es sich dabei nicht um das Tageslicht, das sich über irgendeine ungeahnte Lücke im Gestein einen geheimen Weg hierher gebahnt hatte. Nein, es war jenes eigentümliche Leuchten, das ich zuvor schon an dem weißen Wolf wahrgenommen hatte.
Ohne lange nachzudenken, biss ich mir auf die Unterlippe und krabbelte schwankend auf das Licht zu. Und in der Tat, als ich nah genug herangekommen war, konnte ich in seinem Zentrum die Umrisse des Wolfes erkennen. Reglos lag er da und ich konnte nicht einschätzen, ob er womöglich ernsthaft verletzt war oder bloß schlief. Aber gleich, wie es war, je näher ich ihm kam, desto mehr erfüllte mich das warme Gefühl von Trost und Hoffnung.
So kroch ich immer weiter an das Tier heran, so nah, dass ich schließlich, einem plötzlichen Wunsch gehorchend, sein schimmerndes Fell berühren konnte. Und als hätte ich den Wolf dadurch aus einem Traum gerissen, hob er überrascht seinen Kopf. Er sah mich aus seinen ungewöhnlich blauen Augen an und leckte zu meiner Verblüffung mit seiner weichen Zunge über meine Hand. Ein sanftes Kitzeln zog dabei über meine Haut, kroch mir leise den Arm hinauf und legte sich wie eine schützende Decke aus Zuversicht über meine schlotternde Seele.
Seltsam berührt von dieser Geste, die ich als Zeichen unserer eigenwilligen Verbundenheit verstand, drückte ich mich eng an sein wärmendes Fell. Wäre ich nicht so taub vor Angst gewesen und hätte den Ernst meiner Lage auch nur ansatzweise begriffen, so wäre mir in diesem Moment wohl bloß zum Schreien zumute gewesen.
Nach einer Weile aber bewirkte die tröstliche Nähe dieses eigentümlichen Wolfes, dass meine Furcht auf ein erträgliches Maß zusammenschrumpfte, während mein Puls sein erschöpfendes Tempo langsam drosselte. Zudem schien der Wolf eine abschreckende Wirkung auf jene blutsaugende Kreaturen zu haben, denn zu meiner Erleichterung hatten sie aufgehört, mich mit ihren Bissen weiter zu traktieren.
Gegen die schrecklichen Kopfschmerzen allerdings, welche nun die eingekehrte Ruhe nutzten, um sich gleich wieder mit neu erwachender Vehemenz hinter meiner Stirn einzunisten, konnte auch der Wolf nichts ausrichten. Ich schloss die Augen und versuchte, mir mit den Fingerkuppen die Schläfen zu massieren. Doch der Erfolg war leider äußerst gering, weswegen ich irgendwann aufgab und mich bemühte, die Schmerzen so gut es ging zu ignorieren. Schließlich galt es, mir so rasch wie möglich einen Ausweg aus dieser Grotte zu suchen und mich endlich aus ihr zu befreien.
Mit der Zeit gewöhnten sich meine Augen noch etwas besser an die Dunkelheit, sodass der matte Schein des Wolfes schließlich genügte, um in meiner unmittelbaren Nähe weitere Umrisse und Strukturen erkennen zu können. Wie erwartet, befand sich um mich herum nichts als loses Geröll und Felsen. Ich musste wohl in eine Spalte gerutscht sein, die in diese Höhle hier mündete, soviel konnte ich mir zusammenreimen. Das allerdings war auch schon alles. Die eigentliche Größe der Höhle vermochte ich in der Dunkelheit von meinem Platz aus nicht zu ermessen. Also beschloss ich, mich durch die Grotte zu tasten, bis ich einen Ausweg gefunden hatte.
Mit neuem Mut richtete ich mich auf und stellte dabei erfreut fest, dass der Schwindel deutlich nachgelassen hatte, sodass er mich nicht mehr so zu beeinträchtigen vermochte. Entschlossen streckte ich beide Hände nach vorne aus und setzte vorsichtig, nahezu blind einen Fuß vor den anderen, bis ich auf eine der Wände traf, an der ich mich weiter entlang tastete. Ich ging fest davon aus, auf diese Weise zwangsläufig irgendwann auf einen Haufen Geröll zu stoßen, den ich empor hätte klettern können. Aber gleich, wie lange ich die Wand auch verfolgte, sie blieb durchgehend senkrecht und es fand sich nicht einmal ein kleines Gefälle, geschweige denn eine Böschung, die mich in die ersehnte Freiheit hätte führen können.
Schließlich war ich einmal im Kreis gegangen, was ich dank des Wolfes, dessen Licht mir als Orientierung diente, mit Gewissheit sagen konnte. Doch stets hatte ich die unverändert gerade, kalte Felswand unter meinen Händen gefühlt, ohne irgendeine Unterbrechung.
Wie konnte das sein? Bisher war ich der festen Überzeugung gewesen, durch einen Erdrutsch abgestürzt zu sein, aber nun fand ich keinen Hinweis mehr darauf...
Ungläubig versuchte ich immer wieder mein Glück, wobei ich nicht mehr sagen kann, wie oft ich die eigentlich kleine Höhle noch umrundete. Es endete dennoch immer mit dem gleichen Ergebnis.
Zunächst verfluchte ich die Dunkelheit in dem festen Glauben, dass ich bei nur ausreichend vorhandenem Licht den Hang sofort gefunden hätte. Aber bald schon spürte ich, wie sich langsam die Verzweiflung in meine Gedanken schlich. Was würde mit mir geschehen, wenn ich keinen Ausgang fand? Es gab weder Wasser noch Nahrung, und sicherlich verirrte sich kein Mensch hier her, der meine mit der Zeit schwächer werdenden Hilfeschreie hören würde.
Würde meine Familie den gesamten Wald nach mir durchsuchen lassen, während ich hier unten unentdeckt verdurstete und verhungerte? Hier unten, gefangen in der ewigen Finsternis, angezapft von irgendwelchen blutgierigen Kreaturen... Oder würde der Wolf, selbst hungrig, mir vorher den Garaus machen?
Betroffen hielt ich inne.
Ich wollte - nein - ich durfte diesen Gedanken keinen Raum geben! Ich musste einen klaren Kopf bewahren, musste eine Lösung finden! Und noch während ich so dastand und mir nachdenklich auf den Fingernägeln kaute, mich immerwährend ermahnend, bloß ruhig zu bleiben, schien sich plötzlich in der Höhle etwas zu verändern.
Anfangs konnte ich nicht genau sagen, was es eigentlich war. Ich meinte, hohe, stoßartige Laute hören zu können, ganz leise anfangs. Doch als ich mich darauf konzentrierte, merkte ich, dass sogar die ganze Höhle von ihnen erfüllt war. Stetig wurden sie lauter und zu allem Überfluss auch noch von den Felswänden reflektiert, bis sie sich zu einem anhaltenden Ton vereinten, der schrill in meinen Ohren klingelte. Irritiert schaute ich mich um, ohne jedoch etwas erkennen zu können.
Dafür spürte ich jedoch plötzlich, wie mich ein kühler Lufthauch streifte. Hektisch flatternde Geräusche erhoben sich wie ein unterschwellig aufkommender Sturm, begleitet von einem vibrierenden Knistern, das sich zitternd auf meine Haut legte und mit Gänsehaut überzog.
Unsicher blickte ich mich nach dem Wolf um und zog es schließlich vor, mich schnellstens wieder an seine Seite zu flüchten. Doch als ich ihn erreicht hatte und mich schutzsuchend an seinen Körper lehnte, stellte ich beunruhigt fest, dass die Muskeln unter seinem weichen Fell bis aufs Äußerste gespannt waren.
Was auch immer gerade in dieser Höhle vor sich ging, ich hatte zunächst geglaubt, der Höhepunkt müsste längst erreicht sein. Doch ich hatte mich geirrt. Der unangenehm hohe Ton wurde zunehmend schriller, das Schwirren um mich herum gehetzter. Selbst der Wolf neben mir begann nervös zu zittern. Und wenn ich seine Anwesenheit bis dahin noch als beruhigend empfunden hatte, so genügte nun allein dieses Zittern, um auch den letzten Damm gegen die auf mich zurollende Panik gefährlich zu untergraben. Ja, es erforderte meine größte Selbstdisziplin, nicht einfach meinen bebenden Muskeln nachzugeben, aufzuspringen und bar jedweder Kontrolle in blinde Raserei zu verfallen. So verharrte ich stattdessen starr auf meinem Platz und presste meine Hände auf die Ohren, um diesem nervenzerrenden, mittlerweile bohrenden Ton nur irgendwie zu entgehen und mich bloß auf das Schnaufen meiner Atemzüge zu konzentrieren.
Da plötzlich war es still. Totenstill.
Skeptisch nahm ich meine Hände wieder herunter. Doch es blieb dabei: Nichts rührte sich mehr; nicht das leiseste Geräusch war noch zu vernehmen, sodass mir selbst das leise Rascheln meiner Kleidung während des Auf und Ab meines Atems wie ohrenbetäubender Lärm vorkam.
Ich war wie gelähmt.
Was hatte das alles zu bedeuten?
Da!
Ich hörte ein Schnauben. Nur kurz, aber dafür bedrohlich nah. Angestrengt starrte ich in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war und versuchte, dort etwas zu erkennen. Doch trotz des schwachen Lichtscheins des Wolfes, herrschte so tiefe Dunkelheit, als würde irgendetwas jegliches Licht unmittelbar verschlingen.
Der Wolf seinerseits schien allerdings mehr zu wissen als ich, denn mit eingezogenem Schwanz duckte er sich tief auf den Boden und stierte knurrend nach oben, während sein gesamter Körper vibrierte. Ratlos folgte ich seinem Blick und da sah ich es endlich!
Das Wesen befand sich direkt über mir. Ich konnte seinen kalten Atem auf meinem Gesicht spüren, und bei seinem Anblick gefror mir das Blut in den Adern.
Ich schaute direkt auf einen farblosen, riesenhaften Kopf, dessen hervorstechende Schädelknochen von durchscheinender Haut überspannt waren. Beidseits der zwei länglichen Krater, die sich in das Gesicht gruben, wo man sonst die Nase erwartet hätte, lauerten tief in ihren runden Höhlen zwei schwarze, unergründliche Augen. Ein rotes Licht glomm in ihnen und ich glaubte, durch diese Augen unmittelbar in die Hölle blicken zu können. Gerne hätte ich mich von ihnen abgewandt und wäre geflohen, doch ein hypnotischer Sog übermannte mich und machte es mir unmöglich. Stattdessen saß ich willenlos da, ausgeliefert, des sicheren Verderbens harrend, das sich unentrinnbar vor mir auftat.
Fauchend riss die Kreatur ihr lippenloses Maul auf und entblößte eine Reihe spitzer Zähne, an Grausamkeit nur noch übertroffen von zwei langen, messerscharfen Reißzähnen, von denen der Speichel troff. Sie allein genügten, mir des sicheren Todes gewiss zu sein.
Gleichzeitig aber packten mich zwei knochige Klauen mit blitzartiger Geschwindigkeit an Haaren und Brust. Wie geschliffene Messer bohrten sich die spitzen Krallen in meine Haut. Überrascht keuchte ich auf und trotz der entsetzlichen Schmerzen, die meinen ganzen Körper mit einem Mal durchfluteten, schien mein Wille plötzlich zurückgekehrt zu sein. Mit verzweifelter, aus Todesangst geborener Kraft versuchte ich mich aus diesem unnachgiebigen Griff zu befreien. Allerdings führte dies bloß dazu, dass die Kreatur ihre Klauen noch fester um mich schloss, bis mir fast gänzlich die Luft wegblieb und ich mich kein Stück mehr bewegen konnte. Wehrlos war ich diesem Ungeheuer nun ausgeliefert und es zögerte nicht lange. Mit einem Ruck zerrte es an meinen Haaren, sodass mein Kopf knirschend nach hinten gerissen wurde. Tausend Nadeln schossen mir in die Glieder. Schnell wie eine Schlange zuckte sein nackter Schädel hervor und seine scharfen Zähne schnitten wie Eiszapfen in meinen Hals, während sich sein Kiefer gnadenlos um ihn schloss.
Das vernichtende Reißen in meinem Nacken, der plötzliche, wie Feuer brennende Schmerz an meiner Kehle und das anschließende Gefühl, in rasender Geschwindigkeit meiner gesamten Lebenskraft beraubt zu werden, war das Letzte, was ich noch bewusst wahrnahm. Den Rest des Geschehens konnte ich dagegen nur noch schemenhaft verfolgen, als hätte sich ein bleicher Schleier über meine Sinne gelegt, um den unfassbaren Schrecken und die todbringenden Schmerzen für meinen geschundenen, menschlichen Körper auf ein erträgliches Maß zurecht zu stutzen.
Dennoch nahm ich mit überraschender Klarheit wahr, wie dieses Wesen gierig mein Blut aus mir heraus sog; und mit jedem Schluck, den es von mir nahm, hatte ich das Gefühl, ein Teil meines Selbst gehe dabei unaufhaltsam mit zu ihm hinüber. Mehr und mehr verlor ich mich in einem Strudel aus Besinnungslosigkeit, sodass ich bald nicht mehr in der Lage war, auch nur einen Gedanken vollständig zu Ende zu bringen; und zuletzt hatte ich gar den Eindruck, ich schwebte bar jeglicher Orientierung in einem richtungslosen Nichts aus Finsternis...
Doch dann musste irgendetwas geschehen sein.
Denn kurz bevor mein Bewusstsein vollständig zu erlöschen drohte, ertönte ein wütendes Knurren und Bellen; dann ein schriller, markerschütternder Schrei.
Als würde ich plötzlich von einer hohen Klippe stürzen, wurde ich jäh in meinen Körper zurückgesogen. Unwillkürlich wollte ich Luft holen, doch eine schwere Last schien auf meiner Brust zu liegen und machte mich unfähig, auch nur einen Atemzug zu tun. Verzweifelt versuchte ich mit meinen Armen die Last von mir zu stoßen, aber ich hatte einfach nicht mehr genügend Kraft, mich davon zu befreien. Japsend rang ich nach Luft und wand mich unter dem Gewicht sinnlos hin und her, wie ein Fisch, der elendig an Land verreckte.
Dann aber, gerade als erneut die Dämmerung einer Ohnmacht über mich hereinzubrechen drohte, spürte ich eine heiße, brennende Flüssigkeit, die mir zähflüssig auf meine Lippen tropfte. Aus einem mir fremden, unbegreiflichen Instinkt heraus, öffnete ich meinen Mund, um sie aufzufangen. Dabei dachte ich nicht darüber nach, was ich da eigentlich trank. Ja, es war mir gar nicht einmal möglich zu denken, denn eine wachsende Gier breitete sich auf einmal in meinem Körper aus. Eine alles bestimmende Gier nach eben dieser Flüssigkeit.
Über alle Maßen durstig suchte ich die Quelle, wie ein hungriger Säugling die nährende Brust. Und genauso sicher fand ich sie. Hastig, als hinge mein nacktes Leben davon ab, umschloss ich sie mit meinen Lippen und sog mit aller Kraft daran. Dabei nahm ich fasziniert wahr, wie dieser Saft bei jedem weiteren Zug, den ich davon nahm, köstlicher, reichhaltiger, facettenreicher und betörender schmeckte. Gleichzeitig wurde das Gewicht auf mir leichter und leichter.
Ich hätte erwartet, durch dieses seltsame Getränk langsam Befriedigung zu finden. Doch das Gegenteil war der Fall. Mein Verlangen wurde sogar noch größer. Wie besessen trank ich, immer und immer mehr, bis diese lustvolle Quelle schließlich versiegte und ich dann endlich erschöpft, aber glücklicherweise wieder frei atmend in den Schlaf fiel, gefüllt mit eigenartigen, düsteren Bildern.
Dieser Schlaf währte allerdings nicht lange, denn wie aus dem Nichts heraus erfüllte mich plötzlich ein tosender, richtungsloser Schmerz. Wie ein Sturm tobte er durch meinen Körper und trachtete dabei alles, was sich darin befand, zu verwüsten. Mir war, als würden mir die Gedärme bei lebendigem Leibe aus dem zerschnittenen Bauch herausgerissen und ich krümmte mich mit einem Schrei zusammen, in der Hoffnung, dieser schrecklichen Qual dadurch die Schärfe zu nehmen. Jedoch vergeblich. Wild wand ich mich auf dem Boden wie eine sterbende Schlange, ohne jedoch eine Position zu finden, die mir Erleichterung verschafft hätte. Zudem wurde ich von einer widerlichen, ja regelrecht imperativen Übelkeit übermannt, die sich bis ins Unerträgliche steigerte, sodass ich mich schließlich schwallartig zu übergeben begann. Dabei blieb mir kaum noch Zeit, Luft zu holen, was dazu führte, dass ich mich verschluckte und zuletzt, geschüttelt von einem furchtbaren Hustenanfall, nach Atem rang.
Und als gelte es, mich dabei zusätzlich bis in die letzte Faser meiner Existenz zu demütigen, entleerten sich darüber hinaus auch noch alle anderen erdenklichen und unaussprechlichen Körpersekrete aus den dazugehörigen Körperöffnungen. Schlussendlich hatte ich das Gefühl, mein gesamtes Innenleben würde sich unaufhaltsam nach außen kehren, um von mir am Ende lediglich einen Haufen stinkender Exkremente übrig zu lassen. Am liebsten wäre ich auf der Stelle tot gewesen, doch es gab kein Erbarmen. Ich musste dieses unerbittliche Wüten meines Körpers erdulden, bis es irgendwann endlich vorüber war. Und gerade als ich glaubte, die Quälerei sei nun glücklicherweise überstanden, folgte zuletzt noch der krönende Abschluss.
Ich hatte soeben ein paar tiefe Atemzüge der Erholung getan, da wuchs plötzlich ein Schmerz in meinem Oberkiefer, der an das stetig anschwellende Grollen eines gewaltigen Donners erinnerte. Er wuchs und steigerte sich, bis ich schon fürchtete, mein Kopf müsse jeden Moment zerplatzen; und dann entlud er sich wie ein greller Blitz, der sich am Horizont in tausend Äste zerteilt. Er zerstob wie Glassplitter in alle Richtungen und war dabei so vernichtend, dass ich mir nur noch beide Hände gegen den Kopf presste und schrie, schrie und schrie. Ohne diesem Prozess auch nur irgendwie Einhalt gebieten zu können, spürte ich voller Entsetzen, wie mir meine Eckzähne mit einer ungeheuerlichen Gewalt aus dem Kiefer gesprengt wurden; und unmittelbar darauf bohrten sich zwei messerscharfe Reißzähne wie frisch geschmiedete Dolche von innen heraus durch mein Zahnfleisch, begleitet von dem eisernen Geschmack nach Blut, der sich wie ein Film über meine Zunge legte.
Dann folgte nur noch Leere...
Gepeinigt, verzweifelt und bis an meine äußersten Grenzen erschöpft versank ich in einen unruhigen, gespenstischen Schlaf.“
***
Stille herrschte im Gerichtssaal. Der Blick der Richters haftete an den Lippen des Vampirs, der in seiner Erzählung inne gehalten hatte. Ambriel war sich bewusst darüber, dass er gleich Stellung beziehen müssen würde. Es war zu offensichtlich, was er getan hatte. Und als habe der Richter diesen Gedanken aufgeschnappt, wandte er sich an den Schutzengel.
„Ambriel.“ Wie einen zornigen Donner fühlte der Schutzengel seinen Namen auf sich niederfahren. Er streckte die Schultern und machte sich bereit. „Du hast das Recht, die Gedanken eines Lebewesens anzustoßen, auf Wind, Regen, Sonne und Wolken in geringem Maß Einfluss zu nehmen, du darfst Gefühle leiten, verstärken oder schwächen. Niemals aber darf ein Engel, gleich welchen Ranges, leiblich in das Geschick der Menschen eingreifen! Auch nicht in der Gestalt eines Wolfes. Du weißt das, Ambriel.“
Der Schutzengel senkte sein Haupt. Er wusste wohl, welche Strafe ihn erwarten würde. Es wäre keine Bessere als jene, der auch Armon noch entgegensah. Doch in seinem Herzen spürte er bloß Aufbegehren. Es gab nichts mehr zu verlieren. Für Armon nicht und auch für ihn nicht. Allein seinem Mut, seiner Kraft würde es obliegen, sie beide vor dieser Strafe zu bewahren. Entschlossen hob er wieder seinen Kopf und stellte sich den glimmenden Augen des Richters.
„Ich weiß wohl von dem Gesetz. Doch war es nicht Satan, der die Gesetze zuerst gebrochen hat? Er wollte sich die unschuldige Seele meines Schützlings rauben, ohne ihn verführt zu haben, ohne einen Handel mit ihm abgeschlossen zu haben, in dem diese Seele ihm freiwillig gezahlt wurde. Soll ich mich mit diesem Wissen heraushalten, während mein Schutzbefohlener in die ewige Verdammnis entführt wird? Was wäre ich für ein Schutzengel, wenn ich ihn nicht mit meinem ganzen Einsatz vor der schlimmsten Gefahr zu schützen versucht hätte, die einem Menschen widerfahren kann! Ich bitte Euch noch einmal, Euer Ehren: hört Euch die ganze Geschichte an, bevor Ihr das Urteil sprecht. Über meinen Schützling, ebenso wie über mich.“
Wieder herrschte Schweigen. Da trat Cheriour hervor.
„Verzeiht, dass ich mich ungefragt zu Wort melde. Doch es ist nicht so, dass Ambriel bloß seinen Schützling vor dem Teufel bewahrt hätte. Mit seinem Eingreifen hat er zwar den Körper des Dämons zerstört, hingegen nicht seinen Geist. Vielmehr hat Ambriel dadurch eine Waffe der Finsternis geschaffen, im Raub um Seelen noch viel ergiebiger, als es der leibhaftige Dämon in seiner dunklen Höhle nur sein konnte. Er hat nicht eine einzige Menschenseele gerettet, nein, vielmehr hat er bereits Dutzende an die Unterwelt ausgeliefert!“
Ein zustimmendes Raunen floss durch die Schar der Engel. Um den Richter verdichtete sich eine blau schimmernde, beinahe blendende Aura, als er seine Worte verlauten ließ, schneidend wie Glas.
„War dir in jenem Moment bewusst, Ambriel, welche Konsequenzen dein Tun haben würde?“
Ambriel blickte in die Augen des Richters, durchdrungen von dem Wissen über seine Unschuld, angefüllt mit Hoffnung.
„Nein, Euer Ehren.“
Der Richter nickte, sehr zum Missfallen von Cheriour, der gehofft hatte, die Verhandlung schon bald mit einem Sieg über das Böse beenden zu können.
„Nun, ich werde mir mein Urteil bis zum Schluss aufheben“, sagte der Richter. „Cheriour, hat die Anklage noch etwas beizutragen?“
Cheriour nickte. Er war nicht unvorbereitet geblieben.
„Euer Ehren, erlaubt, dass ich nun meine erste Zeugin vortreten lasse.“
Mit einer Geste signalisierte der Richter sein Einverständnis, worauf eine einfach gekleidete, magere Frau in den Saal geführt und auf ihren Platz im Zeugenstand gewiesen wurde. Cheriour trat vor sie.
„Marianne, erkennen Sie diese Kreatur dort?“, fragte er sie und zeigte auf den Vampir. Die Frau starrte in die Richtung und ihre Augen weiteten sich.
„Ja“, flüsterte sie mit zittriger Stimme.
„Was hat er Ihnen angetan? Können Sie es den Anwesenden hier schildern?“
Die Frau warf Cheriour einen furchtsamen Blick zu. Dann begann sie zu erzählen, stockend, auf der Hut, der Vampir könne sich ein weiteres Mal an ihr vergreifen.
„Er... er ist in unsere Hütte eingedrungen. Wie von dem Teufel besessen hat er uns angestarrt... und dann... dann hat er meinen Mann angefallen. Eine wilde Bestie, die ihm an den Hals gesprungen ist. Er hat seine Kehle aufgerissen... Das ganze Blut... Es spritzte und er labte sich daran, wie ein diabolischer Unhold...“ Die Frau rang nach Atem. „Dann kam er auf mich zu... Seine Augen... sie waren so seltsam, sie glühten. Ich sah seine Zähne, lange Eckzähne. Blut klebte noch an ihnen. Dann hielt er mich fest und... und... Lieber Engel, sagt mir: was ist mit meinen Kindern? Ich weiß nicht, was aus ihnen geworden ist. Hat er sie auch...?“ Die Frau brach ab. Tränen rannen ihr die Wangen hinunter. Ein lauter Schluchzer löste sich aus ihrer Brust und sie vergrub ihr Gesicht in ihren Händen.
„Vielen Dank, Marianne. Das genügt. Sie dürfen gehen.“ Sanft ergriff Cheriour den Arm der Frau und geleitete sie zum Ausgang. Beruhigend sprach er dabei auf sie ein und übergab sie zuletzt einem anderen Engel, der sie hinaus führte.
Betroffenheit erfüllte den Saal, greifbar, drückend. Selbst der Vampir blieb vor ihr nicht verschont. In seinem Gesicht spiegelte sich Schmerz wieder. Kurz hatte seine Hand gezuckt von dem Impuls, sie nach der Frau auszustrecken, als sie an ihm vorbei geführt wurde. So viel hätte er ihr gerne gesagt. Gerade ihr, der Mutter jener Kinder... Hannahs Mutter!
Ambriel war sich der Wirkung dieser Zeugin bewusst. Dennoch war es an ihm, Armon zu verteidigen. Er musste die Herzen für ihn gewinnen und den Richter überzeugen, auch wenn es nicht leicht sein würde. Ungeduldig wartete er, bis der Richter das Wort wieder an ihn reichte.
„Euer Ehren, ich möchte meinen Schützling gerne weiter berichten lassen. Ihr werdet sehen, wie es zu diesem Vorfall kommen konnte. Bosheit war dabei am wenigsten im Spiel.“
„Bitte“, gestattete der Richter. „Er soll fortfahren.“
Armon versuchte, in den Augen des Richters zu erkennen, wie es um seine Seele stand. Welch aussichtsloser Kampf da vor ihm lag... Und doch, der Glaube seines Schutzengels an das Gute in ihm, verlieh ihm Mut. Also fuhr er fort.