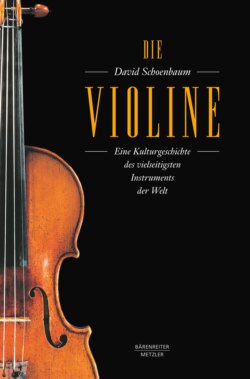Читать книгу Die Violine - David Schoenbaum - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Sackgassen
ОглавлениеDie weltweite Verbreitung der italienischen Geige, in etwa vergleichbar mit der Verbreitung des Rades, des Alphabets sowie des Gebrauches von Messer und Gabel, ist eine der großen Erfolgsgeschichten. Doch die Geschichte der Violine ist mehr als die Geschichte einer Violine.
Zwischen 1957 und 1960 erregten zwei Ankäufe das Interesse von Olga Adelmann, der Restauratorin am Berliner Musikinstrumenten-Museum. Um die Geigen identifizieren, klassifizieren und – nach vielleicht Jahrzehnten oder sogar Generationen von Beschädigungen, schlechten Reparaturen und willkürlichen Veränderungen – in ihren ursprünglichen Zustand versetzen zu können, war besondere Aufmerksamkeit nötig. Wie war ihr ursprünglicher Zustand gewesen? Wie konnte Adelmann sie restaurieren, ohne zu wissen, wer sie besessen und gemacht hatte und wann und wo sie hergestellt wurden?
Bereits ihre Intarsien in Form von Herzen, Blumen und geometrischen Mustern machten die neuen Exemplare für jede Sammlung einzigartig. Singulär aber waren auch ihre breiten Griffbretter, seltsam verlängerte Schnecken und ihre gleichsam archaische Architektur, ihre hinausgezogenen Ecken, die Einheit von Oberklotz und Hals, ihre fast senkrechten F-Löcher und der aus dem Holz der Decke herausgearbeitete Bassbalken. Insgesamt schienen sie dem Bau von Möbeln verwandter als dem von Instrumenten. Bevor die italienische Methode über die Alpen kam, wurden Geigen allerdings allgemein auf diese Weise gebaut. Dennoch war die Handwerksarbeit der vorliegenden Instrumente weder absichtlich altertümlich noch primitiv zu nennen.
Adelmann war sofort klar, dass sie nicht nur durch zahlreiche Werkstätten gegangen waren, sondern dass auch Menschen, die ein Interesse daran hatten, sie als italienische Geigen zu verkaufen, wichtige Umarbeitungen |101| vorgenommen hatten. Die Dekorationen ließen Brescia als den wahrscheinlichsten Herkunftsort vermuten. Eines der beiden Exemplare war mit einem offensichtlich falschen Zettel von Gasparo da Salò ausgestattet, das andere hatte keine erkennbare Identität. Bibliotheksquellen halfen nicht weiter. In den nächsten 30 Jahren verfolgte Adelmann in ihrer Freizeit und fast gänzlich auf eigene Kosten die Herkunft der Instrumente von der Schweiz über Kopenhagen bis nach Brüssel. Ihre Bemühungen förderten schließlich 21 Mitglieder derselben Violinfamilie sowie eine erhaltene Decke und einen erhaltenen Boden zutage.
Adelmann, die kaum als Sherlock Holmes und noch weniger als Javert vorstellbar war, war dennoch auf zweifache Weise geradezu einmalig qualifiziert für das Projekt, das sie in Gang gebracht hatte. Erstens, so bemerkte ihre Kollegin Annette Otterstedt nach ihrem Tod, verband sie eine aufrichtige Unschuld mit einer Hartnäckigkeit, die sie sich bis ins hohe Alter bewahrte, nachdem Fachleute und Kollegen einschließlich ihres Arbeitgebers sich vielleicht längst fragten, ob sich ihre Nachforschungen überhaupt lohnten.304 Zweitens verfügte sie über außergewöhnliche technische Fähigkeiten, die sie durch ein glückliches Zusammentreffen von Umständen und natürlicher Begabung erworben hatte.
Ihre Ausbildung begann nach dem Schulabschluss in der Werkstatt von Otto Möckel, einem der besseren Geigenbauer von Berlin, wo sie 1913 als Tochter einer Malerin und eines Ingenieurs geboren worden war. Dort hatte ihre Beharrlichkeit Möckel so überzeugt, dass er einwilligte, ihr das Handwerk beizubringen. Während im Jahr 1940 die meisten männlichen Zeitgenossen in Uniform steckten oder mit anderen »kriegswichtigen« Aufgaben beschäftigt waren, wurde Adelmann die erste staatlich geprüfte deutsche Geigenbaumeisterin. Sie besuchte dann Cremona, wo sie auf Sacconi traf, dessen »Segreti« di Stradivari sie eines Tages übersetzen sollte. Nach ihrer Rückkehr nach Berlin machte sie sich bei ihrem Arbeitgeber derart unentbehrlich, dass dieser ihr Werkzeug beschlagnahmte, als sie sich anschickte, ihren Dienst zu quittieren und sich selbstständig zu machen. Diese Entscheidung war wieder einmal typisch – sowohl für die Zeit als auch für Adelmann selbst. Sie fuhr nach Markneukirchen, reiste notfalls auf dem Dach eines überfüllten Eisenbahnwaggons und kehrte mit den benötigten Werkzeugen und Materialien zurück.
Mit Hilfe eines Musikers der Berliner Philharmoniker, der ihr sogar Kollegen als Kunden schickte, eröffnete Adelmann schließlich eine eigene Werkstatt im vierten Stock einer Ruine im Berlin der Nachkriegszeit. Doch sie war schnell bankrott. »Meine Arbeit als Restauratorin im Musikinstrumenten-Museum Berlin war für mich die glücklichste Wendung in meinem Leben, nachdem ich in den schwierigen fünfziger Jahren als erste deutsche Geigenbaumeisterin aus Mangel an Geschäftserfahrung Schiffbruch erlitten hatte und danach – notgedrungen – bei einem Gitarrenbaumeister gearbeitet hatte, was mir nun zugutekam«, schrieb sie später.305
|102| 1990, als sie eine erste Ausgabe ihrer Monografie vorlegte, hatte Adelmann nicht nur die geheimnisvollen Ankäufe identifiziert, sondern damit gleichzeitig eine ausgestorbene Spezies entdeckt und benannt, die – nach den oberrheinischen Schnittpunkten von Schweiz, Baden und Elsass, wo die Instrumente entstanden waren – fortan als alemannisch bekannt wurde.
Im Jahr 1995 gab es einen wunderbaren Moment, als Choon-Jin Chang, der junge zweite Bratscher des Philadelphia Orchestra, mit seinem Instrument, einer Viola zweifelhafter Herkunft, erschien. Er hatte sie ein Jahr zuvor von der Firma Moennig gekauft, die sie wiederum von einem Amateur in Quebec erworben und sie als aus Brescia oder Venedig stammend zu einem beachtlichen »italienischen« Preis angeboten hatte. Auf einer Konzerttournee in Europa entdeckte Chang in einem Londoner Geschäft die Erstausgabe der Monografie von Adelmann. Da er sein Instrument mittlerweile lieber mochte als jede Amati oder Guadagnini in seinem Umfeld, wollte er verständlicherweise alles darüber herausfinden und machte bei seiner Ankunft in Berlin einen Abstecher zum Musikinstrumenten-Museum.
Für Adelmann und Otterstedt muss es in etwa so gewesen sein, als ob ein Besucher ein Wollhaarmammut an der Leine über die Schwelle führt. Obwohl Changs Bratsche starke Veränderungen aufwies, war sie eindeutig ein Mitglied der alemannischen Familie und wahrscheinlich im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts von Frantz Straub erbaut worden. Als Chang die Bratsche für sie anspielte, bestätigte das zu ihrer Freude, dass ein alemannisches Instrument es mit den italienischen Instrumenten in den besten Orchestern der Welt aufnehmen konnte. Ein Jahr später war Adelmanns Datenbank auf 33 Exemplare angewachsen, darunter eine Bassvioline in Cellogröße, sechs Tenorviolinen und zwei Sopranviolinen; außerdem existierte ein Abendmahlstisch des Instrumentenbauers Hans Krouchdaler – bis 1889 in Gebrauch –, der die gemeinsamen Ursprünge beleuchtete.
Otterstedts Entschlüsselung ihrer gemeinsamen Botschaft war lehrreich und entwaffnend einfach: die Erbauer dieser Geigen waren weder reisende Musikanten, die ebenso wie ihre Kollegen von den Niederlanden bis Brescia ihre eigenen Instrumente herstellten, noch waren sie professionelle Lautenmacher wie ihre Kollegen in Füssen. Sie scheinen vielmehr solide Bürger vom Oberrhein gewesen zu sein, die zwischen der Mitte des 17. und dem frühen 18. Jahrhundert lebten, ihre Heimat nie verließen und ein Handwerk ausübten, das im Wesentlichen vom Möbelbau abgeleitet war. Straub, eine Ausnahme, scheint aus Füssen gekommen zu sein. Aber nichts an seinen Erzeugnissen deutet auf einen auswärtigen Einfluss hin.306 Im Gegensatz zu Verwandten, die es nach Italien zog, scheint er zuhause gelernt und geheiratet zu haben, ließ sich nieder und wurde zum Vater einer Generation von Geigenbauern aus dem Schwarzwald. Den Maßstab setzte Krouchdaler, zu dessen Arbeiten |103| nicht nur Instrumente jeder Größe gehörten, sondern – wiederum zur Freude von Otterstedt – auch der Abendmahlstisch von 1678, der die Nachbarschaft von Instrumenten- und Möbelbau und den Stellenwert bestätigt, den der Geigenbauer in der Kirche hatte.307
Otterstedt fügt hinzu, dass die Werkstatt von William Baker in Oxford zwischen 1669 und 1685 ebenso wie andere Werkstätten bis hinein nach Polen ähnliche Instrumente baute. Diese waren größtenteils für das interessant, was sie nicht waren: keine Gamben, aber auch nicht die wirklich archaischen Geigen, die Tanzmeister und Straßenmusikanten nutzten. Obwohl italienische Instrumente in London bereits gespielt und von Profis bewundert wurden, gibt es keinen Hinweis in Bakers Arbeit, dass in Italien eine wichtige Entwicklung stattfand.308
Bakers Instrumente scheinen dennoch der wachsenden Anzahl gehobener Amateurmusiker im post-puritanischen Oxford gefallen zu haben. Einem ähnlichen Kundenkreis – Katholiken und Protestanten – gefielen die auch alemannischen Instrumente. Nach 1688 hatte das Zisterzienserkloster St. Urban einen Instrumentensatz bei lokalen Geigenbauern erworben. Im Laufe des nächsten Jahrhunderts entdeckten calvinistische Schulen und ihre Schüler, wie viel Freude es machte, zum Vergnügen zu musizieren. »An Dilettanten, zum Teil ziemlich schwachen, fehlte es, besonders für die Streichinstrumente, nicht«, erklärte Eduard Wölfflin ein Jahrhundert später und begründete dieses Phänomen mit dem Umstand, dass dort »in so vielen vornehmen Häusern zahlreiche alte Violinen sich vorfinden«.309
Erhaltene Gemälde, Stiche und Bestandslisten zeigen, dass die Instrumente sich an populäre Tanzmusik ebenso anpassen konnten wie an die angenehm anspruchslose Amateur-Kammermusik, die in unzähligen europäischen Salons und Gesellschaftsräumen kultiviert wurde. 1997 prüfte ein Quartett – darunter Otterstedt und ihr Partner, der Instrumentenbauer Hans Reiners – eine Anzahl von alemannischen Instrumenten im Berliner Museum auf Herz und Nieren. Musikologisch sachkundige Aufführungen von Georg Muffat (1653–1704) und John Jenkins (1592–1678) vermittelten einen Eindruck davon, wie die alemannischen Vettern der Cremoneser Geigen klangen, bevor sie Ende des 18. Jahrhunderts für den raumfüllenden Klang umgerüstet wurden. Changs Bratsche bestätigte, dass die Alemannen nach einer Überholung auch für Beethoven, Tschaikowsky und Strawinsky eingesetzt werden konnten.
Unter diesen Umständen, so argumentiert Michael Fleming, hätte der Triumph und die allgemein anerkannte Überlegenheit der italienischen Modelle nach 1800 keineswegs selbstverständlich sein müssen.310 Aber die Umstände änderten sich. Bis weit in das 18. Jahrhundert hinein spielten die italienischen Komponisten, Solisten und Orchester, die das musikalische Tempo bestimmten, auf italienischen Instrumenten. Alemannische Geigenbauer machten ebenfalls |104| gute Instrumente. Doch Italien bestimmte die Mode, und Frankreich und England wünschten und verkauften italienische Modelle.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatten Spieler, Komponisten, Händler und Sammler italienische Geigen zum universellen Marktstandard gemacht. Alemannische Instrumente verschwanden auf Dachböden und in Museen oder zirkulierten unter falschem Namen als Brescianer oder Venezianer. Da sie so erhalten blieben, wie sie gebaut worden waren, waren Adelmanns Entdeckungen eine nachträgliche Anerkennung der Welt, die sie geschaffen hatte.311 Aber es war eine kleine Welt. Da die italienischen Modelle zunehmend dort gefragt waren, wo Geld war, und selbst Wertzölle bis zu 20 Prozent312 von Importen nach Deutschland nicht abschreckten, gab es wenig Anreize, den alemannischen Versionen Aufmerksamkeit zu schenken, geschweige denn nach ihnen zu suchen und sie aufzuarbeiten.
François Chanot, Paris, 1818
Was blieb, war das Bedürfnis, das italienische Modell, das mit Unterbrechungen durch das 19. bis ins 20. Jahrhundert dominierend bleiben sollte, zu verbessern. So gab es Vorkämpfer mit jedem Grad an Genialität, praktischem Sinn und theoretischem Können, die der italienischen Perfektion skeptisch gegenüber standen und unbeirrt oder sogar inspiriert von den expansiven Träumen und gescheiterten Hoffnungen der Savart, Joseph Chanot und Vuillaume im ständigen Streben nach besser angepassten, besser spielbaren oder besser hörbaren Geige weiterhin bauten, gossen, schweißten, kreuzten und sogar selber Neues erfanden.
In den 1820er-Jahren baute der Wiener Johann Georg Stauffer, der auch eine »Arpeggione« genannte Art Streichgitarre geschaffen hatte, eine längliche Raute mit halbmondförmigen C-Löchern parallel zu den vorgesehenen Zargen, bekannt als Bügel. Ihre Eleganz mit Anklängen an Savart, Chanot und die Biedermeiermöbel aus jener Zeit sowie mit Andeutungen des Art déco ein Jahrhundert später beeindruckt noch heute. Ein Jahrzehnt später ließ Thomas Howell aus Bristol eine gitarrenförmige Violine mit langem Hals, kurzem Körper und abgestuften Zargen patentieren.313 Doch trotz guter Absichten und Ideen führte der Weg vom Patentamt unweigerlich ins Museum, und die dortige Suche nach der Zukunft bestätigte nur, dass sie schon Vergangenheit war.
Das Museum der amerikanischen Geschichte der Smithsonian Institution, Hüter einer ausgezeichneten Sammlung von Amatis, Strads, Guarneris und Vuillaumes, beherbergt auch Schubladen voll mit frühen Amerikanern, zeitgenössischen Italienern, handelsüblichen Deutschen und Nebendarstellern |105| aus Boston, Miami, Denver und Seattle, darunter Gustav Henning, dessen »tiefe, weiche und gefühlvolle« Erzeugnisse in Zeitschriften beworben und per Post vermarktet wurden, bis er in sein Heimatland Schweden zurückkehrte, wo er 1962 starb.
William Sidney Mount, Stony Brook, New York, 1852
Zu den interessantesten und mit Sicherheit amerikanischen Besitztümern des Smithsonian gehört die »Hohlkreuz«- oder »Wiege der Harmonie«-Geige, die Willliam Sidney Mount 1852 patentieren ließ. Mount, bekannter als ein guter Genremaler, der mit seiner Kunst im Metropolitan Museum in New York zu Ehren kam, erfand vor seinem Tod im Jahr 1868 auch ein Dampfschiff-Schaufelrad, ein Segelboot mit Doppelhülle und ein Malatelier auf Rädern. Seine Geige mit ihrem trapezförmigen Rumpf und den bleistiftgeraden Schalllöchern schien fast ein Cousin ersten Grades, sogar ein Doppelgänger der Instrumente von Chanot und Savart zu sein. Aber es gibt keine Hinweise darauf, dass er direkt oder indirekt von ihnen beeinflusst worden war. Michael Collins aus Chelsea, Massachusetts, reichte im Jahr 1872 beim US-Patentamt seine »Echo Viol«, eine kürbisförmige Kreation mit zwei Schallkammern, ein. 40 Jahre später erschien Charles R. Luscombe aus Washington, D.C., mit dem Muster einer »Fiedel«, deren 16 Saiten, von C bis d1 gestimmt, sich über 16 Stege erstreckten. Die »Ukeline« von Oscar Schmidt, eine Mischform mit Bogen und Bedienungsanleitung, die er von Tür zu Tür verkaufte, wurde von 1926 bis 1964 hergestellt.
Das »Solophone« von 1893 von F. Bocker, war mit einem angesetzten Griffbrett und 40 Drucktasten ausgestattet, »um Tonhöhenänderungen ohne direkten Fingerkontakt zu den Saiten zu bewirken«. W. A. Tuebners undatierte Streichzither war wie eine Mandoline geformt. Aber solche Kreuzungen scheinen ihren Zenit im Jahr 1897 mit Franz Schwarzer erreicht zu haben, der 1828 im damals österreichischen Olmütz (heute Olomouc in Tschechien) geboren wurde. Er war nacheinander Möbelhersteller, Zitherbauer und Landwirt in Washington, Missouri. Schwarzer kehrte zum Instrumentenbau zurück, nachdem seine Zithern auf der Wiener Ausstellung 1873 drei Goldmedaillen gewannen. Seine Angebotspalette bestand aus Gitarren und Mandolinen sowie einer Konzertgeige »Modell Zither«, die auch mit Bratschenstimmung und in Form eines Cellos erhältlich war. Diese Instrumente wurden bis in die 1950er-Jahren verkauft – 30 Jahre, nachdem die Fabrik geschlossen worden war. Aber mit 196 dokumentierten Verkäufen der Geige und 14 des Cellomodells gehörten sie offenbar nicht zu seinen größten Erfolgen.
|106| Ebenso wie Kreuzungen beflügelten alternative Materialien konsequent die Fantasie. Alfred Springer aus Cincinnati war im Jahr 1891 der Erste, der ein Instrument aus Aluminium patentieren ließ, ein Material, das erst seit Kurzem zu erschwinglichen Preisen im Handel verfügbar war.314 Anfang der 1890er-Jahre begann Neill Merrill von der New Yorker Aluminium-Musikinstrumenten-Gesellschaft, einteilige Aluminium-Zithern, -Banjos, -Gitarren, -Mandolinen und -Geigen mit Resonanzböden aus Fichtenholz auszustatten. 1911 erfand Felipe Fruman – in einem zeitgenössischen Zeitungsartikel als angesehener Friseur aus Morón, Argentinien, bezeichnet – ein Verfahren zur Herstellung von Geigen aus Bronze, Stahl, Nickel, Zinn und Kupfer. In den 1930er-Jahren begann Alcoa in Buffalo, New York, für Joseph Maddy, einen Musiklehrer und Leiter des National High School Orchestra Camps in Ann Arbor, Michigan (aus dem später das Interlochen Center for the Arts hervorgehen sollte), mit der Produktion von etwa 435 Geigen, die aus einem einzigen Stück Aluminium gepresst waren.
Klangverstärkung war ebenfalls ein beliebtes Thema. 1854 höhlte Sewall Short aus New London, Connecticut, den Hals einer Violine von Honoré Derazey aus und brachte am Wirbelkasten einen Schallbecher an. Ein halbes Jahrhundert später war die nach ihrem Erfinder John Matthias August Stroh benannte Kombination eines Bogeninstruments mit dem jüngst erfundenen Grammophon eine anspruchsvollere Variante, bei der Steg und Schalltrichter durch eine flexible Aluminiummembran miteinander verbunden waren. Erhältlich als »Heim«-, »Konzert«- und »Profi«-Modell, war das Instrument bis zum Zweiten Weltkrieg ein Favorit von Tanzorchestern. Ein Jahrhundert nach ihrer Erfindung wurde berichtet, dass Varianten der Stroh-Violine an transsilvanische Volksmusik und die einheimischen Vorlieben in Myanmar, dem ehemaligen Burma, angepasst worden waren und immer noch gebaut wurden.315
Doch nach 400 Jahren Versuch und Irrtum wurde die interessanteste Entdeckung an den Grenzen zur Wissenschaft gemacht. 1862 veröffentlichte Hermann von Helmholtz seine Lehre von den Tonempfindungen.316 Bis 1877 wurde die Abhandlung regelmäßig aktualisiert und aktivierte, ja revolutionierte sogar die Untersuchungen zu Hören und Akustik. Dr. Alfred Stelzner, wahrscheinlich der erste Gestalter von Saiteninstrumenten mit einem akademischen Abschluss, ließ sich 1891 den Prototyp eines Verstärkers patentieren, der theoretisch für Violine, Viola, Cello, Kontrabass und Violotta verwendet werden konnte. Letztere, eine Oktave tiefer als die Geige gestimmt, war ein völlig neues Instrument und als Alternative oder Ergänzung zur Bratsche gedacht.
Über die Zahlenwerte der Ellipsen und Parabeln im Mittelpunkt seines Entwurfs blieb das Patent unspezifisch, doch die Idee war klar: Als Student sowohl der Physik als auch der Musik scheint Stelzner wirklich geglaubt zu haben, dass er nicht nur die Grundsätze, denen sich Generationen von |107| Vorgängern durch Versuch und Irrtum genähert hatten, sondern nachgerade eine neue Welt entdeckt hatte. In Wiesbaden fand er einen bekannten Geigenbauer, der einen Prototyp baute, in Dresden Investoren für die Finanzierung und in Markneukirchen einen Geigenbauer, der das Instrument herstellen konnte.
John M. A. Stroh, London, nach 1904
Die Produktion verlangsamte sich später, war anfangs aber beeindruckend groß und zog ein lebhaftes öffentliches Interesse auf sich. Während sein Geigenbauer innerhalb von 28 Monaten 93 Instrumente ausschnitt, lackierte und dekorierte, predigte Stelzner über ihre Tugenden zu jedem Publikum, das ihn hören wollte, suchte die Aufmerksamkeit der Medien, wo immer sie zu haben war, und verschaffte sich sogar prominente Empfehlungen von den Topgeigern der Zeit – darunter Eugène Ysaÿe, Joseph Joachim, August Wilhelmj und Émile Sauret –, von dem Cellisten David Popper und dem Komponisten Jules Massenet. Unterdessen spielten professionelle Quartette auf Stelzners Instrumenten, zeitgenössische Komponisten von bescheidenem Ruf schrieben für sie Musik, und seine Vertreter in Hamburg, Brüssel, London und New York machten Werbung für sie.
Aber die Blüte verblasste in kurzer Zeit. Zwei Jahre, nachdem Stelzers Instrumente auf der Columbian-Ausstellung von 1892 in Chicago vorgestellt worden waren, wurde das Unternehmen zu einer Konkursanhörung vorgeladen. Ein Eilantrag erlaubte es zwar, die Produktion bis 1899 fortzusetzen, doch Bankrott und Schlimmeres sollten folgen. 1906 erschoss sich Stelzer im Alter von 54 Jahren.317 Er hinterließ eine Handvoll Instrumente, die noch heute in Museen von Nürnberg bis South Dakota zu sehen sind, gelegentlich an seltsamen abgelegenen Orten zum Verkauf angeboten werden und manchmal Stoff für eine Sitzung bei einem musikwissenschaftlichen Kongress bieten.
Fehlende Qualität war die am wenigsten wahrscheinliche Erklärung für sein Versagen. Ebenso wie Adelmanns alemannische Geigen sind die von Stelzner |108| gut gemacht und voll funktionsfähig, doch für sie eine Nachfrage zu schaffen, war eine große Herausforderung. Zwar wurde die Violotta wegen ihres Klanges sehr bewundert, doch war sie vom Boden bis zur Decke doppelt so dick wie eine übliche Bratsche – wirklich ein Arm voll. Unterstützung von besseren Komponisten hätte helfen können, doch selbst Haydn war seinerzeit außerstande gewesen, das Baryton, eine Kreuzung im Celloformat, das sowohl gezupft als auch gestrichen wurde, durchzusetzen, und auch Schubert konnte den Arpeggione nicht retten. So hätte es mehr gebraucht als den respektablen, aber längst vergessenen Felix Draeseke, um die Violotta vor dem Aussterben zu bewahren. Ihr Preis war ebenfalls nicht von Vorteil. Stelzners Instrumente waren zwar preiswert, doch war das alleine noch kein Grund, eines zu erwerben, wenn französische, sogar alte italienische Geigen von gleichwertiger oder höherer Qualität für den gleichen Preis zu haben waren.
Dennoch überlebte die Suche nach einem durch die Wissenschaft geprägten Instrument, wenn es auch mehr als eine Generation dauern sollte, bevor der Gedanke in Cambridge, Massachusetts, wieder auftauchte, wo Frederick A. Saunders, ein Pionier in der Atomspektroskopie, Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften und Leiter des Harvard-Fachbereichs Physik, zufällig auch Amateur-Geiger/Bratscher und Präsident der amerikanischen Gesellschaft für Akustik war. Seit den 1930er-Jahren experimentierte Saunders mit Geigen, maß, analysierte und verglich die Wirkungskurven bei Hunderten von Instrumenten, von Einsteigerkisten bis zur im Interesse der Wissenschaft ausgeliehenen und von ihm selbst gespielten Guarneri del Gesù von Jascha Heifetz.
1963 versammelten sich etwa 30 Physiker, Chemiker, Ingenieure, Instrumentenbauer, Berufsmusiker, Komponisten, Musikwissenschaftler und Förderer sowie interessierte Zuschauer um einen Ping-Pong-Tisch in seinem Garten und kamen überein, sich zur Catgut Acoustical Society zusammenzuschließen. Auch wenn der Name lustig sein sollte – die Organisation war seriös. Während der darauffolgenden 30 Jahre sollte sie mit einer weltweiten Mitgliedschaft und einer Fachzeitschrift auf in der langen Geschichte des Instrumentenbaus beispiellose Weise Innovationen fördern und zu einer festen Größe werden.318
Der Garten gehörte zwar Saunders, die Gärtnerin aber war Carleen Maley Hutchins, zu dieser Zeit 52 Jahre alt und auch 40 Jahre nach dem Gründungstreffen noch aktiv. 1911 als Tochter eines Steuerberaters und seiner 40-jährigen Frau in Springfield, Massachusetts, geboren, war Hutchins so kreativ, regsam und amerikanisch, wie Vuillaume kreativ, regsam und französisch gewesen war. Während Vuillaume aus einem Roman von Balzac hätte stammen können, schien Hutchins wie von einer mittelatlantischen Willa Cather erfunden. Von früher Kindheit an unabhängig, trompetete sie sich als Pfadfinderin durch Sommerlager und pflegte in der Schule eine für Mädchen seltene Vorliebe für Holzbearbeitung. Später studierte sie Biologie an der Cornell University, bevor ihr, |109| wie den meisten Frauen ihrer Zeit, von einem Medizinstudium abgeraten wurde. Stattdessen entschied sie sich, was eher üblich war, für den naturwissenschaftlichen Unterricht an der Schule und heiratete nach dem Ende ihres Studiums.
Eine zufällige Begegnung mit Helen Rice, einer Kollegin an der New Yorker Brearley School, die später ein weltweites Verzeichnis von Amateur-Kammermusikspielern erstellen würde, gab ihrem Leben eine neue Richtung. Mittlerweile hatte sie von der Trompete auf die Bratsche gewechselt, ein eher traditioneller Einstieg für erwachsene Amateure. Mitte der 1940er-Jahre trat sie dem Kreis um Rice bei. Der nächste Schritt erfolgte 1947, als aus Hutchins, erst seit Kurzem Bratschistin, eine autodidaktische Geigenbauerin und Physikerin wurde, aus historischer Sicht eine bisher unbekannte Spezies. Da sie mit der Bratsche, die sie bei Wurlitzer, einem der führenden New Yorker Geigenhändler, gekauft hatte, unzufrieden war, beschloss sie, selber eine bessere zu bauen. Rice versicherte, sie würde ihren Hut essen, wenn dabei etwas herauskommen sollte. Zwei Jahre später servierte sie sich, Hutchins und 60 Freunden einen Kuchen in Form eines Hutes.
Hutchins sah diese Bratsche nicht nur als ihr erstes, sondern auch als ihr letztes Projekt an. Doch es war erst der Anfang. Die Verbindung zu Rice zahlte sich mehr als nur in Kuchen aus und führte zu einer spontan begonnenen sechsjährigen Lehrzeit bei Karl Berger, einem Schweizer Geigenbauer mit einer Werkstatt gegenüber der Carnegie Hall. Dann wurde sie Saunders vorgestellt, was zu Hutchins’ Angebot führte, ihm die experimentellen Instrumente zu bauen, die er für seine Forschung benötigte.
In den folgenden Jahren arbeitete sich Hutchins von einer Gehilfin zur Mitarbeiterin und bis zur selbstständigen Forscherin empor, rüstete ihr Haus in Montclair, New Jersey, um, um im Keller ein akustisches Labor unterzubringen, und baute einen steten Strom von Instrumenten, darunter die experimentelle »Le Gruyère« mit 65 in die Zargen gestanzten Löchern, die in verschiedenen Kombinationen zugesteckt oder wieder geöffnet werden konnten, um die innere Resonanz zu prüfen.319 1959 gewann sie ein Guggenheim-Stipendium, eine weitere Premiere für einen Geigenbauer. Im Mai 1962 feierte das Time Magazine die »füllige Hausfrau aus Montclair, New Jersey«, die zwar »einige Jahre elektronischer Untersuchung« benötigt hatte, um ihre Messvorrichtung zu beherrschen, mittlerweile aber Profis wie Eugene Lehner, zu seiner Zeit Mitglied im legendären Kolisch-Quartett und jetzt in der Boston Symphony, zu ihren Kunden zählte. Ein paar Monate später veröffentlichte sie ihren ersten Artikel im Scientific American.320 Inzwischen brachte sie in einem der oberen Zimmer der Wurlitzer-Werkstatt das Geigenbauer-Gegenstück zu einer Meisterarbeit bei Sacconi zu Ende. Während der vier Jahre dauernden Ausbildung erlaubte ihr Sacconi, seine Werkzeuge und Muster zu verwenden, und brachte ihr bei, in alten Chianti-Kisten Pappelholz für die Adern – die dekorativen Einlagen |110| die eine Geigendecke einrahmen – und in alten Polobällen Weidenholz für Eckblöcke zu entdecken. Er erlaubte ihr sogar, die Platten – d. h. die Decke und den Boden – der 1713er »Wirth«-Strad mit nach Hause zu nehmen, um ihre Verstärkerkennlinie in ihrem dortigen Labor zu messen.
Zu dieser Zeit war sie auf dem Weg zu ihrer bemerkenswertesten Leistung: ein Geigen-Oktett in abgestuften Größen, vom winzigen Sopranino bis zum Kontrabass. Die Idee stammte von Henry Brant, Professor am Bennington College, dessen Experimente mit räumlich getrennten Gruppen und Besetzungen von Klarinette, Klavier, Küchengeräten bis zu Blechpfeifen und Kammermusik-Ensembles Überlegungen zu Geigen aller möglichen Größen und in allen möglichen Stimmlagen anregten.321 Viele der Instrumente, die er sich vorstellte, hatten in der Tat Vorläufer, die bis zu Bach und sogar bis zu Praetorius zurückreichten. Aber seit mindestens 200 Jahren hatte niemand solche Instrumente gesehen.
Sie neu zu erfinden, wurde zur Herausforderung für Hutchins, und über einen Zeitraum von nahezu einem Jahrzehnt sollte das Projekt bis zu 100 Wissenschaftler, Amateure und Berufsmusiker beschäftigen. Es sollte auch zur Wiederentdeckung von Fred L. Dautrich aus Torrington, Connecticut, führen, eine Art amerikanischem Stelzner, der schon in den Zwanziger- und Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts eine Alt-Vilonia, eine Tenor-Vilon und einen Bariton-Vilono erfunden hatte, die wie ein Cello zwischen den Knien gespielt wurden.
Hutchins Instrumente hatten ihr Debüt 1962 im Rahmen eines Programms von Brant vor einem Publikum der Guggenheim-Stiftung. Die Instrumentengruppe erstreckte sich von einer kleinen Sopranvioline – die mit einem in den 1960er-Jahren für die NASA entwickelten Draht bespannt war, der es wegen der hohen Spannung erforderlich machte, dass die Musiker Schutzbrillen trugen322 – bis hin zu einer zwei Meter hohen Kontrabassvioline, die Töne produzieren konnte, die eine Oktave unter dem Cello lagen. Die Bratscherin Lillian Fuchs fand die Altvioline »aufregend, aber furchterregend«, und meinte das als Kompliment. Brant, der die Alt-, Tenor- und Baritonvioline in einem üblichen Quartett mit einer normalen Geige kombinierte, fand das Ensemble »ganz erstaunlich«. Drei Jahre später hatte das vollständige Ensemble seinen ersten öffentlichen Auftritt in der New Yorker Riverdale School und dem Saal im Christlichen Verein Junger Männer – YMCA – in der 92nd Street in New York in Anwesenheit des unverwüstlichen Leopold Stokowski, dessen Begeisterung für Neuerfindungen bis zum Philadelphia Orchestra 50 Jahre zuvor zurückging, und eines Kritikers der New York Times, der den Eindruck hatte, dass einige Instrumente vielversprechend waren.323
Mit der Zeit wurde die Altvioline von einigen Berufsbratschern für einen normalen, horizontalen Einsatz angepasst, auch wenn ihre Größe für jeden eine Herausforderung war, der nicht die Körpergröße eines Profi-Basketballspielers |111| hatte. Der Cellist Yo-Yo Ma spielte sie für seine Aufnahme des Bratschenkonzerts von Bartók im Jahr 1994 vertikal.324 Hutchins’ Biograf, der Musikwissenschaftler und Interpret Alter Musik Paul Laird, hat sich für den Bariton als Barockcello ausgesprochen. Am Vorabend des 21. Jahrhunderts waren sechs Sätze dieser Instrumente zwischen San Diego und St. Petersburg325 im Einsatz, während andere den mittlerweile vertrauten Weg in das Metropolitan Museum in New York, die Universität von Edinburgh, das Stockholmer Musikmuseum und das National Music Museum in Vermillion, South Dakota, gefunden hatten.
Sogar Hutchins, die das Oktett rund 200 Mal vorgeführt, Vorträge darüber gehalten und rund 100 Instrumente selbst gebaut oder ihren Bau überwacht hatte, bezweifelte, dass sie einen festeren Platz finden würden. Nachdrücklich geteilt wurden ihre Zweifel von John Schelleng, einem ehemaligen Forschungsleiter bei den Bell-Laboratorien, Autor eines klassischen Artikels über die Geige als Stromkreis,326 Mitbegründer von Catgut und Amateurcellist. Das Problem sei nicht die Einführung neuer, sondern die Weiterentwicklung herkömmlicher Instrumente, schrieb er 1974 an Hutchins. »Ein Musiker sollte ein nahezu erstklassiges Instrument erwerben können, ohne dass sein Vater deswegen Haus und Hof verpfänden muss.« Publikumsinteresse allein bedeute aber noch gar nichts, betonte er. »Die Personen, die erreicht werden müssen […], sind junge Spielerinnen und Spieler, die sich zu einem vernünftigen Preis ein erstklassiges Instrument wünschen, mit dem sie die Standardliteratur spielen [und] wenn möglich ihren Lebensunterhalt verdienen können.«327
Doch andere sahen weiter über den Tellerrand hinaus. Suzy Norris, Tochter eines Meeresbiologen, die das Handwerk von Paul Schuback, einem in Barbados geborenen und in Mittenwald ausgebildeten Geigenbauer in Portland, Oregon, gelernt hatte, war in den 1980er-Jahren in New York so beeindruckt von einem indischen Guru, dass sie die Suzalyne erfand, eine eigenwillige Mischung aus Violine und Viola mit Anklängen an die indische Esraj und die norwegische Hardanger-Fiedel, die oberhalb des Steges fünf Saiten mit acht darunterliegenden Resonanzsaiten kombinierte. »Ich mache auch normale Dinge«, erklärte Norris, »aber ich werde nie aufhören, auch die zu machen, die mir Spaß bereiten.«328
Ein paar Jahre später hatte David Rivinus, als Sohn einer amerikanischen Diplomatenfamilie in der Türkei geboren, Mitleid mit einem Freund, der unter anhaltenden Rückenschmerzen und einer Sehnenscheidenentzündung litt. Er bediente sich einiger Hinweise von Otto Erdesz, einem in Toronto ansässigen und herrlich eigenwilligen Ungarn, der die linke Seite der Bratsche neu gestaltete, um es seiner damaligen Frau, der israelischen Bratscherin Rivka Golani, leichter zu machen, die höheren Lagen zu erreichen.329 Rivinus stattete das gesamte Instrument durch eine Verkürzung seiner Länge bei gleichzeitiger Maximierung der Resonanzkammer neu aus. Das Ergebnis nannte er »Pellegrina« – Pilgerin.
|112| Margalit Fox schrieb in der New York Times,330 das Instrument sehe aus »wie eine übergroße, auf der Diagonalen gestreckte Birne«; die sich selbst als Freestyle-Geigerin bezeichnende Darol Anger nannte es in der Fachzeitschrift Strings »eine Salvador Dali gemäße Achterbahnmischung aus mit LSD bestreutem Toffee«;331 und Isaac Stern fragte scherzhaft, ob das Instrument zu lange in der Sonne gelegen habe. Als Michael Tilson Thomas, der Dirigent der San Francisco Symphony, es zum ersten Mal in den Händen seines zweiten Solobratschers Don Ehrlichs sah, fragte er sich, ob er vielleicht halluziniere. Doch obschon viele lachten, wenn Ehrlich sich mit seiner Bratsche niederließ, so war Rivinus’ »Pellegrina« seit Andrea Amati doch einer der ersten Entwürfe, der sich Belastungsbeschwerden widmete, die geschätzte 65 bis 70 Prozent der professionellen Orchestermusiker an einem bestimmten Punkt in ihrer Karriere plagen. Ehrlichs Kollegen mochten den Klang ebenfalls. Mit Rücksicht auf einen Beruf, dessen Kleiderordnung sich seit dem Berliner Kongress (wenn nicht sogar seit dem Wiener Kongress) nicht geändert hatte, bediente Rivinus den der Profession angeborenen Konservatismus mit einem konventionellen Modell, das die Vorteile der »Pellegrina« dennoch beibehielt. »Ich bin der zögerlichste Revolutionär, den man sich vorstellen kann«, erklärte er Fox, »aber jemand kam mit einem Problem zu mir, und obwohl es mir ein wenig peinlich ist, ist es dies, was ich mir ausdachte.«332
An der Schwelle des sechsten Jahrhunderts der Violine stellte Todd French, Leiter einer neu geschaffenen Abteilung für Qualitätsinstrumente bei Butterfield & Butterfield, einem Auktionshaus in der Gegend von San Francisco, weitere zeitgenössische amerikanische Geigenbauer in Hollywood aus. Unter den gezeigten Objekten waren eine asymmetrische blaue Violine des New Yorker Geigenbauers und -händlers Christophe Landon und eine auf einer Guarneri basierende Art-déco-Violine mit einem Goldball als Kopf von Guy Rabut.
Landon, Sohn eines Tierarztes aus Fontainebleau, baute seine ersten asymmetrischen Geigen als Lehrling in Mirecourt in dem Rot-Weiß-Blau der französischen Revolution. Mitte der 1980er-Jahre machte er sich dann auf den Weg nach New York, wo er nebenbei lernte, Polo zu spielen, vermutlich eine weitere Premiere für einen Geigenbauer. Rabut, Sohn eines Künstlers und Illustrators aus Connecticut und ein ungefährer Zeitgenosse Landons, gelangte nach New York über einen Sommergitarrenkurs in Vermont und einen dreijährigen Lehrgang der neu eröffneten Violinschule von Amerika in Salt Lake City. Nach einem fünfjährigen Aufenthalt bei René Morel in dem Vorzeigegeschäft von Jacques Français auf der West 54th Street, eröffnete er auf der siebten Etage der Carnegie Hall seine eigene Werkstatt, in der er für eine dankbare Kundschaft Reparaturen und Restaurierungen durchführte, bevor er sich entschied, sich in einem Loft im 15. Stock in Lower Manhattan nur noch dem Geigenbau zu widmen. Aber obwohl er und Landon eine Leidenschaft für Neuerungen teilten, |113| ließen sie keinen Zweifel daran aufkommen, dass ihre Erfindungen der ganz normalen Arbeit in gut eingeführten Werkstätten entstammten.
Die Ausstellung in Hollywood zeigte auch zwei Instrumente von Denny Ferrington, einem heimatvertriebenen Südstaatler und Gitarrenbauer aus Pacific Palisades, deren makellose und asymmetrische Tränenformen auf eine mögliche Massenproduktion und ein leichtes Erreichen der höheren Lagen angelegt waren.333 »Wenn Stradivari und Guarneri jetzt aufwachen und zu einer Geigenkonferenz gehen würden, wären sie sauer!«, sagte Ferrington in einem Interview im Jahr 1996. »Mann, nach 300 Jahren macht ihr immer noch dieses Zeug?«334
Landon beobachtete diese Frustration beim Kronos Quartet, einem der experimentierfreudigsten Ensembles der Zeit, das sich »immer noch mit den üblichen alten Instrumenten abgeben« musste. Rivinus hatte zumindest den Kronos-Bratscher Hank Dutt überreden können, einen ernsthaften Blick auf eines seiner Instrumente zu werfen,335 und beim Turtle Island String Quartet, der Welsh National Opera, dem Netherlands Radio Orchestra und der Boston Symphony Kunden gefunden. Rabuts geplantes Quartett blieb unerreichbar, und obwohl bekannte Spieler bereit waren, seine Art-déco-Geige auszuprobieren, blieb sie unverkauft.
Drei Jahre nach der Ausstellung in Hollywood war Butterfield & Butterfield selbst Geschichte, zumindest in der Gestalt, die Generationen gekannt hatten. 1999 wurde es von eBay und 2002 von Bonhams, einem Londoner Auktionshaus mit einer eigenen Instrumentenabteilung, erworben. Zu dieser Zeit spielte French wieder Cello in der Los Angeles Opera und vermarktete gleichzeitig verschiedene Produktlinien guter, aber durch und durch herkömmlicher Einstiegsinstrumente – viele von ihnen chinesischer Herkunft – mit unverbindlichen Namen auf unverbindlichen Zetteln. Fan Tao, Forschungsleiter bei D’Addario, einem der größten Hersteller von Saiten, erinnerte seine Kollegen daran, dass »das Einzige, für das die Menschen bereit sind zu bezahlen, Kopien alter Meister« seien, und chinesische Werkstätten wurden immer besser darin, diese zu Preisen anzubieten, die kein individueller Geigenbauer schlagen konnte.
In der Zwischenzeit verkomplizierten Umweltgesetze wie der Lacey Act in den USA das Leben in- und ausländischer Hersteller, indem sie sowohl die Einfuhr von so bedrohten Materialien wie Ebenholz, Palisander und bosnischem Ahorn als auch die Ausfuhr fertiger Produkte regulierten. Bei dem Gitarrenbauer Gibson führten die Bundesbehörden eine regelrechte Razzia durch. Zumindest theoretisch galten die Beschränkungen auch für Geigen.336 Das, so betonte Tao, erfordere von den Geigenbauern, wenn sie überleben wollten, eine innovative Strategie. Doch müssten sie, so fügte er hinzu, »die kaufwillige Öffentlichkeit« auch dazu bringen, sie anzunehmen.337