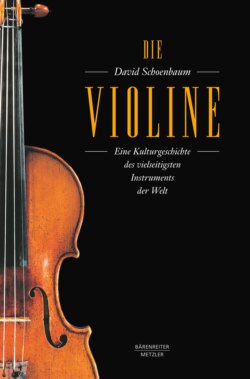Читать книгу Die Violine - David Schoenbaum - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
|114| Zurück in die Zukunft
ОглавлениеTrotz allem aber versprach diese schlimmste Zeit seit Vuillaume vielleicht die beste seit Guadagnini zu werden, was sie teilweise der Wissenschaft, teilweise der Geschichte und zum Teil der klassischen Wirtschaftslehre verdankte. Nach beinahe einem Jahrhundert, in dem der professionelle Geigenbau als so museumsreif und irrelevant angesehen wurde wie das Schmiedehandwerk, waren die neuen Geigenbauer in vielfacher Weise außergewöhnlich.
Einer der Ersten mit Vorbildcharakter war der 1966 geborene Stefan-Peter Greiner. Nachdem ihn die ehrwürdige Violinschule in Mittenwald abgelehnt hatte – teilweise, so vermutete er, weil er weder Bayer noch Katholik war, teilweise, weil er schon im Alter von 14 Jahren an seiner ersten Geige gearbeitet hatte und daher nicht der blutige Anfänger war, den die Vorschriften verlangten –,338 fand er sich mit einer Ad-hoc-Lehre bei einem schwedischen Geigenbauer in Bonn ab und studierte gleichzeitig Lackkunst und Musikwissenschaft an der Universität in Köln.
Obwohl erst gut 30 Jahre alt, trug er elegante rote Westen mit Jeans und kragenlose weiße Hemden, verkaufte Instrumente an die besten Musiker wie Christian Tetzlaff und das Alban Berg Quartett, war darum bemüht, dass die Wartezeit für seine Instrumente nicht mehr als vier Jahre betrug, und gab seinem Sohn den Vornamen Antonio. Zu seiner großen Freude schaffte er es sogar, dass ihn das Finanzamt als Künstler mit all den damit verbundenen Vorteilen und nicht als Geschäftsmann einstufte. Gregg Alf stand der Technik selbst zwar neutral gegenüber, hatte aber großen Respekt vor Hutchins, die nicht nur Physik und Geigenbau wie niemand zuvor miteinander verbunden, sondern auch Akustiker dazu gebracht hatte, sich von gesponserten Forschungen zum Aufspüren von U-Booten zu lösen und zu ihrem ursprünglichen Gebiet zurückzukehren.339 Greiner arbeitete wie Curtin, Alfs ehemaliger Partner, regelmäßig mit einem Physiker zusammen.
Die neue Zukunft wandte sich aber auch der Geschichte zu, als die Kräfte des Marktes, angetrieben durch eine ständig wachsende Nachfrage nach Restaurierungen und Kopien, zu immer intensiveren Untersuchungen von alten Instrumenten und Recherchen in Archiven führten. Ohne Hilfe, geschweige denn Interesse der akademischen Welt wurde ein dynamischer Kreislauf in Gang gesetzt, zu dem Forschungen, Publikationen, Webseiten, Sommerakademien und Jahresversammlungen340 gehörten und der zu mehr und besser, aber immer noch traditionell ausgebildeten Geigenbauern führte, die im Prinzip ebenfalls mehr und bessere, aber immer noch entschieden traditionelle Instrumente bauten.
|115| Als Hutchins ihre Entscheidung traf, eine bessere Viola zu bauen, hatten traditionelle Instrumente einen hohen Stellenwert für sie. Wie die meisten Innovationen war auch das Oktett eine dem Meer übergebene Flaschenpost; erst die Zeit würde zeigen, ob sie die Nachwelt erreichte. Für das Hier und Jetzt sah sie Innovation als ein Mittel, nicht als Selbstzweck. »Für die Geigenbauer von heute ist es immer möglich, sehr gute Violinen herzustellen, wenn sie sich der in den letzten 30 Jahren zusammengetragenen technischen Informationen bedienen«, erklärte sie. »Es ist nicht nötig, Millionen von Dollar zu zahlen, um ein gutes Instrument zu bekommen.«341
Diese Nachricht verbreitete sie nicht nur von Montclair bis nach China, sondern sie nahm sie sich auch persönlich zu Herzen. 1957 bekannte sie während einer Jahrestagung der Amerikanischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, dass sie ihrer Freundin Virginia Apgar, Professorin für Anästhesiologie an der Columbia University und Hobby-Geigenbauerin, die ein Auge auf ein perfekt abgelagertes Regalbrett aus Riegelahorn in der Telefonzelle des Presbyterian Hospitals geworfen hatte, zu Hilfe geeilt war, nachdem das Krankenhaus in der Sache keinerlei Entgegenkommen gezeigt hatte. Ihr Vorgehen erinnerte zur Hälfte an Charlie Chaplin und zur Hälfte an Rififi, den klassischen Film noir von Jules Dassin: Zuerst kopierte Hutchins das begehrte Regalbrett in einem anderen Material. Dann besetzte sie die Telefonzelle, während Apgar in ihrem weißen Kittel Wache stand und Hutchins daran erinnerte, jedes Mal, wenn ein Wachmann erschien, eine Münze in den Apparat zu stecken. Zu beider Entsetzen war die Kopie etwas zu lang. Hutchins jedoch, die nie um eine Idee verlegen war, hatte vorsorglich eine Säge mitgebracht. Damit bewaffnet zog sie sich mit Ersatzbrett und Säge in eine nahegelegene Damentoilette zurück. Eine vorbeikommende Krankenschwester, die die seltsamen Geräusche aus der Toilette verwirrten, wurde von Apgar abgelenkt und beruhigt, dass es sich nur um Handwerker handelte, die ausschließlich zu dieser Tageszeit dort arbeiten könnten. Dann nahm sie den Ahorn mit nach Hause und machte aus ihm den Boden einer Bratsche.342
1982 lud das chinesische Kulturministerium Hutchins dazu ein, die nach der Kulturrevolution und dem Besuch von Isaac Stern noch in den Kinderschuhen steckende Geigenindustrie zu beraten. Bis 1999, also über ein halbes Jahrhundert, nachdem sie mit ihrer Arbeit begonnen hatte, lag ihre Arbeitsleistung – zusätzlich zu rein experimentellen Entwürfen – bei schätzungsweise 75 Standardgeigen, 160 Bratschen und 12 Celli.343
Ihr Beispiel wirkte sowohl für die Öffentlichkeit als auch persönlich weit über ihre Werkstatt hinaus. Das Oberlin College und die Violin Society of America veranstalteten jetzt Sommer-Workshops, auf denen zeitgenössische Geigenbauer wie Dilworth und Zygmuntowicz die Teilnehmer über Werkzeuge, Lacke und den neuesten Stand des computergestützten Designs unterrichteten,344 während |116| Curtin und Tao sie über die laufenden Entwicklungen in der Akustik informierten. 20 Jahre, nachdem Hutchins ihr Licht in China hatte leuchten lassen, schimmerte es nun sogar auf der Oxforder Webseite von David Ouvry durch, wo der ehemalige Lehrer und Cambridge-Absolvent mit Stolz auf den von ihm für die Suche nach Knotenpunkten benutzten Sinusgenerator und den Frequenzzähler hinwies, den er verwendete, wenn er bei der Fertigung von Holzbrettern, aus denen Boden und Decke einer Geige werden würden, die Tonhöhe maß.345
Die Methoden und Technologien von Ouvry waren nicht nur ein Maß für den seit William Baker, dem Fiedelbauer aus der Stuart-Restauration, zurückgelegten Weg, sondern auch für die Fortschritte seit dem Oxford der frühen 1960er-Jahre, als das, was in der Stadt einem Violinengeschäft am nächsten kam, eine antiquarische Buchhandlung war. Neben anderen lokalen Neuheiten gab es ein Trio von jungen Geigenbauern, ein Franzose, ein Kanadier und ein Amerikaner, dessen aus Berufsmusikern, Amateuren und Schülern bestehender Kundenkreis an den von Baker erinnerte. Doch ihre Elektrowerkzeuge waren nunmehr so selbstverständlich wie die Zentralheizung, und bei der Reinigung feinster Risse machten sie regelmäßig Gebrauch von einem binokularen Mikroskop.346
Hutchins Einfluss war sowohl direkt als auch indirekt. Zu unterrichten war für sie seit den 1930er-Jahren so selbstverständlich, wie mit Holz zu arbeiten. Saunders selbst gratulierte ihr 1953 zu ihrem ersten Geigenbaulehrling. Zwischen den späten 1960er- und den 1980er-Jahren brachte sie an ein oder zwei Wochenenden im Monat drei bis zehn Studenten gleichzeitig Geigenbau und Plattenabstimmung bei, bis die Zahl ihrer Schützlinge insgesamt auf rund 50 angewachsen war. Unter ihnen waren ein pensionierter Physikprofessor, ein Ingenieur im Ruhestand, ein ehemaliger Forschungsleiter bei Lockheed Electronics und ein Wirtschaftswissenschaftler aus Washington; unter ihnen waren ebenfalls Deena Zalkind und Robert Speer aus Ithaca, New York, die ursprünglich ein Medizinstudium bzw. eine Konzertkarriere anstrebten, sich dann aber entschieden, Instrumente zu bauen, die selbst noch den Ansprüchen des Cellisten Mstislaw Rostropowitsch genügten;347 außerdem Gregg Alf und Joseph Curtin aus Ann Arbor, deren Instrumente gut genug für Yehudi Menuhin, Ruggiero Ricci und Elmar Oliveira waren;348 schließlich eine Gruppe von Gitarrenbauern, ein Violabauer und Diana Gannett, als vielseitige Streicherin und Kontrabassvirtuosin eine Doppelbegabung, die während ihrer Unterrichtszeit in Yale den ersten von Hutchins’ gebauten Kontrabass erstanden und zu lieben gelernt hatte und dann begann, sich für den Instrumentenbau zu interessieren.
Es war paradox genug, dass die Wiedergeburt eines der weltweit traditionsreichsten Handwerksberufe mit einer sozialen, politischen und kulturellen Rebellion zusammenfiel, wie sie seit 1848 nicht mehr erlebt worden war. Doch diesmal gingen die Generationenkonflikte mit handwerklicher Fortune einher.
|117| Allein die Zahlen waren verblüffend. Robert Bein erinnerte sich eine Generation später, dass es 1976 in Chicago überhaupt keine Vollzeit-Geigenbauer mehr gab. Das Strad-Verzeichnis für das Jahr 2004 führte in der Stadt zehn, in den Vororten sieben und in 45 US-Bundesstaaten weitere Geigenbauer auf. In 48 Ländern aller Kontinente – außer der Antarktis – gab es noch mehr.349 Allein in Berlin, wo Olga Adelmann einst für eine bezahlte Anstellung dankbar war, lebten 13. In Cremona, wo Stradivaris Zeitgenossen ein halbes Dutzend schon als Gedränge betrachtet hatten, waren es mindestens 54, die nunmehr eine große Anzahl von Frauen und Nichtitalienern sowie 120 Studenten und Auszubildende beschäftigten. Das am meisten bewunderte Geschäft in der Stadt war eine italienisch-kanadisch-amerikanische Koproduktion, die 1991 von Bruce Carlson gegründet wurde, einem ehemaligen Studenten der Meteorologie und früheren US-Marineoffizier, der auch Konservator der städtischen Sammlung geworden war.350
Doch der größte Entwicklungssprung wurde wohl bei der Qualität gemacht. Elmar Oliveira erklärte 1995: »Es gibt wahrscheinlich heutzutage mehr Geigenbauer als jemals zuvor, die gute Instrumente herstellen können.«351 Oliveira, ein Arbeiterkind aus Connecticut ohne verlässliche Unterstützer oder Geldgeber, hatte beim Moskauer Tschaikowsky-Wettbewerb eine Goldmedaille gewonnen. Als jemand, der auf dem Weg zu seinen bevorzugten Konzertinstrumenten viele Geigen einschließlich der 1726 von Guarneri del Gesu gebauten »Lady Stretton« und ihrer Kopie von Alf und Curtin, 1993 gebaut, gespielt hatte, war er eine glaubwürdige Quelle.352
In der Tat war die Kunst nie ausgestorben. Seit 1978, dem Jahr des Moskauer Triumphes von Oliveira, waren Händler überall damit beschäftigt, sich den Arbeiten bisher wenig beachteter Geigenbauer des 19. und 20. Jahrhunderts zu widmen, darunter denen von Giuseppe Rocca (1807–1865) und Annibale Fagnola (1866–1939) aus Turin, von Ansaldo Poggi (1893–1984) aus Bologna und von Stefano Scarampella aus Mantua (1843–1925), die ihr Arbeitsleben im Schatten von Guadagnini und den Patriarchen aus Cremona verbracht hatten. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts feierte eine blühende monografische Literatur die regionalen Traditionen von der italienischen Provinz Ligurien bis nach Ungarn.353 »Wenn sie Ihren Egotrip leid sind, sollten Sie einige Rocca- oder Fagnola Kopien versuchen«, bedeutete der Händler Adolf Primavera aus Philadelphia dem jungen Sam Zygmuntowicz, 1956 geboren, nachdem dieser ihm eine Strad-Kopie zur Prüfung gezeigt hatte.354
Im Rückblick gab Zygmuntowicz zu, jüngeren Vorläufern aus der Alten Welt wie dem in Frankreich geborenen Morel (1932–2011), der sein Werkzeug auf dieselbe Art und Weise handhabte wie große Spieler ihre Instrumente, Bewunderung und sogar Ehrfurcht entgegenzubringen.355 Der gebürtige Brasilianer Luiz Bellini (geboren 1935), der mit Sacconi bei Wurlitzer gearbeitet hatte, und der in Italien geborene Sergio Peresson (1913–1991), der für Moennig |118| arbeitete, waren positive Vorbilder. Peresson baute, verkaufte und wartete Instrumente für die Spieler an den ersten Pulten des Philadelphia Orchestra. Ruggiero Ricci, ein lebenslanger Sammler, tourte mit einer Guarneri-Kopie, die ihm Bellini auf seine flehentliche Bitte hin verkauft hatte.356 Beide Geigenbauer hatten die Bekanntheit der großen Werkstätten und die Unterstützung durch große Geschäfte genutzt, ein ganzes Arbeitsleben Restaurierungen und Reparaturen gewidmet und waren Tag und Nacht für ihre Kunden da. »Das habe ich mir gemerkt«, sagte Zygmuntowicz.357
Der Geigenbauer Frank Eickmeyer bei der Arbeit in Bosa, Sardinien
Eigentlich war die Kunst des Geigenbaus keineswegs tot, doch es sollten Generationen vergehen, bevor irgendjemand mit dem Geigenbau seinen Lebensunterhalt verdienen konnte. Sacconi selbst, für seine Zeitgenossen längst ein Kultobjekt, baute in den 40 Jahren seines Arbeitslebens im Durchschnitt ein Instrument im Jahr, und Carl G. Becker hatte nahezu seit Menschengedenken Amerikas größte Annäherung an ein Cremoneser oder Mirecourt-Pariser Patriarchat geschaffen. Mit Beginn der 1920er-Jahre war er mit seinem Arbeitgeber |119| William Lewis & Son aus Chicago vertraglich übereingekommen, dass er neun Monate im Jahr die klassischen Instrumente, die es in den in unmittelbarer Nähe seiner Werkstatt gelegenen Konzertsaal geschafft hatten, reparieren und restaurieren würde. In den verbleibenden drei Monaten baute er seine eigenen Instrumente, während er den Stab an seinen Sohn Carl F., der mit 16 Jahren mit der Arbeit begann, und an seine Enkelkinder Jennifer und Paul, die mit elf und fünfzehn Jahren im Metier anfingen, weiterreichte. Doch mit diesen Instrumenten, die zu Lebzeiten seiner Enkel als einige der besten aus amerikanischer Hand angesehen wurden, verdiente Becker nach einer Schätzung von Bein etwa einen Dollar pro Stunde.358 Peresson, der erfolgreichste amerikanische Geigenbauer seiner Zeit, stand schon kurz vor dem Ruhestand, als er seine eigene Werkstatt eröffnete.
»Bei den Bemühungen, Informationen zum Lebenswerk einer Reihe zeitgenössischer amerikanischer Geigenbauer zu bekommen, kam der Herausgeber zwangsläufig mit dem alten Sprichwort ›Kunst ist bescheiden‹ nach Hause«, berichtete Alberto Bachmann 1925 in seiner Encyclopedia of the Violin. Von 92 Einträgen bestanden 76 nur aus einem Namen und der Heimatstadt. »Es ist schwer zu glauben, dass einige Befragte Informationen über ihre Arbeit sogar für enzyklopädische Zwecke verweigerten«, klagte er.359 Fast 60 Jahre später war die Zahl der Ermittelten dank der enzyklopädischen Forschungsleidenschaft von Thomas Wenberg auf rund 3500 gewachsen, deren Gemeinsamkeit vornehmlich darin bestand, dass sie zwischen der Mitte des 19. und dem späten 20. Jahrhundert irgendwo in den Vereinigten Staaten eine Geige gebaut hatten. Gemeinsam war ihnen sonst allenfalls noch die verblüffende Vielfalt der auf nahezu jeder Seite seines einzigartigen Violin Makers of the United States erwähnten Brotberufe, beispielsweise »arbeitete als Bergmann«, »als Gerichtsreporter«, »als Gewerkschaftsvertreter«, »als Cowboy, Zimmermann und Bauunternehmer«, »stellte als Briefträger seine Lieferungen per Pferd zu«, arbeitete »als Tischler, Bürokaufmann, Schlachthofarbeiter, Trickcowboy, Lassowerfer, Zureiter wilder Pferde, Schäfer, Schmied und Brandmarker von Kühen«, war »von Beruf Maschinenbau-Ingenieur«, »ein Chiropraktiker von Beruf«, »betrieb das Ford-Autohaus«, »fertigte die Schneeschuhe an, die Admiral Byrd auf seiner Expedition zum Nordpol trug.«360
Von 26 zwischen 1902 und 1948 geborenen britischen Geigenbauern, die in Mary Anne Alburgers biografischer Sammlung von 1979 porträtiert werden, sind drei Frauen. Sechs der Porträtierten gelangten zum Geigenbau über Möbel und Holzarbeit, und zehn weitere kamen von der Musik einschließlich eines Studiums am Konservatorium und professionellem Orchesterspiel. Außerdem gab es einen ehemaligen Bankkaufmann, einen früheren Matrosen der Handelsmarine und einen ehemaligen Büromaschinentechniker. In einer Gesellschaft, die immer noch auffallend standesbewusst war, erstreckte sich |120| die Herkunft ihrer Befragten von der Arbeiter- bis zur soliden Mittelklasse, einschließlich eines Geigenbauers und eines Händlers die jeweils Mitglied und zweiter Kommandeur des Ordens des britischen Empire waren. Eine andere Geigenbauerin war sowohl die Tochter als auch die Ehefrau bedeutender Akademiker, die alle zum Ritter geschlagen wurden und von denen einer Fellow der Royal Society war. Nur fünf von ihnen hatten mehr oder weniger traditionelle Lehrlingsausbildungen durchlaufen – einer als Möbelbauer, ein anderer als Zimmermann. Einschließlich der Absolventen der Violinschule, die unter den jüngsten waren, hatte nur etwa ein Drittel eine Ausbildung als Geigenbauer.
Obwohl die wirtschaftlichen Umstände keine ausreichende Erklärung für deren Berufswahl liefern, müssen sie berücksichtigt werden. Zwischen 1950 und 2000 stieg die Weltbevölkerung von 2,5 auf mehr als 6 Milliarden Menschen. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen verdreifachte sich nahezu. Es war unvermeidlich, dass die wachsende Nachfrage die alten Instrumente irgendwann für alle außer den Superreichen unerschwinglich machen würde. Dieser Tag kam schon 1971, als die »Lady-Blunt«-Strad von 1721 bei Sotheby’s in London die 200.000-Dollar-Schranke durchbrach. Von da an ging die Spirale nur noch aufwärts. Es gab praktisch keine direkte Verbindung zwischen dem Verkauf der »Lady Blunt« und der Aufbruchsstimmung, die nachträglich mit 1968 in Verbindung gebracht wird. Doch was Paul Berman als »das utopische Hochgefühl« bezeichnete, das »über das Universum der Studenten und ebenso über die Universen einiger Erwachsener fegte«,361 sollte für die Wiederauferstehung des Geigenbaus eine ähnlich bedeutende Wasserscheide sein. Soweit man zurückdenken konnte, war es offenbar selbstverständlich, dass der Geigenbau ein ausschließlich männliches, meistens lokales, traditionelles und selbstbezügliches Handwerk war, das hauptsächlich von Kontinentaleuropäern im Kittel und mit Nickelbrille ausgeführt wurde. Nun aber schienen Vertreter der geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegszeit, die auf unterschiedliche Weise von Kunstschulen, Konservatorien, Gitarrenklassen oder Volksmusikfesten geprägt waren, den Geigenbau nicht nur als eine berufliche Option, sondern sogar als eine schöne neue Welt entdeckt zu haben.
Zum ersten Mal seit über 400 Jahren sah sich eine Subkultur, deren berufliche Identität und sogar ihre Familienverbindungen Jahrhunderte zurückreichte, einer Klasse von Einsteigern gegenüber, die kaum unterschiedlicher hätten sein können. Sie waren Amerikaner und Briten, Frauen, Juden und Studienabbrecher, und ihre Eltern Professoren, Lehrer, Künstler, Fotografen, Tierärzte, Winzer, Holocaust-Überlebende und spanische Bürgerkriegsveteranen. Insgesamt erschienen sie wie eine Mischung aus dem jungen Marx auf der Flucht vor kapitalistischer Entfremdung und Benjamin Braddock, der Titelfigur in dem zu jener Zeit symbolträchtigen Film Die Reifeprüfung, auf der Flucht vor einer Karriere in der Kunststoffindustrie.
|121|
Frank Eickmeyer, Geigenbauer in Sardinien und Köln, beim Ausarbeiten einer Geigendecke, 2005
»Nichts an dem, was unsere Generation bei dem Versuch antrieb, großartig aussehende und klingende Geigen zu bauen, hatte mit finanziellen Interessen zu tun«, erläuterte Carla Shapreau, eine Geigenbauerin aus San Francisco, die später Rechtsanwältin wurde.362 Für Anne Cole, Tochter eines Chirurgen und einer expressionistischen Malerin und schon wegen ihres Geschlechts |122| eine Seltenheit in der Branche, war es »die Hippie-Sache«.363 Die Eltern von Zygmuntowicz waren zwar über den Berufswunsch ihres Sohnes verwundert, aber entschlossen, ihm beizustehen, und suchten ihm eine Lehrstelle bei der Schreinergewerkschaft.364
Weder von ihrem Temperament noch von ihren Biografien her hatten die Neulinge viele Gemeinsamkeiten. Doch außer dem gelegentlichen Pragmatiker Curtin, der Luft für das natürliche Medium eines Geigenbauers hielt und Materialien in erster Linie als Mittel zum Zweck ansah,365 hatten sie alle »ein Faible für Holz«,366 konnten mit physischer und sozialer Distanz umgehen, hatten eine Abneigung gegen Hierarchien und verfügten über eine unbefangene Risikobereitschaft. Eine Generation später war Rabut mäßig amüsiert davon, dass die Nachwuchsgeneration ihn und seine Zeitgenossen bereits als »die ältere Generation« wahrnahm, und blickte wehmütig auf die kollektive Gleichgültigkeit seiner Generation gegenüber den Kreditkarten und MBA-Abschlüssen, die ihnen ein positiver Arbeitsmarkt erlaubt hätte.367
Vor allem aber teilten sie eine gemeinsame Leidenschaft für die Kunst selbst, die sich in einem nahezu ehrfurchtsvollen Respekt vor den von Alf als »Ikonen der Zivilisation« bezeichneten Werken ausdrückte, die die alten Meister geschaffen hatten. »Als ich lernte, eine Schnecke zu schnitzen, hätte niemand gedacht, dass ich auch ein gewitzter Geschäftsmann werden musste«, seufzte er.368 Andrew Dipper, ein junger Engländer, der nach Japan wollte, fand sich in Cremona wieder, wo er schließlich Sacconi übersetzte. »Geigenbau«, so erklärte er, »ist eine Haltung, kein Beruf.«369
Der dritte Impuls kam vom Handel selbst. Im Prinzip bedeuteten gute Zeiten für Händler auch gute Zeiten für Reparaturabteilungen und ein Goldenes Zeitalter für die Restauratoren, die in der Lage waren, alte Instrumente vom Zahn der Zeit, von Kunstfehlern und von durch unisolierte Dachböden entstandenen Schäden zu befreien. Aber die vorhandenen Arbeitskräfte, viele davon noch in der Vorkriegszeit ausgebildet, wurden rasch weniger, und traditionelle Schulungen vor Ort waren in den erfolgreichen Volkswirtschaften und Arbeitsmärkten, die sich jetzt von München bis nach San Diego erstreckten, unerschwinglich geworden.370 Sowohl Mittenwald, die Gründung aus dem 19. Jahrhundert mit einem dreijährigen Lehrplan, als auch Cremona, ein weiteres Sacconi-Vermächtnis mit einer drei- bis fünfjährigen Ausbildung, konnte jedes Jahr eine Anzahl von Absolventen vorweisen, doch keiner der beiden Städte gelang es, die Nachfrage in London, dem traditionellen Zentrum des Handels, und in den Vereinigten Staaten, seinem neuen Schwerpunkt, zu befriedigen.
Die Lösung lag in einer bis heute einzigartigen Welle des Aufbaus von Institutionen. 1972 unterstützten David Hill, ein Erbe der legendären Londoner Händlerfamilie, Charles Beare, ein Absolvent von Mittenwald, dessen Familienunternehmen bald zum Nachfolger der Hills werden sollte, und der |123| Geigenbauer Wilfred Saunders die Gründung von Newark, der ersten britischen Geigenbauerschule, die später auch John Dilworth besuchen sollte. Sie bot einen dreijährigen Kurs mit »einem guten Niveau von Fähigkeiten im Holzhandwerk« für eine Jahresklasse von zwölf Schülern an.371 Im selben Jahr gründete der in Schlesien geborene Peter Paul Prier, Absolvent von Mittenwald, die Violin-Making School of America in Salt Lake City, die – eine weitere Premiere – zum ersten Mal einen Vier-Jahres-Kurs anbot, dessen Teilnehmerzahl von anfänglich vier auf bis zu 20 anwuchs.
Frank Eickmeyer lackiert seine Instrumente gern in Sardinien, denn das warme trockene Klima wirkt sich sehr günstig auf das Ergebnis aus, 2012
Eine Generation später war sie mit ihren sorgfältig ausgearbeiteten Studienplänen, einer jährlichen Abschlussklasse von etwa 100 Studenten und überall in der Welt zu findenden Absolventen eine fest etablierte Organisation geworden. In den folgenden Jahren sollten ähnliche Schulen in Chicago, Boston, Leeds, Tokio, Wales, Schweden, Argentinien und an der Indiana University ihre Tore öffnen – während andere schließen mussten, weil sie paradoxerweise Opfer der erfolgreichen Antwort der neuen Schulen auf die Nachfrage wurden, aus der sie entstanden waren.
Noch an der Schwelle ihres dritten Jahrzehnts nahm man in der Schule in Newark einen Anteil ausländische, aber auch örtliche Bewerber auf, die eine zweite, wenn nicht dritte Karriere anstrebten. Doch die Vorgehensweise war bewusst konservativ. »Es ist unsere Philosophie, die besten Instrumente, die jemals gemacht wurden – die Strads und die Guarneris –, als Modelle für unsere Schüler zu benutzen«, sagte der Leiter in einem Interview. »Wenn man uns fragen würde, wo wir in zehn Jahren gerne stehen möchten, würden wir sagen, wir wollen das Gleiche tun wie bisher, nur besser«, fügte ein älterer Kollege |124| hinzu.372 Das »Fiedel-Rennen«, in dem vierköpfige Teams darum konkurrierten, in drei Acht-Stunden-Tagen eine spielbare, unlackierte Violine zu produzieren,373 war eine Neuerung, die die Amatis wohl mit Verwunderung betrachtet hätten. Aber das Fehlen von Elektrowerkzeugen – in Newark ein Grundsatz – hätte sich angefühlt wie zu Hause.
In Cremona bot ein siebenköpfiges Kollegium aus erfahrenen Lehrern im Geigenbau seinen ungefähr 100 eingeschriebenen Studenten mit sieben bis vierzehn Stunden pro Woche Unterricht einen umfangreicheren Lehrplan, der Kunst- und Musikgeschichte ebenso einschloss wie Handelsrecht, Buchführung, Italienisch für die Schüler aus mindestens 39 Ländern und allen Kontinenten, Englisch für Nicht-Muttersprachler, Akustik und Sport. Für Holzarbeit und Design bestand ein alternativer Lehrplan. Im Gegensatz zu Newark war Cremona mit elektronischen Messinstrumenten ausgestattet. Das Kollegium in Salt Lake City, bestehend aus vier Lehrern – zwei Geigenbauern, einem Künstler und einem Geigenlehrer –, zielte auf die Grundlagenausbildung, darunter Instrumententheorie, Geschichte, Bau, Reparatur und Einrichtung einer Geige, mechanische und künstlerische Zeichnung, Akustik, Musikunterricht und Orchesterspiel. Nach drei Jahren mit jeweils 35 Stunden Unterricht pro Woche zu einer Jahresgebühr, die in etwa den Studiengebühren einer staatlichen Universität entsprachen, wurde von den Kandidaten erwartet, eine unlackierte Violine fertiggestellt zu haben, eine technische und eine künstlerische Zeichnung vorzulegen, eine mündliche Prüfung zu bestehen und auf dem von ihnen gebauten Instrument vorzuspielen.
Hätte man sie zu einem Klassenfoto versammelt, so wären in Mittenwald die sechs Frauen unter den 35 männlichen Studenten ihres Jahrgangs aufgefallen – unter ihnen Ingeborg Behnke und Rena Makowski Weisshaar. In Salt Lake City war Joan Balter die einzige Studentin. Ingeborg Behnke machte eine bemerkenswerte Karriere als ausgewiesene Problemlöserin, ja sogar Wundertäterin für die Streicher der Berliner Philharmoniker, während Weisshaar sich in Los Angeles niederließ und bei den Jahrestagungen der Violin Society of America sowohl als Mitbewerberin als auch als Jurorin zu hohem Ansehen gelangte.374 Balters Sommerstudio beim Aspen Music Festival war für einige der besten Geiger der Welt ein unerlässlicher Betreuungsort geworden. Im Jahr 2004 führte die Entente internationale des maîtres luthiers et archetiers, das Kardinalskollegium des Geigenhandels, immer noch lediglich 15 Frauen unter 164 Männern auf. Verglichen mit 1967, als es nur ein weibliches Mitglied gab, war das immerhin eine bemerkenswerte Wachstumsrate.375
|125|
Werdegang einer Geige in der Werkstatt von Arthur Bay, 2015
Im Gegensatz zu den Gründungsvätern aus Cremona haben die modernen Geigenbauer auch öffentliche Gesichter, viele von ihnen auf Webseiten von beeindruckender Vielfalt und Raffinesse. Die Aufmerksamkeit der Print- und Rundfunk-Medien ist selbstverständlich. Als Druckbeitrag sind die |126| Geschichten häufiger in den Rubriken Lifestyle oder Features zu finden als in Kunst oder Wirtschaft. Als Sendungen tauchen sie in Radio- und Fernsehzeitschriften auf. Unabhängig vom Medium liegt der Tenor meistens auf dem Erstaunen, dass ein Handwerk, das reflexartig mit toten Italienern in Verbindung gebracht wird, nicht nur wieder modern und angesagt, sondern auch hochtechnologisch geworden ist.
Die neuen Geigenbauer – häufig belesen und ausnahmslos wortgewandt, sogar eloquent – sehen sich tendenziell als selbstständige Fachleute, die sich im Internet ebenso zu Hause fühlen wie im Supermarkt, und sie verhalten sich auch so. Aber ihre Begeisterung für Handwerk, Werkzeuge und Materialien, ihre Zusammenarbeit mit den Geigern und die Entschlossenheit einiger, Handel, Restaurierungen und Reparaturen anderen zu überlassen und ihr Leben ausschließlich dem Geigenbau zu widmen, rückt sie eher in die Nähe der Welt von Amati als der von Chanot.
Obwohl sie in Historiker und Wissenschaftler unterteilt werden können, sind beide Gruppen wechselseitig offen und schließen einander nicht aus. Die Historiker nehmen sich die Geschichte nicht nur zum Vorbild; eine Handvoll, darunter Dilworth, Dipper und Hargrave, eifern ihr nach und schreiben selbst Geschichte. Wissenschaftler wie George Bissinger und Martin Schleske glauben grundsätzlich daran, dass ein Instrument, das sowohl den Geigenbauer als auch die Spieler zufriedenstellt, durchaus nach einer computergenerierten »virtuellen Strad« gebaut werden kann.
Das gemeinsame Ziel, so sah es Hargrave, war eine sowohl einzigartige als auch eine »im-Stile-von«-Geige, die die Menschen eines Tages ebenso um ihrer selbst willen schätzen würden, wie Generationen vor ihnen ihre Lotts und Vuillaumes. Im Dorotheum, Wiens historischem Auktionshaus, kam es 1992 fast zu einem Skandal, als ein lokal bekannter Geigenschlepper die Kopie einer Guarneri filius Andreae von Hargrave eingeliefert hatte, die als Original angeboten wurde. Jacob Saunders, ein nach Österreich umgesiedelter Freund und Studienkollege von Hargrave aus Newark, entdeckte dies und wies die Direktion darauf hin. Hargrave wurde einbestellt, um die Identifizierung zu bestätigen, die lokalen Medien machten das Beste aus der Geschichte,376 und auf paradoxe Weise konnte Hargrave den Vorfall als einen Beweis für seinen Erfolg ansehen.
Während die Historiker in den Archiven von Cremona und Venedig nach Vorbildern und Hinweisen suchten, gingen die Wissenschaftler – viele von ihnen Catgut-Absolventen und direkt oder indirekt von Hutchins beeinflusst – in Labore wie das von Bissinger in North Carolina, wo sie sich Strads ausliehen, Stege schnitten, 3-D-Laserscanner einsetzten und Daten durchkämmten.377 Martin Schleske, ein Absolvent von Mittenwald mit anschließender jahrelanger |127| Laborerfahrung, behauptete, dass die Violine nicht nur eine Holz-, sondern auch eine Resonanzskulptur sei. Die Beweise dafür lieferte er mit einer Reihe von anspruchsvollen wissenschaftlich-technischen Veröffentlichungen und farbcodierten Computersimulationen, die die Ansprache eines Instruments und die auditive Wahrnehmung des Zuhörers maßen und darstellten.378
Stefan Greiner, obwohl selbst kein Physiker, hatte früh gelernt, wofür Wissenschaft gut war. Ein gemeinsames Interesse an der Geige und der Auftrag, an der Universität zu Köln eine Akustikklasse zu unterrichten, führte ihn zu Heinrich Dünnwald, Physiker von Beruf und Catgut-Veteran. 1997 begannen die beiden, im Tandem zu arbeiten, machten eine Jugendstil-Villa im grünen Süden Bonns zu einer gesuchten Adresse, und Greiner selbst wurde zum ersten Geigenbauer, der von einem praktizierenden Wissenschaftler beraten und von einer Künstleragentur vertreten wurde.379
Eine Autostunde von Detroit entfernt kopierten Curtin und Alf für einen Kunden aus Los Angeles eine Strad von 1728 mit Hilfe von Antihaft-Gummiformen, Epoxidharz-Gussteilen und einem Mitarbeiter, der bei General Motors gelernt hatte, wie man beides einsetzt. Von dort wandten sie sich 3-D-Laserscannern zu, die in der Lage waren, selbst diesen kaum wahrnehmbaren Kontakt mit ihrem Modell auf einen Lichtstrahl zu reduzieren.380
Curtin, ein Schützling von Erdesz und Hutchins, der voll der »Unruhe am Ende des Jahrtausends« war und es über hatte, sich trotz der neuen Technologien wie ein ewiger Teilnehmer an einem Bürgerkriegsspektakel zu fühlen, ging seinen eigenen Weg. Er orientierte sich an Gabriel Weinreich, einem pensionierten Physiker der University of Michigan, und an Charles Besnainou, einem in Ägypten geborenen Ingenieur am Laboratoire d’Acoustique Musicale in Paris. Weinreichs Beitrag war der reziproke Bogen, eine geniale Verbindung von Computer, Verstärker, Lautsprecher und Tonabnehmer, die die Beurteilung eines Instrumentes erlaubten, ohne dass dazu ein lebendiger und unweigerlich eigenwilliger Spieler nötig war.381 Diese Experimente von Besnainou brachten bei Versuchen mit Kohlefaser und Mischinstrumenten einen Durchbruch.
Curtin fragte sich, ob »das eine Richtung war, der ich mit meinem eigenen Geigenbau folgen könnte«. Für ihn lag die Antwort auf der Hand, und seine Augen glänzten noch stärker, als die John D. and Catherine MacArthur Foundation ihn zu einem der 25 »Genies« des Jahres kürte und 500.000 Dollar Fördermittel bewilligte, die er in den kommenden fünf Jahre nach eigenen Vorstellungen ausgeben konnte.382 Er war nicht der erste Geigenbauer, der zum Genie erklärt wurde, doch hatte es keiner jemals auf diese Höhen geschafft.
Bedeutete dies nun, dass die 400 Jahre alte Vorherrschaft der toten italienischen Männer ihrem Ende zuging und die Welt für lebende Geigenbauer jetzt wieder zu einem sicheren Ort wurde? Letztendlich konnte das niemand wirklich beantworten. Aber es gab nun Spielraum für Optimismus und durch |128| Verkäufe an große Orchestermusiker, an hochkarätige Ensembles wie das Alban Berg Quartett oder das Emerson Quartet und an Solisten wie Oliveira und Tetzlaff Anlass zu Hoffnung.
»Neue Instrumente sind immer zu meiden: Wenn sie einen guten Ton haben, ist fast sicher, dass er sich verschlechtern wird«, berichtete ein britisches Händlerhandbuch im Jahr 1834.383 Viele Spieler und Dirigenten teilten das Gefühl immer noch. Auf der Suche nach Dirigenten, die er befragen konnte, fand ein Autor unter sieben Dirigenten nur einen einzigen, der – selber Blechbläser – überhaupt bereit war, über dieses Thema zu sprechen.384 Alf schätzte, dass er bis zu 7,5 Prozent seines steuerpflichtigen Jahreseinkommens für Werbung und Verkaufsaktionen aufwenden musste, die nötig waren, um den trägen Ahnenkult eines Marktes zu überwinden, auf dem der Verkauf einer einzigen alten italienischen Geige mehr erbrachte, als Alf in einem Jahr mit neu gebauten verdiente.385
Doch gleichzeitig war derselbe Markt sein Verbündeter. Die Auftriebskraft, die den Rest des Marktes wie einen Schwanz hinter dem immer höher fliegenden Drachen aus Cremona herzog, ermöglichte es Alf und seinen Kollegen, aufstrebenden Berufsmusikern hochwertige und für ihre Karriere taugliche Instrumente für die Hälfte bis ein Drittel des Preises der bescheidensten alten italienischen anzubieten. Eine oder zwei Generationen früher konnte ein junger Geiger im New Yorker Orchester auf eine Wohnung in der Upper West Side von Manhattan und eine Gagliano-Geige hoffen, jetzt musste er sich für eines davon entscheiden. »Ich kann nicht in meiner Bratsche wohnen«, sagte ein junger Musiker, Besitzer von zwei Rabuts, zu ihrem Erbauer.386 Währungspolitische Schluckaufs wie der Kurssturz 1997 in Asien, der schlagartig die Kaufkraft der 92 jungen Südkoreaner im Baltimore Peabody Conservatory halbierte,387 waren für zeitgenössische Geigenbauer ein unerwarteter Bonus.
Die Alte-Musik-Szene war sowieso schon sehr im Fluss. Als ein Wachstumssektor des späten 20. Jahrhunderts innerhalb von »spätindustriellen« Institutionen des 19. Jahrhunderts brachte sie Arbeitsplätze hervor, Musiker und eine Nachfrage bis hin nach Tokio. Nach 200 Jahren der Modernisierung waren alte Instrumente, die es wert waren, gekauft zu werden, für die häufig jungen, enthusiastischen, aber meistens unterfinanzierten Spieler unerreichbar. Neue alte Instrumente hingegen waren sowohl erschwinglich als auch historisch exakter als alles, was man bisher kannte. Im Jahr 2004 spielten fünf von zehn Geigern und zwei von drei Cellisten im San Francisco Philharmonia Baroque Orchestra Barockinstrumente, die nach 1987 gebaut worden waren.388 Im gleichen Jahr gab die Londoner Becket Collection bei führenden zeitgenössischen Geigenbauern die Durchführung eines Vivaldi-Projekts mit dem Bau von neun venezianischen Violinen, zwei Bratschen, zwei Celli und einem Bass in Auftrag. »Wir möchten das Erlebnis eines Konzerts im Venedig des 18. Jahrhunderts für |129| Publikum und Spieler neu erschaffen«, sagte Elise Becket Smith, die Gründerin der Sammlung. »Es ist wichtig, dass die nächste Generation von Studenten historischer Aufführungspraxis auf geeigneten Instrumenten spielen kann.«389
Dass Geigenbauer wie Alexander Rabinowitsch in St. Petersburg auftauchten, um für ein Ensemble wie die Musica Petropolitana zu arbeiten, war an sich schon ein Glücksfall. Alte Musik kam in Westeuropa vor dem Ersten Weltkrieg selten genug zur Aufführung und war im zaristischen Russland so gut wie unbekannt. Doch während sie im Westen mit zunehmender Kompetenz und Leidenschaft verfolgt wurde,390 blieb sie in der Sowjetunion weiterhin eine Rarität. In einer Gesellschaft, in der die Ausübung von Musik ebenso politisiert wurde wie alles andere, war in den späten 1980er-Jahren ihre Entdeckung durch Rabinowitsch und eine Handvoll von Studenten des Konservatoriums in Leningrad lebendige Perestroika.
Rabinowitsch, Sohn eines Marineoffiziers mit einem Faible für praktische Erfindungen, hatte sich den Geigenbau vom Vater eines Klassenkameraden abgeschaut und machte mit Hilfe von allem, was er in Museen und Bibliotheken finden konnte, alleine weiter. Dennoch kamen privater Geigenbau oder Instrumentenhandel nicht in Frage, und er verwischte seine Spuren von 1962 bis zur Gorbatschow-Ära durch etwa 49 Anstellungen, unter anderem als Seenotretter und Reparateur von Holzblasinstrumenten. Nebenbei suchte er in baufälligen Gebäuden (an denen kein Mangel war) nach Holz. 1989 packte Rabinowitsch ein paar Instrumente ein, reiste nach London, ging in das Royal Opera House und schaffte es innerhalb weniger Tage, in der London Symphony einen Kunden zu finden. Dann kehrte er nach Hause zurück und suchte sich weitere Kunden. Dass er sich selber in das Strad Directory eintrug, sagt ebenfalls viel über die Zeit wie den Ort aus, doch vermied er eine genaue Ortsangabe, zum einen aus Angst, die Aufmerksamkeit von Steuerbeamten zu erregen, die vermutlich bis zu 105 Prozent seines Jahresumsatzes eingefordert hätten, zum anderen, um nicht die Aufmerksamkeit rücksichtsloser bewaffneter Räuber auf sich zu ziehen, die noch mehr verlangt hätten.391
Die postkommunistische Wandlung von Dmitri Badjarow war noch bemerkenswerter. Als Sohn eines Hornisten und einer pädagogisch begabten Mutter 1969 in Naltschik, einer Provinzhauptstadt am Nordrand des Kaukasus, geboren, stürzte er sich im Alter von sieben Jahren auf die Bearbeitung von Holz, traf mit acht Jahren auf einen begabten jüdischen Geigenlehrer und mit elf auf einen charismatischen Volkskundler. Der Geigenlehrer lotste ihn an das Leningrader Konservatorium, wo er Barockinstrumente entdeckte und sein Studium mit einem Diplom abschloss. Die Ermutigung des Volkskundlers, in Leningrad einen Geigenbauer zu suchen, der bereit war, ihn in dem Handwerk zu unterrichten, führte zu Badjarows erster Werkstatt. Dort machte er, wie alle um ihn herum, Geschäfte per Barzahlung, hielt einen großen dressierten Hund, installierte |130| eine kugelsichere Tür und elektronische Sicherheitssysteme und zeichnete alle eingehenden Anrufe auf, um sie nach Fremden zu durchforsten.392
Inzwischen schrieb man das Jahr 1994. Badjarows nächste Schritte waren ein Studium bei dem Barockgeiger Sigiswald Kuijken, der Erwerb eines zweiten Diploms und die Eröffnung einer weiteren Werkstatt, diesmal in Brüssel, einem viel einfacheren Ort für Geschäfte, wo er Instrumente für Kuijkens Petite Bande baute. Er heiratete eine Klassenkameradin, eine japanische Flötistin, spielte selber in Mito Arco, einem japanischen Quartett für Alte Musik, und machte seine Website zu einem weltweiten Forschungsseminar über Ikonografie, Stil und Geigenbau im Barock.
Zwölf Jahre später teilte er seiner Kundschaft über seine Website mit, dass er sich freue, nach Japan zu gehen, um an einer Geigenschule in Tokio zu unterrichten, sich um die Barock-Instrumente einer Firma in Nagoya zu kümmern und damit zumindest in den Genuss eines Klimas zu kommen, das ihn mehr an Cremona erinnerte als das in Brüssel.393 Doch als er 2011 nach Holland und in ein besseres Klima für Alte Musik zurückkehrte, eröffnete er ein Geschäft in Den Haag, zufällig an demselben Tag, an dem Japan von einem Super-Tsunami und einem Erdbeben heimgesucht wurde. Ja, er habe einen langen Weg zurückgelegt, bekannte Badjarow, und das war seinen Eltern durchaus recht, die vor 1992 bewusst unpolitisch und auch später skeptisch gewesen waren, was seine Chancen im postkommunistischen Russland anbelangte. »Was könnte man denn auch sonst glauben, wenn man nicht in der Partei war und in Naltschik lebte?«, fragte er.394
Im Vergleich dazu war der postkommunistische Wandel im Land der samtenen Revolution nicht mehr – aber auch nicht weniger – als eine Rückkehr zur Normalität. Die Werkstatt von Otakar Špidlen in Prag, die bereits in zweiter Generation in einer der großen Musik-Hauptstädte als erstes Haus am Platze galt, wurde nach dem Staatstreich 1948 von den Kommunisten enteignet und erst nach dem Zusammenbruch des Regimes im Jahr 1989 an Otakars Sohn Premsyl zurückgegeben. In der Zeit dazwischen aber hatte stets ein Hauch von Normalität vorgeherrscht. Freiberufliche Handwerker arbeiteten und vermarkteten ihre Produkte weiterhin für Devisen über die staatliche Exportagentur Artia, während Premsyl Preise gewann und als Juror bei Wettbewerben von Cremona bis Salt Lake City verpflichtet wurde, wo seine Gastgeber selbstverständlich seine Reisekosten zahlten. Ausnahmsweise wurde es sogar Premsyls Sohn Jan gestattet, in Mittenwald zu studieren. Es überrascht nicht, dass er unmittelbar nach den Ereignissen von 1989 Beares Geschäft in London ansteuerte.
Zu dieser Zeit gab es keinen tschechischen Markt im herkömmlichen Sinne mehr. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte sich die Tschechoslowakei einer Anzahl von etwa 500 Geigenbauern gerühmt. Ein halbes Jahrhundert später waren es schätzungsweise 30. Während des 40-jährigen kommunistischen |131| Interregnums reisten tschechische Geiger – ein weiteres Exportprodukt – nach Möglichkeit mit zwei Instrumenten aus und kehrten mit einem zurück. Diejenigen, die immer noch gute Instrumente hatten, verkauften sie nur ungern. Wer keine hatte, musste ohne sie auskommen, obwohl gute Instrumente des 19. Jahrhunderts zu einem Bruchteil der westlichen Preise zu haben waren. Doch nur wenige Jahre später hatten eine harte Währung und Fremdwährungskonten, ausländische Aufträge und eine deutliche Senkung der Exportsteuer Prag wieder zu einer mitteleuropäischen Stadt gemacht, in der Jan Špidlen, Geigenbauer in vierter Generation, mit seinem Vater wieder ein mitteleuropäisches Familienunternehmen betrieb.395
Kurz hinter der Grenze in Markneukirchen, wo eine Anzahl junger deutscher Geigenbauer ihre gemeinsame Vergangenheit wiederentdeckte, fassten die Erfahrungen von Udo Kretzschmann vor und nach 1989 praktisch die moderne Geschichte der Stadt zusammen. Zwischen 1716 und 1890 waren mindestens acht seiner direkten und zehn seiner indirekten Vorfahren Geigenbauer gewesen. Kretzschmann selbst, ein Kind des Ostdeutschlands der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, hätte gerne Mathematik an der Universität studiert. Aber die Bindung seiner Familie an die evangelische Kirche, hartnäckigste Gegnerin des Regimes, verstellte ihm diesen Weg.
Der Amateurgeiger versuchte stattdessen, sich als angehender Geigenbauer – genauer gesagt: als Geigenmonteur – an der Handelsschule einzuschreiben, mit dem Ziel, seinen Abschluss als Seiteneinstieg in die Hochschule zu nutzen. Es war dann der lange Marsch durch die vorgeschriebenen Kurse in Akustik, Ästhetik und Marxismus-Leninismus, der ihm deutlich machte, dass er wirklich Geigen bauen wollte. Diese Lösung war wieder einmal ein Produkt von Zeit und Ort. Wie Generationen vor ihm setzte er in der örtlichen Fabrik, die vor dem Fall der Berliner Mauer 1100 und 15 Jahre später weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigte, Geigen zusammen; nach der Arbeit ließ er sich bei einem der wenigen privaten Geigenbauer nebenberuflich ausbilden.
Gemeinsam mit dem ostdeutschen Geigenbauer-Verband fuhr er 1980 nach Moskau zu einem Besuch der sowjetischen Staatssammlung, die die Delegation 15 Minuten lang bewundern und prüfen durfte. Ein paar Jahre später wurde er staatlich geprüfter Geigenbauer, und nachdem er beschlossen hatte, dass er lieber in Akkordarbeit echte Instrumente bauen wollte, als bei der Montage von Instrumententeilen in der Fabrik mehr zu verdienen, durfte er sogar zu Hause arbeiten.
Dann kam das historische Jahr 1989. Kretzschmann verließ seine Familie und holte Jahrzehnte verlorener Zeit und Reisen nach, indem er sich in Werkstätten in West-Berlin, Hamburg und Basel als Ad-hoc-Geselle zur Verfügung stellte. Fünf Jahre später kehrte er zurück und eröffnete in einer Stadt mit 7500 Einwohnern seine eigene Werkstatt, umgeben von bis zu |132| 15 jüngeren Geigenbauern, die entschlossen waren, es genauso zu machen, darunter zwei unmittelbare Nachbarn.
Nach einem Jahrzehnt der Selbstständigkeit hatte er erworben, was im Postkommunismus lebensnotwendig war, unter anderem einen Computer, ein westliches Auto und Grundkenntnisse in Englisch. Seine Angebotspalette umfasste Geigen, Bratschen und Gamben, außerdem kümmerte er sich um Aufbau und Pflege einer zweisprachigen Website. Seine Arbeiten beinhalteten Reparaturen und Restaurierungen von Schulinstrumenten, Ausstellungen in einer Stadt, die für Touristen zunehmend attraktiv wurde, und gelegentliche Aufträge von Berufsmusikern und ambitionierten Amateuren, die auf Schnäppchen hofften.
Zwar träumte er davon, sich eine anspruchsvollere Kundschaft zu erschließen, doch waren gute italienische Modelle, wie sie den von ihm aus der Ferne bewunderten Hargrave, Dilworth, Zygmuntowicz und anderen zeitgenössischen Größen vertraut und verfügbar waren, in der sächsischen Kleinstadt schwer zu bekommen. Der immer länger werdende Schatten, den China warf,396 aber auch der lange Schatten der lokalen Geschichte, in der Markneukirchen überwiegend ein anderes Wort für billig war, machten die Sache nicht einfacher. Wenn sich jedoch die chinesische Qualität innerhalb einer Generation drastisch verbessern konnte, so dachte man, gab es keinen Grund, warum in Markneukirchen nicht das Gleiche gelingen sollte.
Vorerst produziert Markneukirchen wieder solide, unprätentiöse und erschwingliche Instrumente – wenn auch nicht länger zu DDR-Preisen, die immer sein Wettbewerbsvorteil gewesen waren.397 Kretzschmann konnte sich nicht vorstellen, jemals wieder etwas anderes zu machen, auch wenn die neuen Geigenbauer nun ihre Erzeugnisse selbst vermarkten mussten. In einer witzigen Abwandlung des Satzes aus dem Römerbrief (12, 12) beschrieb er sich selbst als »fröhlich in der Hoffnung auf Kunden, geduldig mit der Konkurrenz, beharrlich an der Werkbank«.398