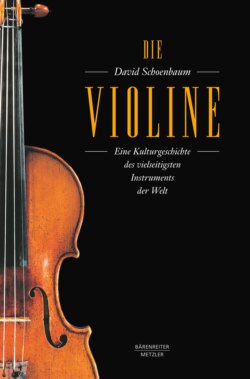Читать книгу Die Violine - David Schoenbaum - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Goldene Zeitalter
ОглавлениеDie besondere Beziehung begann, wie so oft, mit der Geografie. Europa verzehrte sich nach Seide und Gewürzen, Italien führte Nachfrage und Angebot zusammen. Die kaufmännische Rolle wiederum verwandelte einen geradezu prädestinierten Umschlagplatz in einen eigenständigen Produzenten, der erstaunlicherweise sogar imstande war, seine Mängel in einen positiven Kreislauf zu bringen. Gerade während Italiens Herzogtümer, Stadtrepubliken und kleine Fürstentümer sich unauflösbar in die kämpferischen Ansprüche und Wünsche der römischen Päpste und deutschen Kaiser verstrickten, definierten die florierenden Städte der Halbinsel ihre Weltgewandtheit neu, erfanden die Diplomatie, trugen zu Umwälzungen in der Kriegskunst bei und gestalteten die zwischenstaatlichen Beziehungen um.78 Menschen aus aller Herren Länder kamen, um zu beten, zu kämpfen, zu plündern, zu lernen, zu kaufen, zu verkaufen und den einheimischen Einfallsreichtum – von der Decke der Sixtinischen Kapelle bis hin zur Einführung der Gabel – in jeder Form zu bestaunen und auf diese Weise einen Blick in die Zukunft und gleichzeitig in die Vergangenheit zu werfen.79
Die Italiener begriffen bald, dass das Jahr 1492 – jenes Jahr, in dem Columbus eine neue Erdhälfte entdeckte, der gebürtige Spanier Rodrigo Borgia zum Papst in Rom gewählt wurde, Fernando von Aragon und Isabella von Kastilien in ihrer gemeinsamen Rolle als König und Königin von Spanien das Emirat Granada eroberten und Lorenzo Medici, auch Lorenzo der Prächtige genannt, in Florenz starb – auch für sie ein Wendepunkt war. Es dauerte allerdings eine Weile, bis diese Erkenntnis durchgesickert war. In der Zeitspanne, die sich vom 12. bis zum 16. Jahrhundert erstreckte und die die venezianischen Honoratioren doppelt so reich werden ließ wie ihre Kollegen in Amsterdam, führte eine kommerzialisierte Geldwirtschaft zu Kapitalbildung, realem Wachstum und frei verfügbarem Einkommen. Selbst die als »Condottieri« bekannten Söldner stellten sich als wirtschaftliche Multiplikatoren heraus, da sie mit Hilfe der dynamischen kleinen Höfe, von denen sie vertraglich für den Militärdienst verpflichtet wurden, kleinen Städten wie Urbino, Mantua und Ferrara zu Wohlstand verhalfen. Ebenso zahlten sich Handel, Fertigung, Bankwesen, Steuerpacht, Verkauf von Adelstiteln und Kirchenämtern, die Kriege anderer sowie der Landbesitz aus, Letzterer erst recht ab Mitte des 17. Jahrhunderts, als die norditalienische Fertigungs- und Dienstleistungswirtschaft in eine Abwärtsspirale geriet, die 200 Jahre |37| andauern sollte.80 Im Gegensatz zu vielen anderen Gegenden zogen es dortige Gutsbesitzer immer noch vor, in der Stadt zu leben, was dazu führte, dass ihr ländlicher Reichtum weiterhin in städtischen Händen verblieb.
Unterdessen wirkte der Krieg selbst wie ein Friedensbonus, zumal die Unterhaltungskosten von Söldnertruppen eine eher vorsichtige Kriegsführung ratsam erscheinen ließen.81 Richard Goldthwaite, ein Experte für diese Periode, zeigt auf, wie spanische und päpstliche Truppen in der Lombardei eine militärische Infrastruktur aufbauten, was schon ein Gewinn war. Außerdem zahlten sie in Silber aus der Neuen Welt, ein zweiter Gewinn, und sie hielten den Bereich vergleichsweise stabil, indem sie andere Mächte aus Norditalien fernhielten – ein dritter Gewinn, nicht zuletzt in einer Zeit, in der Italiens Nachbarn nördlich der Alpen auf dem Weg in mehr als ein Jahrhundert religiöser Bürgerkriege waren.82
Am bemerkenswertesten jedoch war vielleicht, dass die Spanier sowie die Päpstlichen auch die Kosten für die Erhaltung und Verteidigung ihrer italienischen Protektorate trugen. In vielen Orten, darunter Brescia und Cremona, ging das Wirtschaftsleben im 16. Jahrhundert so weiter, als ob die neuen Herren gar nicht da wären, und das venezianische Establishment zahlte weniger Steuern, als es mit Darlehen verdiente. Zu anderen Zeiten und in anderen Ländern legte selbst der städtische Mittelstand sein Geld in Kapitalinvestitionen, Industrieentwicklung oder ausländischen Spekulationsgeschäften an. Doch dies setzte eine investorenfreundliche bürgerliche Ordnung, Massenproduktion, politischen Willen, bürokratische Initiative und technologische Raffinesse voraus – alles Dinge, die außerhalb der italienischen Möglichkeiten lagen. Stattdessen investierten wohlhabende Italiener in allerlei öffentliche oder private Kunst ebenso wie in schöne, gut gemachte und haltbare Dinge für den Hausgebrauch. Diese gehörten dann zur Mitgift der Tochter, wurden deren Kindern hinterlassen und schließlich an die Kindeskinder weitergegeben. Nutznießer waren Künstler und Handwerker, die Kirche und der Wohnungsbau. Ebenso wie der Ruhm der vielen Künste und Kunsthandwerke, in denen die Italiener brillierten, war der italienische Geigenbau in hohem Maße eine Antwort auf die Nachfrage einer Gesellschaft, in der ererbter Reichtum und verfügbares Einkommen auf beschränkte Investitionsmöglichkeiten trafen.
Die Einzigartigkeit von Brescia und mehr noch von Cremona, den lombardischen Städten, in denen die neue Geige vermutlich zuerst erblühte, hatte ihren Ursprung in der Einmaligkeit Italiens, doch war dies allenfalls der Ausgangspunkt. Hinzu kamen ihre geografische Lage zwischen den Alpen und der Po-Ebene und Ahorn und Fichte, die von den meisten Geigenbauern damals wie heute bevorzugten Grundmaterialien, die in beiden Städten leicht verfügbar waren.83 Beide Städte hatten Zugang zu Wasserstraßen, was in einer Zeit, in der es 20 Mal mehr kosten konnte, eine bestimmte Last auf dem Land- statt auf dem Wasserwege zu transportieren, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil |38| war.84 Obwohl Brescias Fluss, die Mella, heute als schiffbares Gewässer nur noch schwer vorstellbar ist, floss sie damals mit voller Kraft von den Alpen nach Süden. Cremona hatte den Po, Italiens Gegenstück zum Rhein oder dem Mississippi, der alle Punkte zwischen Turin und der Adria verband. Genauso wie Füssen war jede der beiden Städte ein natürliches Abfahrtsziel auf der Autobahn der Frühmoderne, die das reiche Süddeutschland mit dem reichen Norditalien verband. Ein Blick auf die Landkarte bestätigt, wo sich die Handelsachsen zu diesem historischen Zeitpunkt kreuzten, an dem Füssen Instrumente und Geigenbauer nach Norditalien schickte und Venedig den Lauf der Musikgeschichte änderte, während es sich selber zur »unangefochtenen Hauptstadt der Instrumentalmusik«85 machte.
Die Geschichte folgte der Geografie. Zwischen dem 5. und 15. Jahrhundert erhoben nacheinander Attila der Hunne, Karl der Große, Kaiser Friedrich II., Heinrich VII. und die nahegelegenen Städte Verona und Mailand Anspruch auf Brescia, bis Filippo Visconti, der Vicomte von Mailand, es schlussendlich 1426 an Venedig verkaufte. Außer einer relativ kurzen französischen Präsenz zwischen 1512 und 1520 blieb die Stadt venezianisch, bis unter Napoleon erneut französische Truppen auftauchten. Die Einheimischen konnten sich zumindest damit trösten, dass ein Ort, der für andere so attraktiv ist, einige Dinge richtig gemacht haben musste – und dazu gehörte auch sein Musikleben. Im Jahr 1500 gab es in Brescia 14 identifizierbare Erbauer von Saiteninstrumenten, darunter mindestens einen Lieferanten an Isabellas Hof in Mantua. Die Instrumente wiederum waren Teil einer größeren Musikszene, zu der Hersteller von Blas-, Tasten- und Saiteninstrumenten gehörten, und die Spieler wurden so ernst genommen, dass die Aufzeichnungen des Stadtrats im Jahr 1508 eine Prüfungskommission erwähnen, die eingerichtet wurde, um deren Professionalität bescheinigen zu können.86
Der französische Überfall im Jahr 1512 verursachte Schäden, von denen sich die Stadt nie wieder erholte.87 Der Instrumentenbau allerdings ging aus der Katastrophe offenbar mit einem raketenhaften Aufstieg hervor. Innerhalb einer halben Generation nach dem, was Lady Huggins als »eine schreckliche Belagerung und Plünderung« bezeichnete,88 stellten die Geigenbauer in Brescia wieder Instrumente her, die für einen lokalen Schriftsteller von der Natur und nicht von menschlicher Hand geschaffen zu sein schienen.89 Im Jahr 1527 gründete Zanetto Micheli ein Unternehmen, das sich über drei Generationen erstreckte und etwa 80 Jahre bestehen sollte. Etwas mehr als eine Generation später war Gasparo Bertolotti (1540–1609), ein Geigenbauer von Weltklasse und nach seiner Geburtsstadt als »da Salò« bekannt, auf der lokalen Bildfläche erschienen. Er war der Sohn und ein Neffe von Geigenbauern und reichte die Fackel an Giovanni Paolo Maggini (1580–ca. 1631), einen zweiten Geigenbauer von Weltklasse, der sogar noch besser war als er selber, weiter.
|39| Im Jahr 1561 war Brescia eine Stadt mit über 41 000 Einwohnern90 – Florenz hatte in dieser Zeit geschätzte 59 000 und Bologna 72 000 Einwohner –, in der aus jeder Kirche und jedem Kloster Musik zu hören war, Kirchen sich Orchester hielten und das Verhältnis zwischen Instrumentenbauern, Musikern und Komponisten manchmal so eng war wie das zwischen Vater und Sohn.91 Unterdessen gab es bei der Begrifflichkeit eine aufschlussreiche Entwicklung: Mitte des 16. Jahrhunderts hatte sich für Saiteninstrumente, die mit einem Bogen gestrichen wurden, generell die Bezeichnung »Violino« durchgesetzt. Zwischen 1578 und 1600 wurde speziell Bertolotti mit Violinen in Verbindung gebracht, obwohl er auch Bratschen und Kontrabässe baute, die noch Jahrhunderte später sehr geschätzt wurden.92
In vielerlei Hinsicht war Paolo Maggini das Vorbild für einen Meister des frühen 17. Jahrhunderts. Magginis Vater war bei der Geburt seines Sohnes 62 Jahre alt und mit seiner Familie nach Brescia gezogen, weil ein älterer Sohn dort eine Schuhmacherwerkstatt eröffnete. Er blieb dort, bis Paolo in der Mitte seines zweiten Lebensjahrzehnts seine erste Geigenbauwerkstatt gründete. Ein Jahrzehnt später heiratete Paolo die Tochter eines Kürschners. Er zeugte zehn Kinder, von denen ihn nur vier überlebten. Seine Steuerbescheide für 1617 bis 1626 bezeugen nicht nur komfortable Erträge aus der Mitgift seiner Frau und aus Immobilien seines Vaters, sondern vor allem ein florierendes Geschäft mit Holz, Saiten und Instrumenten. Die Einkünfte ernährten nicht nur eine wachsende Familie und einen zweiten akkreditierten Meister als Vollzeitkraft, sondern ermöglichten auch Anschaffung und Unterhalt eines zweiten Hauses mit Werkstatt sowie von drei Bauernhöfen, und es blieb immer noch genug Geld übrig, um es zu einem Zins von 5 Prozent zu verleihen.93 Dann schlug für Brescia das Schicksal erneut zu. Zwischen 1628 und 1630 suchten Krieg, Hunger und schließlich die Pest Norditalien heim, was nicht nur Maggini, sondern auch den Instrumentenhandel von Brescia das Leben kostete. Es vergingen mehr als 40 Jahre, bevor Giovanni Battista Rogeri – aus Cremona zugezogen – erneut eine Werkstatt in Brescia eröffnete, die von seinem Sohn weitergeführt wurde. Inzwischen war der historische Augenblick der Stadt vorüber. Maggini hinterließ einen sechsjährigen Sohn als Erben. Cremona büßte durch die Pest schätzungsweise zwei Drittel der Bevölkerung ein,94 darunter Girolamo Amati, Andreas Sohn, zwei Amati-Töchter, einen Amati-Schwiegersohn und Girolamos Frau. Doch Nicolò (geboren 1596), jüngster der drei Söhne Girolamos und das neunte von zwölf Kindern, überlebte, wenn auch nur knapp. Sein Überleben wurde zum alles entscheidenden Ereignis.
Galileo Galilei, Wissenschaftler und selbst Sohn eines Musikers, trat einige Jahre nach Magginis Tod an einen venezianischen Freund mit der Bitte heran, sich bei einem Berufsmusiker zu erkundigen, wo man für seinen Neffen, der ein Mitglied des Orchesters am Hofe des Kurfürsten von Bayern war, eine |40| Violine aus Brescia finden könne. Der Freund wandte sich an den Komponisten Claudio Monteverdi, einen geborenen Cremoneser mit 50 Jahren Berufserfahrung, selber Spieler von Saiteninstrumenten und ein Vorreiter in der Orchestrierung. Monteverdi offenbarte ihm, dass Geigen aus Brescia zwar einfach zu bekommen wären und nur ein Drittel des Preises der Violinen aus Cremona kosteten, die Cremoneser aber unvergleichlich besser seien. Er bot an, sich der Sache persönlich anzunehmen.95 Am Ende bekam Galilei für 15 Dukaten, Verpackung und Versand nicht inbegriffen, ein Instrument aus Cremona – ein »außerordentlich gelungenes«, wie ihm versichert wurde. Monteverdis Einschätzung einer Überlegenheit der Instrumente aus Cremona wurde bald im Berufsstand selbst und in ganz Italien für bare Münze genommen.
Ebenso wie in Brescia waren auch Lage und Standort von Cremona attraktiv und gefährlich zugleich. Außerhalb der Stadttore stürzte zuweilen der Hochwasser führende Po von den Alpen bis zur Adria hinab. Eine dortige Pontonbrücke verband Europas Norden mit Europas Süden. Doch eine so günstige Lage hatte ihren Preis. Die Stadt wurde im Zuge der Entstehungsgeschichte des römischen Reiches immer wieder durch einfallende Goten und Hunnen dem Erdboden gleichgemacht, und im sogenannten Hochmittelalter machte ihre Attraktivität sie für aufeinanderfolgende Hohenstaufenkaiser zu einem Spielball im endlosen Krieg zwischen Guelfen und Ghibellinen. Während Italiens interne Auseinandersetzungen zu europäischen Stellvertreterkriegen führten, wurde Cremona zu einem Dreh- und Angelpunkt zwischen den drei großen Mächten der neuen Zeit: Spanien, Österreich und Frankreich.
Die Gunst des Kaisers war ein weiteres zweifelhaftes Geschenk. Zwischen 1499 und 1535, einer für die Entwicklungsgeschichte der Violine wichtigen Zeit, wechselte die Stadt dreimal die Besitzer, und erst nach 65 Jahre währenden und für die Stadt verheerenden französisch-spanischen Auseinandersetzungen machte 1559 der Vertrag von Cateau-Cambrésis Cremona zu einem kulturellen Zentrum des spanisch dominierten Norditaliens.96 Die spanische Vorherrschaft dauerte bis an die Schwelle des 18. Jahrhunderts – ein Zeitraum, der praktisch die gesamte Blüteperiode des klassischen Cremoneser Geigenbaus umschließt. Die für die Barockzeit typische Politik einer dynastischen Vorherrschaft nutzte dann den Tod eines kinderlosen Monarchen für einen Krieg um die spanische Erbfolge. Dieses Mal fand sich Cremona zwischen den Fronten Frankreichs, dessen König Louis XIV. die Stadt 1701 beschlagnahmte, und des kaiserlichen Österreichs wieder, das auf die Stadt 1706 de facto und 1713 de jure Anspruch erhob. 20 Jahre später kehrten die Franzosen mit Kriegsoperationen, die mit den Auseinandersetzungen um die polnische Erbfolge zusammenhingen, zurück. Im Gegensatz zu ihren napoleonischen Enkeln ungefähr 60 Jahre später waren ihre politischen Forderungen bescheiden. Cremona jedoch war im Vergleich mit dem, was es vor 150 Jahren gewesen war, um die Hälfte geschrumpft |41| und nun eine Stadt mit 20 000 Einwohnern, deren lokale Ressourcen durch eine Garnison von 12 000 Soldaten – einem Fünftel der gesamten französischen Expeditionstruppen – zwangsläufig schwer belastet waren und in der die Preise deshalb sprunghaft anstiegen.97
Tatsächlich war die Stadt wohl für Gesetz und Ordnung der spanischen Herrschaft dankbar. Belagerung, Überschwemmungen, Hungersnot und Pest zum Trotz gedieh Cremonas Wirtschaft bis mindestens Mitte des 17. Jahrhunderts weiter. Die neuen Herren waren den bestehenden städtischen Einrichtungen gegenüber tolerant, denn sie waren bis zu einem gewissen Grade auf sie angewiesen.98 Einheimische Unternehmer kauften Wolle und Baumwolle, die einheimische Webereien zu Textilien verarbeiteten und einheimische Händler exportierten. Einheimische Holzschnitzer, Tischler, Schreiner und Zimmerleute stellten aus den Materialien, die von den Alpen und der Adria kamen, Möbel und das beeindruckende Chorgestühl der örtlichen Kathedrale99 her und lackierten sie dann mit dem, was Simone Sacconi für den gleichen Lack hielt, der später bei Amati-Geigen verwendet wurde.100
Wie überall in der Umgebung hatte Musik hier einen hohen Stellenwert. Organisierte Veranstaltungen in der örtlichen Kathedrale gingen zurück bis ins Jahr 1247. Spätestens seit 1427 stellte die Stadt Bläser – darunter auch Dudelsackspieler – nicht nur an, sie rekrutierte sie regelrecht wie Fußballspieler. Wie überall dort, wo Kunst und Handwerk zusammenlebten, erblühte und wuchs auch hier eine Kultur der Streicher und Instrumentenbauer. Galeazzo Sireni lernte von seinem Vater, wie man Kutschen und Sänften herstellte, brachte sich selber den Instrumentenbau bei und schrieb vierstimmige Lieder.101 Das Eintreffen venezianischer Juden trug zweifellos zu dieser Melange in einer Stadt bei, die mit Fachleuten in der Holzverarbeitung, musikliebenden Bürgern und einer bereits vorhandenen Gemeinschaft jüdischer Musik- und Tanzlehrer, Textilkaufleuten, Trödelhändlern, Geldverleihern, Druckern, Buchhändlern und Juwelieren bevölkert war,102 deren Vorgeschichte bis ins 13. Jahrhundert zurückreichte.
Es brauchte fast 400 Jahre und eine zufällige Entdeckung von Carlo Bonetti, um aufzuzeigen, wie diese Teile zusammengepasst haben könnten. Im Jahr 1526, in dem sich Cremona erneut Verwüstung und Plünderung ausgesetzt sah, reagierten städtische Beamte mit einer zügigen Erhebung der für den Wehrdienst verfügbaren Männer. Die dafür durchgeführte Zählung der Handwerker verzeichnet in der Nähe von Maggio Porta Perusia einen Io Giovanni Liunardo da Martinengo, 50 Jahre alt, sowie dessen Mitbewohner Andrea und Io Antonio, deren Familiennamen nicht verzeichnet sind. Martinengo wird als Lautenmacher und »Pater«, Andrea und Giovanni Antonio werden als »famey« bezeichnet.103 Da »Pater« im lokalen Dialekt sowohl einen Schrotthändler – ein typisch jüdisches Metier – als auch einen Handwerksmeister bezeichnete, der in der Rolle eines Vormunds für seine Lehrlinge agiert, hat Martinengos |42| Arbeitsplatzbeschreibung moderne Forscher verwirrt und die Frage aufgeworfen, wie ein so ungleiches Berufspaar unter einem Dach nebeneinander leben konnte. »Famey« wiederum weist auf ein Familienmitglied oder einen Angehörigen hin. Doch die jungen Männer scheinen Söhne des Meisters Gottardo Amati gewesen zu sein. Auch die Frage, worin Gottardo Meister war, ist unbeantwortet.104 So oder so: Vieles scheint für »Pater« im Sinne von »Vormund« zu sprechen. Als assimilierter Sohn von Moise, einem der zugewanderten venezianischen Bankiers von 1499, kann Martinengo durchaus einen Familienbetrieb unterhalten haben, der Versteigerungen durch die Polizei ebenso einschloss wie Geldverleih. Als einziger Lautenmacher in einer vorindustriellen Stadt mit strenger Zunftordnung beschäftigte er Lehrlinge, die dadurch zu Unterhaltsberechtigten wurden.
Die Informationen über Andreas Herkunft, Ausbildung und berufliche Ahnentafel sind dürftig, reichen aber aus, um ihn »wahrscheinlich zu dem ersten, sicherlich dem ersten bekannten und wohl dem wichtigsten Cremoneser Geigenbauer« werden zu lassen, wie Hargrave anmerkt.105 Reste notarieller Urkunden106 und eine breite Streuung von Instrumenten – viele von ihnen stark verändert – lassen vermuten, dass er zwischen seiner Erwähnung im Militärzensus von 1526 und der Anmietung eines Hauses mit angeschlossener Werkstatt im Jahr 1538 als Ehemann, Vater und Meister endgültig sesshaft wurde. Als er 1577 starb, war er längst zu einem Vorbild und Stammvater geworden. Seine anerkannte Meisterschaft im Erwachsenenalter fiel mit Cremonas Rückkehr zu einer spanischen Verwaltung zusammen, die durch königliche Besuche in den Jahren 1541 und 1549 unterstrichen wurde. Als Folge dieser Besuche kam es zu zahlreichen Neubauten und -gründungen von Kirchen und Klöstern, zu einem Boom in den ornamentalen und musikalischen Künsten und damit zu einer vielversprechenden Zukunftsperspektive für das, was Denis Stevens die »gepflegte Vier-Zylinder-Maschine mit mehr Pferdestärken und sehr niedrigem Kolophoniumverbrauch«107 nannte und das zur nachhaltigsten Leistung und dem Erbe der Amati-Familie werden sollte.
Der Wirtschaftshistoriker Carlo Cipolla, dem der Ausgang dieser Geschichte bekannt war, sollte später zu Recht Exportabhängigkeit, nicht wettbewerbsfähige Preise und strukturelle Engpässe als die Ursachen des Niedergangs identifizieren.108 Aus der Perspektive der Wall Street von heute gesehen, hätte die Verbindung von der Vitalität italienischer Bürger mit spanischer Macht und Marktanteilen allerdings ebenso gut erfolgreich sein können. Die Kombination von ständischer Ordnung, Handwerkskunst und Familienunternehmen war für den Hersteller eine Stütze und stellte auch die Qualitätskontrolle für den Verbraucher sicher. Geld spielte für den anspruchsvollen Kundenkreis, der ein Instrument von Amati erwarb, keine Rolle, und die quasi globale Musikkultur, in deren Zentrum Italien stand, machte auch die Nachfrage potenziell global. Die Pax Hispanica verband Cremona nicht nur mit dem |43| mächtigsten Hof der Welt mit Niederlassungen von Brüssel bis nach Peru, sondern auch mit dem römischen Papsttum, Zentrale eines anderen globalen Unternehmens. Nach Jahrzehnten der Verwüstung durch streitende Armeen hätte es für viele, und besonders für die städtischen Einrichtungen, wirklich schlimmer kommen können.109
Im Jahr 1576 registrierten Volkszähler einen Zuwachs der Einwohnerschaft auf 36 000 Menschen mit mehr als 50 Pfarreien, davon fünf mit Verbindungen zu Instrumentalisten, 40 Lehrern einschließlich Musik- und Tanzlehrern und einem Instrumentenbauer. 1583 waren Spieler von Saiteninstrumenten an den geistlichen Konzerten der Kathedrale beteiligt.110 Andrea war gestorben, doch seine drei Töchter waren bestens versorgt und zwei Söhne bereit, dort weiterzumachen, wo er aufgehört hatte. In einem Schreiben von 1628 empfahl der Komponist Heinrich Schütz seinem Dienstherrn, dem Kurfürsten von Sachsen, den Kauf von zwei Violinen und drei Violen, wahrscheinlich von Andreas Sohn Girolamo – wobei er nicht versäumte, darauf hinzuweisen, dass »derogleichen instrumenta, wann itziger alte meister abgehen möchte, an keinem ort in solcher bonitet zu bekommen sein werden.«111
Eigentlich kam die Familie gerade erst in Schwung. Andreas Enkel und Urenkel sollten ebenfalls herausragende Geigenbauer werden. Weitere 500 Jahre später bereiten ihre Instrumente sowohl ihren Spielern als auch Zuhörern, Geigenbauern, Museumsbesuchern und erst recht dem Handel immer noch größte Freude. Und noch immer steigen die Preise unaufhörlich, während die Händler sich bemühen, aus einem Haufen verwirrender Archivalien herauszufinden, von wem ein bestimmtes Instrument stammt.
Girolamo und sein älterer Bruder Antonio, der Nachwelt als die Gebrüder Amati bekannt, könnten durchaus Halbbrüder mit einem Altersunterschied von 21 Jahren gewesen sein. Ihre Wege trennten sich 1588, elf Jahre nach dem Tod ihres Vaters. Wie so vieles in der Familiengeschichte bleibt die Ursache dieser Trennung ein Geheimnis, doch eine in lückenhaftem Latein verfasste Abmachung ist Gegenstand eines erhaltenen Aktendokumentes. Der Notar legte geschickt fest, dass der eine der Brüder die in Frage stehenden Sachwerte an einem bestimmten Donnerstag aufzuteilen hatte, am Freitag dann sollte der andere Bruder erscheinen und seinen Anteil auswählen. So musste Antonio am Ende den Anspruch seines Bruders auf die Hälfte des Hauses in der Nachbarschaft anerkennen, in dem Familie und Werkstatt untergebracht waren. Werkzeuge und Muster wurden unter ihnen aufgeteilt, was ein Hinweis darauf ist, dass beide die Absicht hatten, weiterhin Instrumente zu bauen. Dass für Zuwiderhandlungen finanzielle Sanktionen festgesetzt wurden, deutet auf Unmut und Missstimmung. Von diesem Zeitpunkt an scheinen die Brüder nicht mehr zusammengearbeitet zu haben, doch die gemeinsame Marke bestand bis zum Tod Girolamos im Jahr 1630.
|44| Ob einzeln oder als Gespann: Die Gebrüder Amati hinterließen eine umfangreiche Sammlung von Instrumenten aller Art und Größen, deren Verarbeitung bis in das 18. Jahrhundert hinein renommierte und weniger renommierte Nachahmer inspirierte und bis heute Erstaunen und Bewunderung erregt. Doch die bei wachsendem Sachverstand und eskalierenden Preisen immer dringlicher werdende Frage war, wer was gebaut hatte. Ein wesentlicher Anhaltspunkt lag schon lange vor, doch die Informationen, die er bot, wurden erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts und dann auch nur schrittweise entdeckt. Es handelt sich dabei um die »Stati d’anime«, ein 1563 durch das Konzil von Trient in Auftrag gegebenes Familienregister. Am Ostermontag jeden Jahres ging der Pfarrer von Tür zu Tür, um seine Gemeindemitglieder zu zählen und zu registrieren. Diese Praxis setzte sich bis in die napoleonische Zeit fort.
Die Eintragungen waren nicht einheitlich. Zusätzlich verkompliziert wurden die Dinge durch die sogenannte Isola, die dicht besiedelte Nachbarschaft, in der seit Jahrhunderten Holzarbeiter112 in großer Zahl zusammenlebten und die in drei Gemeinden unterteilt war. Die erhaltenen Dokumente für San Matteo, die Gemeinde der Familie Stradivari, sind für ihre Unvollständigkeit bekannt, für San Faustino aber, die Pfarrei der Amati, sind sie beeindruckend umfangreich – trotz fehlender Daten für die entscheidenden Jahre nach der Pest (1630 bis 1641) und für 1670 bis 1679, in die die letzten Lebensjahre Nicolòs fallen. Es dauerte allerdings noch weitere 300 Jahre und erforderte viel Geduld, Einfallsreichtum und Energie, bis Kass, der zu der Zeit bei William Moennig & Son in Philadelphia tätig war, und der Mailänder Geigenbauer und Forscher Carlo Chiesa zeigen konnten, was mit all dem anzufangen war.
Das Ergebnis ist sowohl das Porträt eines Milieus als auch das einer Familie. Im Zentrum steht eine Reihe von 17 Häusern auf beiden Seiten der Straße, in der die Amatis, Stradivaris, Guarneris, Bergonzis, Rugeris, Storionis und Cerutis Tür an Tür lebten. In der Mitte der Häuserzeile steht die von Nicolòs Großvater und Vater geerbte Casa Amati mit mehreren Nebengebäuden, einer Werkstatt und einem Innenhof.113 Um sie herum lebten Nachbarn, deren Namen sowohl in der gemeinsamen Geschichte als auch in der Stadtgeschichte als Vermieter und Mieter, als Zeugen bei Trauungen und in Rechtsangelegenheiten, als Paten und angeheiratete Verwandte, als Kollegen im Instrumentenbau, Musiker und Besitzer eines Volkstheaters immer wieder auftauchen. Dann kommen die Kernfamilie, Verwandte, Lehrlinge, Knechte und Tagelöhner. Über einen Zeitraum von 40 Jahren stieg die Anzahl der Bewohner der Casa Amati von fünf auf bis zu elf Personen an.
Dabei steht Nicolò, Familienoberhaupt der dritten Generation, der den Familienbesitz nach einer Zeit voller Katastrophen wiederhergestellt und umsichtig in Immobilien investiert hatte, an vorderster Front, gefolgt von einer älteren Halbschwester – vielleicht eine verwitwete Überlebende der Pest –, mit |45| nachfolgenden Generationen aus ihrer eigenen Familie. Da ist Lucrezia Pagliari, die 26-jährige, die Nicolò mit 48 Jahren heiratete. Hinzu kommen neun Kinder, von denen sechs das Erwachsenenalter erreichten. Der Erstgeborene, Girolamo, starb mit drei Jahren; ein Jahr nach seinem Tod wurde ein weiterer Girolamo geboren, der Einzige, der in das Geschäft eintrat. Bekannt als Hieronymus II. starb er ohne männliche Erben im Alter von 91 Jahren. In einer Stadt, in der im frühen 17. Jahrhundert Priester, Mönche und Nonnen erstaunliche 10 Prozent der Bevölkerung ausmachten, traten drei der fünf Geschwister – genauso wie unzählige ihrer Altersgenossen aus den Familien Bergonzi und Stradivari – in einen religiösen Orden ein.
Zwei oder drei Diener, zum Teil nicht älter als zehn Jahre, standen der Familie zur Seite, daneben Tagelöhner, die vermutlich angeworben wurden, um einfaches, aber notwendiges Zubehör wie Wirbel, Griffbretter, Stege, Bassbalken und sogar Schnecken herzustellen,114 sowie Lehrlinge von außerhalb der Familie. Über einen Zeitraum von 40 Jahren scheinen es bis zu 17 Auszubildende gewesen zu sein, die meist aus anderen Zentren des Instrumentenbaus wie Padua, Bologna, Mailand und Venedig kamen. Diejenigen, denen es möglich war, eröffneten später eine eigene Werkstatt, führten den Amati-Stil und sein Modell in anderen Städten ein und machten ihn so zu einem Weltstandard.
Drei Lehrlinge waren herausragend. Der erste von ihnen, Andrea Guarneri, eröffnete um 1650115 die zweite Werkstatt in Cremona und begründete eine eigene Drei-Generationen-Dynastie. Ein zweiter, Giacomo Railich, wurde nach Cremona geschickt, um zum Nutzen eines angesehenen Familienunternehmens von Lautenmachern, das seinen Standort im Laufe der Zeit von Füssen nach Neapel, Padua, Brescia und Venedig verlegte,116 neue Fertigkeiten im Geigenbau zu erlernen. Der vielversprechendste Lehrling aber hieß Antonio Stradivari – wenn er denn einer war: Seine frühen Instrumente zeigen zwar den Einfluss von Amati, doch der Amati-Stil hinterließ seine Prägung bei jedem. In der Volkszählung vom Ostermontag taucht Stradivari nicht auf. Da er jedoch aus einer lokalen Familie stammte, musste er nicht im Haus des Meisters wohnen. Außerdem gab es in Cremona neben San Faustino unzählige andere Gemeinden.
Biografen aus dem 19. Jahrhundert sowie Kollegen der Gebrüder Hill berichteten, dass Stradivari ein Amati-Lehrling gewesen sei, doch die Hills fanden keine Beweise dafür. Eine frühe Stradivari mit einem Zettel, der den Geigenbauer als Amati-Lehrling auswies, gab verständlicherweise Grund zu jubeln; doch auf einem ein Jahr später geschriebenen Zettel wird Amati nicht erwähnt, und weitere wurden nie gefunden.117 Doch ist es wirklich vorstellbar, dass der größte Geigenbauer aller Zeiten Autodidakt war und als solcher eine Werkstatt innerhalb einer Zunft eröffnen konnte, die so hierarchisch war wie die Kirche? An wen hätte er sich angesichts der Möglichkeiten, die Cremona bot, gewandt, wenn nicht an die Werkstatt von Amati?
|46| Stradivaris späteres Leben ist kaum weniger geheimnisvoll und kann auf vier bekannte Fakten reduziert werden. Er hatte ein langes und produktives Leben. Er baute für eine anspruchsvolle Kundschaft eine beeindruckende Anzahl außergewöhnlicher Instrumente. Er hinterließ eine große Familie und einen erheblichen Nachlass. Er konnte lesen und schreiben, was zu dieser Zeit nicht selbstverständlich war. Alles andere ist reine Spekulation.
Abgesehen von der offenkundigen Einigkeit über den Namen seines Vaters bleibt die Familiengeschichte Stradivaris weitgehend ein Rätsel. Bonetti und seine Mitautoren Agostino Cavalcabò und der Rechtshistoriker Ugo Gualazzini stellten fest, dass Auswärtige, die eine Werkstatt eröffnen wollten, unter Zeugen das Bürgerrecht beantragen mussten. Im Falle Stradivaris hat sich kein solcher Antrag gefunden.118 Sogar sein Alter ist Gegenstand von Spekulationen: In den Volkszählungen zwischen 1668 und 1678 wurde er faktisch immer jünger.119 Die Geburtsdaten der Ehefrauen Stradivaris wurden bei der Hochzeit ordnungsgemäß festgehalten, sein eigenes, das vermutlich zwischen 1644 und 1649 liegt, hingegen nicht. Warum nicht? Renzo Bacchetta vermutet, dass die für 1647 bis 1649 aussagekräftigen Statistiken verloren gingen, als neue kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den Modenesen (die mit Frankreich verbündet waren) und den Milanesen (mit Spanien an ihrer Seite) einen Flüchtlingsstrom auslösten, zu dem auch Stradivaris Mutter gehörte.120 »Diese Fragen, so fürchten wir, können nicht beantwortet werden«, konstatierten die Hills in Bezug auf Stradivaris Lehrzeit.121
Dass Stradivari seit dem Jahr 1667 Instrumente baute, ist bekannt, doch aus der Zeit vor 1680 sind nur wenige erhalten. Beare vermutet, dass es durchaus noch mehr gegeben haben könnte. Möglicherweise wurden sie von Berufsmusikern erworben, die noch nicht erkannt hatten, was es hieß, eine Strad zu besitzen; möglicherweise gingen sie an Besitzer, die sie um ein oder zwei Jahrzehnte zurückdatierten, um ihren Wert zu steigern.122 Auch dies bleibt ein Geheimnis.
Bei seiner ersten Eheschließung im Jahr 1667 war Stradivari wohl noch sehr jung, vielleicht heiratete er sogar zu früh für einen jungen Künstler ohne Familie oder Besitz. Andrea Amati war über 30, als er zum ersten Mal heiratete. Sein Enkel Nicolò war nahezu 50. Wahr ist zwar auch, dass Pietro Guarneri mit 22 und Giuseppe Guarneri del Gesù mit 24 Jahren heirateten.123 Im Gegensatz zu Stradivari aber hatten beide alteingesessene Väter. Ungewöhnlich war allerdings, dass Stradivaris erste Frau, Francesca Ferraboschi, vier oder neun Jahre älter war als er. Mit 27 Jahren war sie bereits Witwe, da ihr Bruder mit einer Armbrust ihren ersten Mann erschossen hatte – unter Umständen, die ihn ins Exil brachten. Später wurde ihm erlaubt, nach Cremona zurückzukehren. Dass die Volkszählung vom Ostermontag 1659 nur vier Häuser von der Casa der Familie Amati entfernt eine Familie Ferraboschi verzeichnet, könnte |47| erklären, wie sie sich kennengelernt hatten.124 Die Geburt des ersten Kindes fünf Monate nach der Hochzeit mag auf einen Grund für die Eheschließung hindeuten; auch die Rückgewinnung ihrer Mitgift könnte eine Rolle gespielt haben. Unterdessen klagte ihr Ex-Schwiegervater erfolgreich das Sorgerecht für die beiden jungen Enkelinnen aus ihrer früheren Ehe ein.125
All das war ein dramatischer Start, doch es gibt keine Hinweise darauf, dass es in den verbleibenden 70 Jahren von Stradivaris Leben jemals zu ähnlichen Erschütterungen kam. Im Gegenteil: Stradivari scheint seine Geschäfte auf nüchternste Weise geführt zu haben und wurde nach und nach zu einem erwachsenen, dann alten, dann sehr alten Meister. Die Geschäfte liefen offensichtlich gut. 1680 erwarb er mit einer Anzahlung von 2.000 Lire ein 7.000 Lire teures Haus und eine Werkstatt, die von Nachbarn seines eigenen Berufsstandes oder ihren Zulieferern umgeben war. Schon 1684 war das Anwesen vollständig bezahlt.126 Zum Zeitpunkt seines Todes hatte er es mit hervorragenden Erzeugnissen, einer gehobenen Kundschaft und internationalem Ansehen zu einem beträchtlichen Vermögen gebracht. Seine Frau Francesca gebar in 31 Ehejahren zwei Töchter und vier Söhne, von denen vier das Erwachsenenalter erreichten, darunter zwei Söhne, die ihr Arbeitsleben im Familienunternehmen verbrachten. Nach ihrem Tod wurde sie mit einer Beerdigung und einer Prozession geehrt, deren detaillierte Rechnung den Pfarrer, einen Chorknaben, 36 Dominikanermönche, 16 Franziskaner, 31 Mönche von Sant’Angelo, 27 Mönche von San Luca, 21 Mönche von San Salvatore, 19 Mönche von San Francesco, eine nicht näher bezeichnete Anzahl von Bettlern und Waisen »mit Hut«, 16 Fackelträger, Glocken, Vorhangstoffe, Totengräber und die Kosten für die Verwaltung auflistet.
Ein gutes Jahr später heiratete Stradivari die 35-jährige Maria Antonia Zambelli, von der sonst nichts bekannt ist. Aus der zweiten Ehe gingen eine Tochter und vier weitere Söhne hervor, das letzte dieser Kinder wurde 1708 geboren, als Zambelli 44 und Stradivari zwischen 59 und 64 Jahre alt war. Beide starben im Jahr 1737, Zambelli im März und Stradivari neun Monate später. Sie wurden in einer Kapelle der Pfarrkirche San Domenico beigesetzt, in der Stradivari acht Jahre zuvor ein Grab von einer Cremoneser Adelsfamilie erworben hatte, deren Namen auf dem Grabstein er durch seinen eigenen ersetzen ließ.127 Dieses Mal gibt es keine Aufzeichnungen von der Beerdigung.
Völlig unverhofft wurde 1995 von Chiesa und Rosengard, die nach Spuren von Stradivaris jüngerem Zeitgenossen Giuseppe Guarneri suchten, ein Testament aus dem Jahre 1729 gefunden.128 Dieses Dokument, das längste eigenhändige Schriftstück eines der klassischen Geigenbauer, ist eine bunte Mischung aus Familienalbum, Unternehmens- und Sozialgeschichte. Als es niedergelegt wurde, gab es acht lebende Erben, Zambelli eingeschlossen. Stradivari war zwar um Gerechtigkeit bemüht, doch selbstverständlich innerhalb der Parameter einer patriarchalischen Gesellschaftsordnung, die bis weit in das |48| 20. Jahrhundert hinein überlebte. Zambelli wurde als Erbin ihrer Kleidung, ihrer Bettwäsche und der Hälfte ihres Schmucks benannt. Ein späterer Nachtrag sprach ihr darüber hinaus Geld und Haushaltsgegenstände zu. Außerdem wurde ihr die Verantwortung für ihre beiden überlebenden Söhne zugewiesen. Im Falle einer Wiederverheiratung würde das Erbe verfallen, doch ihr Tod vor Stradivaris Ableben machte diesen Teil gegenstandslos.
Eine andere Erbenkategorie stellten die drei der sieben überlebenden Kinder dar, die religiösen Orden beigetreten waren. Für Francesca Maria, eine Nonne, die seit 1719 dem gleichen Kloster angehörte wie die Enkelin von Andrea Guarneri und seither von den Zinsen alimentiert wurde, die ihre Mitgift erbrachte, gab es eine Jahresrente. Für Alessandro, den Sohn aus erster Ehe und Priester, war das feste Einkommen aus einem Hypothekendarlehen an die jüngste Generation der Amatis vorgesehen. Giuseppe, Sohn aus der zweiten Ehe und ebenfalls Priester, erhielt ein festes Einkommen aus dem Besitz der Hälfte einer Bäckerei.
Annunziata Caterina, auch als Caterina Annunziata bekannt, unverheiratet und beim Tod ihres Vaters 63 Jahre alt, erbte Kleidung, Haushaltswäsche, Schmuck und den Ertrag aus zwei ziemlich umfangreichen Darlehen aus dem Jahre 1714. Das jüngste Kind, Paolo, als Partner bereits an einem Textilunternehmen beteiligt und beim Tod seines Vaters noch keine 30 Jahre alt, sollte für den Fall, dass er ein eigenes Geschäft eröffnen würde, die beträchtliche Barzahlung von 6.000 Lire, andernfalls einen gleichwertigen Betrag in bar sowie Hausrat und sechs vermutlich fertige Violinen erhalten.
Übrig blieben Francesco (geboren 1671) und Omobono (geboren 1679), die Söhne aus der ersten Ehe, die ihr Leben im Familienunternehmen zugebracht hatten. Der umtriebigere Omobono war mit 18 Jahren nach Neapel gegangen – zu dieser Zeit Italiens größte und nach London und Paris Europas drittgrößte Stadt. Sein Vater hatte ihn dort zweieinhalb Jahre finanziell unterstützt, obwohl er ihm anscheinend nie verzieh, dass er sein Zuhause verlassen hatte. 40 Jahre später stellte er Omobono die Kosten für seinen Unterhalt rückwirkend in Rechnung. Ebenso wie sein Halbbruder Paolo erbte Omobono sechs Geigen. Das war alles, was im Testament ausgewiesen ist. Der Rest des Vermögens einschließlich der Werkstätten mit ihrem guten Ruf, den fertiggestellten Instrumenten, Holz, Werkzeug und Muster sowie das Haus mit seinem Hausrat abzüglich vorzunehmender Auszahlungen ging an Francesco, den pflichtbewussten älteren Bruder und das älteste überlebende Kind, der auch als Testamentsvollstrecker seines Vaters benannt wurde.
Das Testament ist das einzige annähernde Porträt Stradivaris, das wir besitzen; nicht weniger interessant ist jedoch, was es über eine Familie, eine Kultur, eine Gesellschaft und sogar über Vergleichswerte und Größenordnungen aussagt. Die jeweiligen Jahresraten von 150 und 300 Lire an die beiden |49| geistlichen Söhne sowie 170 Lire für Annunziata Caterina und 100 für Francesca zeigen, was es kostete, einen älteren und einen jüngeren Priester, eine Nonne und eine alternde, unverheiratete Tochter zu unterhalten. Die Bewertung der sechs Violinen mit insgesamt 1.000 Lire, etwas über 150 Lire pro Stück, sagt nicht nur etwas über den jährlichen Unterhalt eines Priesters in Relation zum zeitgenössischen Preis einer Strad, sondern auch über Stradivaris Einkommen aus. Die Gebrüder Hill schätzten, dass Stradivari, der mehr als 46 Jahre lang als unabhängiger Geigenbauer arbeitete, 1116 Instrumente herstellte, darunter 960 Geigen.129 Multipliziert mit 150 und dann durch 46 geteilt, entspricht dies einem Bruttojahreseinkommen von 3.130 Lire – Bratschen, Celli, Gamben, Lauten, Gitarren, Mandolinen, Harfen und was sonst noch in der Werkstatt entstanden war, nicht mitgerechnet. Wie nahezu alles, was wir über Stradivari wissen, beruht auch diese Zahl auf einer überschlägigen Kalkulation, doch zeigt sie nicht nur, wie erfolgreich er war, sondern auch, wie sehr er den Markt dominierte. Ebenso wie seine Kollegen investierte Stradivari später einen Teil des Ertrags in Darlehen, Immobilien und weitere Unternehmen.
Die für Paolo reservierten 6.000 Lire, ob nun in Geld- oder Sachwerten ausgezahlt, sagen viel über die Kosten einer Stradivari im Vergleich zu einer Unternehmensgründung aus. Vier Jahre nachdem Stradivari sein Testament aufgesetzt hatte, kaufte er seinem jüngsten Sohn für 25.000 Lire eine Juniorpartnerschaft in einem lokalen Textilunternehmen. Einen weiteren Hinweis auf das Vermögen des Vaters gibt Annunziata Caterinas Jahresrente, die indirekt aus den 5 Prozent Zinsen der Kredite stammte, die einige Jahre zuvor verlängert worden waren. 1680 erwarb Stradivari ein Haus für 7.000 Lire, 1714 verlieh er 12.000 Lire, eine Summe, die – auch unter Berücksichtigung einer leichten Inflation – den Wert seines Hauses deutlich überstieg.130 Ein Jahr später musste sich Giuseppe Guarneri, rund 20 Jahre jünger als Stradivari und eigenständiger Geigenbauer, 1.000 Lire leihen. Mit der Rückzahlung kam er in Verzug.
Seit Stradivaris Tod kreist die Fantasie der Öffentlichkeit um die Geheimnisse seines Erfolges.131 Die von ihm verwendeten Materialien – egal, ob sie naturbelassen, durch Lagerung,132 Klima133 oder Mineralisierung134 verbessert, gebrannt oder chemisch manipuliert waren135 – gehören seit Felix Savart, einem Vorreiter der Geigenakustik, zu den Hauptkandidaten, dicht gefolgt von vermeintlichen, auf Mathematik basierenden akustischen Prinzipien, die mündlich überliefert wurden und mit dem Aussterben der Gilde verloren gingen.136 Doch wurde nichts gefunden, das irgendeine dieser Vermutungen bestätigt hätte.
Spätestens seit 1859, als ein direkter Nachkomme – Giacomo Stradivari – Vuillaume von einer Rezeptur berichtete, die einer verschwundenen Familienbibel entstammte, war der Lack ein Dauerbrenner.137 Vuillaume bot an, die Rezeptur streng vertraulich zu erproben und über die Ergebnisse zu berichten. Danach fuhr er mit einem angeblichen Porträt des Meisters zurück nach Paris. |50| Über seine Tochter, an die er es weitergegeben hatte, gelangte es irgendwann zu den Gebrüdern Hill, die nach Rücksprache mit Lady Huggins zu dem Schluss kamen, dass es sich bei diesem Bildnis wahrscheinlich um ein Porträt des jungen Monteverdi handelte.138
Auch die große Jagd auf den Lack endete letztlich in einer Sackgasse. Viktorianer versuchten, durch direkten Kontakt mit Stradivaris Geist an die magische Essenz zu kommen.139 Ein Jahrhundert später können ihre Nachfolger bis zu 600 Google-Einträge zum Thema finden; nach Aussage von Joseph Curtin aus Ann Arbor, Michigan, aber, der sich als Akustiker und Geigenbauer gleichermaßen auszeichnete, könnten sie ebenso gut nach Hammetts Malteser Falken oder Citizen Kanes Rosebud suchen. Das sogenannte Geheimnis bestand laut Curtin aus nichts weiter als Pflanzenöl und Baumharz und war bestenfalls eine Variante des Lackes, den Stradivaris Nachbarn und Konkurrenten verwendeten.140 Zu diesem Ergebnis kam im Jahr 2009 auch eine aufwendige deutsch-französische Analyse winziger Lackfragmente von fünf Instrumenten im Pariser Musée de la Musique.141 Dass das vermeintliche Geheimnis offenbar lediglich darin bestand, dass Stradivari dasselbe machte wie seine Kollegen und Zeitgenossen, nur einfach besser, war Jahre zuvor schon das Ergebnis von langwierigen Untersuchungen des Lackes und von praktischen Versuchen von Simone Fernando Sacconi gewesen.142
Dass seine Karriere ein Maßstab, ein Spätsommer, ein herrlicher Sonnenuntergang und eine Coda war, blieb stets unausgesprochen und wurde doch nie bezweifelt. Im Laufe seines wunderbar langen und produktiven Arbeitslebens gingen nach und nach die Bevölkerungszahlen und die Produktionsbasis in Cremona zurück, während Italien seine Exportmärkte und Wettbewerbsvorteile an seine dynamischeren und günstiger gelegenen nord- und westeuropäischen Nachbarn verlor.143 Die nächste Generation der Stradivaris war buchstäblich eine Metapher für die Welt, die sie geerbt hatte. Zwei von ihnen waren bereits als mehr oder weniger junge Erwachsene ohne direkte Nachkommen gestorben, darunter die Tochter Giulia, die 1689 mit einer großzügigen Mitgift verheiratet worden war.144 Von den sieben überlebenden Kindern traten drei – darunter zwei aus der ersten Ehe – in religiöse Ordensgemeinschaften ein und machten in der Kirche Karriere. Im katholischen Europa war der Hang zur Kirche selbst in diesem Ausmaß nichts Besonderes. Doch die drei nichtgeistlichen überlebenden Kinder aus der ersten Ehe waren ebenfalls unverheiratet und beim Tod ihres Vaters selbst schon im Rentenalter. Nur Paolo, der jüngste unter den vier nichtgeistlichen Kindern aus beiden Ehen, heiratete.
Zur selben Zeit folgte das Geigenbauangebot der Nachfrage anderer, neuer Musikzentren, während der Erfolg Stradivaris, wenn von diesem auch nicht beabsichtigt, seine lokalen Konkurrenten an den Rand des Ruins brachte.145 Die Folgen zeigten sich in derselben Straße im Haus der Guarneri.
|51| Ebenso wie sein Vater, der ältere Giuseppe filius Andreae, stand Bartolomeo Giuseppe Guarneri in seinem Berufsleben meist im Schatten Stradivaris. Er wurde 1698 in Cremona geboren und starb dort sieben Jahre nach Stradivari. Sein Onkel Pietro Guarneri, Geigenbauer und -spieler, war etwa 20 Jahre vor Giuseppes Geburt nach Mantua gezogen, wo er sich der Hofkapelle anschloss, relativ wenige, aber erstklassige Instrumente baute, das lokale Monopol als Lieferant von Saiten und Zubehör hielt und ein beträchtliches Vermögen hinterließ.146 Eine Generation später folgte Giuseppes Bruder, ein zweiter Pietro Guarneri, dem Beispiel des Onkels und zog nach Venedig. Anders als ihre Kollegen aus Cremona konnten die venezianischen Geigenbauer, Musiker, Komponisten und Musikverlage kaum Schritt halten mit der Nachfrage von Kirchen, Theatern, Opernhäusern, Akademien, privaten Förderern, musiksüchtigen Amateuren sowie den Ospedali, den legendären Mädcheninternaten, die alle nach größeren Orchestern, mehr Konzerten, neuen Stücken, Noten und Instrumenten aller Art verlangten.147 Bis 1725 hatte sich der jüngere Pietro in Venedig, wo er 1728 heiratete, einen Namen gemacht. Zwischen 1729 und 1743 zeugte er fünf Söhne und fünf Töchter, doch keines seiner Kinder übernahm das Geschäft. Als er 1762 starb, wurde er von seiner Witwe und mindestens einem Sohn, von dem weiter nichts bekannt ist, überlebt und hinterließ ein Erbe heiß begehrter Instrumente, darunter einige wunderbare Celli und eine mit 1734 datierte Violine, von der die Gebrüder Hill meinten, sie könne in Zusammenarbeit mit seinem in Cremona gebliebenen Bruder entstanden sein.148
Ob der jüngere Giuseppe Cremona jemals verließ, ist nicht bekannt, obwohl das Ahornholz, das er vornehmlich verarbeitete, auf einen venezianischen Lieferanten deutet.149 Doch in Gestalt französischer Kunden und einer Ehefrau aus Wien, die – bemerkenswert für die Zeit – ebenfalls Geigenbauerin gewesen sein könnte, kam die Welt zu ihm.150 Durch diese Verbindung von Frankreich und Österreich unter einem Dach wird das Cremona seiner Zeit treffend beschrieben. Ein einheimischer Geiger erinnerte sich, dass 1733 ein französischer Oberst aus Avignon unmittelbar nach seiner Ankunft versuchte, jene Stradivaris zu erwerben, die Paolo, der Sohn des Meisters, später dem spanischen Hof verkaufte. Aus dem Kauf wurde nichts, doch das Angebot bestätigt zumindest, dass sich die Besatzer völlig darüber im Klaren waren, dass Cremona mehr zu bieten hatte als nur seine strategische Lage.
Nach der Ankunft der Franzosen folgten bald Berufsmusiker und amtliche Besucher, die sich mit den lokalen Berufsmusikern zu etwas zusammentaten, was seit Generationen die erste derartige Vereinigung gewesen zu sein scheint. Da die meisten von ihnen Geiger mit guten Verbindungen zu lokalen Geigenbauern waren, scheint es plausibel, dass Guarneri, immer noch in den Dreißigern und mit Abstand der jüngste Geigenbauer der Stadt, kundenfreundliche Preise und Bedingungen bot.151
|52| Das letzte Jahrzehnt seines Lebens scheint zumindest einige Erfolge gebracht zu haben, denn die erhaltenen Instrumente zeigen ihn auf der Höhe seiner Schaffenskraft. Die Gebrüder Hill, denen im Jahr 1931 147 Instrumente bekannt waren, schätzten, dass er in einer relativ kurzen Lebenszeit etwa 250 Geigen baute; Hinweise auf Bratschen oder Celli fehlen allerdings. 1998 waren dem Chicagoer Geigenhändler Robert Bein 132 Instrumente bekannt, darunter zwei, die kurz zuvor auf geheimnisvolle, ja geradezu erstaunliche Weise aus dem postsowjetischen Russland aufgetaucht waren – ohne einen Hinweis darauf, wo sie seit der Oktoberrevolution gewesen waren.152
In der Zwischenzeit waren im Metropolitan Museum in New York 25 von Guarneris Geigen aus der ganzen Welt ausgestellt worden, in Verbindung mit einem Symposium zum Gedenken des 250. Todestages. Den Initiatoren, Hargrave, Dilworth und Stewart Pollens, dem Instrumentenrestaurator des Metropolitan Museums, war die Idee bei einem Abendessen im Londoner Stadtteil Soho gekommen. Peter Biddulph, einer der großen Londoner Geigenhändler, ebnete ihnen den Weg ins Metropolitan. Hargrave und Dilworth, umgeben von Sicherheitskräften, mussten die Instrumente selber abholen, sie eigenhändig nach New York bringen und die Exponate für die Ausstellung vorbereiten, weil »wir diejenigen waren, die den Versicherungsschutz hatten«, wie Hargrave sich lebhaft erinnerte. Dann versammelte sich der Geigenhandel wie ein Kardinalskollegium zu einer Reihe von Galeriegesprächen, während ein Aufgebot von Weltklasse-Virtuosen zeigte, wozu diese Instrumente fähig waren.153
Für einen Geigenbauer, der zu seinen Lebzeiten kaum über die Stadtgrenzen hinaus bekannt war, war diese Veranstaltung wirklich bemerkenswert. Ebenso wie sein Bruder hinterließ auch Giuseppe weder eine Werkstatt, noch weiß man von Lehrlingen. Alleinige Erbin war offensichtlich seine Frau, die wieder heiratete, die Stadt verließ und aus der Geschichte verschwand. Es sollte bis zum Jahr 1776 dauern, bis ein Händler aus Cremona Cozio eine Guarneri mit einem Preisnachlass von 25 Prozent auf den Preis einer Giovanni Battista Guadagnini – Cozios damaligem Lieblingsobjekt – anbot. Als Tarisio 1827 zum ersten Mal in Paris auftauchte, waren sowohl Paganini als auch seine Guarneri von 1742 in ganz Europa berühmt. Doch es hatte mehr als zwei Generationen gedauert, bis irgendjemand von dem Erbauer des Instrumentes erfuhr, das Paganini »die Kanone« nannte. Erst in den 1850er-Jahren lagen Guarneri-Preise mit denen von Stradivaris gleichauf.154
Wegen des stilisierten Kreuzes und der frommen Buchstaben IHS, die nach 1733 auf seinen Zetteln erschienen, wurde Giuseppe jetzt als »del Gesu« bezeichnet, offenbar um ihn von seinem Vater unterscheiden zu können. Ob damit noch mehr beabsichtigt war, bleibt ein Geheimnis. Nebenbei entstand ein Mythos, der ihn zu einer Art Villon oder Cellini der Violine machte, weil er bei einer Schlägerei einen Kollegen getötet hatte und daraufhin |53| inhaftiert wurde. Die Tochter des Kerkermeisters soll ihm dazu verholfen haben, auch hinter Gittern arbeiten zu können.155
Doch paradoxerweise brachten die Forschungen, die durch die Ausstellung im Metropolitan Museum angeregt worden waren, einen pflichtbewussten Sohn und soliden Bürger zum Vorschein, der sowohl in der nachbarschaftlichen Geschäftswelt als auch in sozialen und kirchlichen Netzwerken fest verankert war. Sein Grundproblem scheint schlicht ein Mangel an finanzieller Sicherheit gewesen zu sein – ein Problem, das schon zu Zeiten seines Vaters bestand und dessen Ursprünge letztlich in der lokalen Wirtschaft lagen. Die Söhne Guarneris, möglicherweise die letzte Gruppe, die auf traditionelle Cremoneser Art und Weise ausgebildet wurde, lernten das Familienhandwerk vermutlich von ihrem Vater, der außer dem Mietertrag aus seinem zweiten, von seiner Mutter ererbten Haus nichts besaß, womit er sie entlohnen konnte. Dennoch weisen die erhaltenen Spuren den jüngeren Giuseppe als einen respektablen und sogar geschäftstüchtigen jungen Mann aus. Er verließ sein Elternhaus als 24-Jähriger, heiratete, mietete im Alter von 30 Jahren ein Gasthaus, verkaufte den Mietvertrag mit einem kleinen Gewinn und eröffnete eine Geigenwerkstatt. Anfang 1732 stellte er sogar seinen Vater ein.
Um 1735 hatten sich die Dinge soweit gebessert, dass der ältere Guarneri die Zinszahlungen auf Darlehen, die er brauchte, um von seinem Bruder dessen Anteil am väterlichen Haus zu erwerben, wieder aufnehmen konnte. Dann kamen die Österreicher erneut nach Cremona und verhängten eine schmerzliche Steuer, um die lokale Garnison zu unterhalten. Abermals ging die Wirtschaft auf Talfahrt. Vater, Sohn und Schwiegertochter mussten einmal mehr in ein gemeinsames Haus ziehen. Von den 2.500 Lire Gewinn, die der Verkauf des Mietverhältnisses erbrachte, nutzte Guarneri 2.000 Lire zur Tilgung der väterlichen Darlehen, doch um die Beerdigung seiner Mutter bezahlen zu können, musste er selber einen Kredit aufnehmen. Bis zu seinem Tod im Jahr 1740 war der ältere Guarneri faktisch von seinem Sohn abhängig. Der jüngere Sohn Giuseppe verkaufte dann nach Absprache mit seinem Bruder in Venedig das Haus seines Großvaters und zog so den Schlussstrich unter ein Familienunternehmen, das bis zum Jahr 1653 zurückreichte. Aus dem Verkauf floss die Hälfte der 3.000 Lire Erlös in die Tilgung von Schulden. Den Rest teilten Giuseppe und sein Bruder untereinander auf.156 Als Giuseppe ein paar Jahre später starb, waren ihm 1737 Stradivari, 1740 Girolamo Amati und 1742/43 die Stradivari-Söhne vorausgegangen. 1747 starb mit Carlo Bergonzi auch der letzte große Cremoneser Geigenbauer. In einer Gesellschaft und Wirtschaft, in der Immobilien der zuverlässigste Indikator für Reichtum waren, waren sie die letzten Cremoneser Geigenbauer mit Immobilienbesitz. Lorenzo Storioni (1744–1816) und ein ganzes Jahrhundert von Cerutis zeugen zwar davon, dass dies nicht das Ende des Cremoneser Geigenbaus war157, das Ende einer |54| Ära aber war es gewiss. Enrico Ceruti war das letzte Bindeglied zur großen Tradition, der erste und letzte Cremoneser Geigenbauer, der der Nachwelt ein Foto-Porträt hinterließ: Es zeigt ihn 1883 auf seinem Sterbebett.
»Fahren Sie mich bitte zu dem Haus von Stradivari«, bat der viktorianische Geistliche und Geigenkenner H. R. Haweis den Taxifahrer nach seiner Ankunft in Cremona im Jahr 1880. »Von wem?«, fragte dieser. »Stradivari, der große Geigenbauer«, entgegnete Haweis. »Hier macht keiner mehr Geigen«, war die Antwort des Fahrers.158 San Domenico, der Ort von Stradivaris Grab, war bereits zwischen 1868 und 1869 eingeebnet worden, als einige Hundert Arbeiter mit Spitzhacke und Schaufeln die Kirche abgetragen und aus dem Schutt einen Damm für den Fluss Po errichtet hatten. Die Wiederentdeckung des Grabes war gewissermaßen ein Abfallprodukt dieser Zerstörung und bemerkenswert genug, um in der Lokalzeitung erwähnt zu werden.159 Wenigstens wurde der Grabstein geborgen, nach einigen Jahren in einem städtischen Lagerraum auf die Piazza Roma, einen am ehemaligen Begräbnisort angelegten Park, und schließlich in das örtliche Museum gebracht.160
Erst seit 1930, nachdem die Sammlung von Stradivari-Erinnerungsstücken durch viele Hände gegangen war, beherbergt das Museum Papiere und Holz-Modelle, Werkzeuge und sogar einen Stempel der Brüder Mantegazza zur Herstellung falscher Stradivari-Zettel. Schon damals bedurfte es der Hartnäckigkeit und Redegewandtheit des sechsten Besitzers, Giuseppe Fiorini, einem römischen Geigenbauer und Mentor von Sacconi, um das Museum dazu zu bewegen, die Sammlung anzunehmen.161 Jahrzehnte später würden vermutlich nur wenige seiner Besucher mit der Beschreibung der Schriftstellerin Victoria Finlay hadern, hier »eines der langweiligsten Museen in ganz Europa zu einem interessanten Thema« vorzufinden.162
1925 waren die Casa Guarneri und ihre Umgebung noch soweit erhalten, dass die Gebrüder Hill sie fotografieren konnten.163 Doch als 1937 eine lokale Initiative, die von Roberto Farinacci, dem faschistischen Oberhaupt der Stadt, mit viel Begeisterung ins Leben gerufen und von Mussolini gefördert und persönlich genehmigt worden war, zu einer internationalen Ausstellung anlässlich des 200. Todestages Stradivaris führte, waren auch sie verschwunden.164 Von den 41 ausgestellten Strads hatte Sacconi alleine 15 aus New York geholt. Schätzungsweise 100 000 Besucher, ein Drittel davon aus dem Ausland, kamen, um die alten italienischen Meister zu sehen; etwa 35 000 Interessierte, die Hälfte davon aus dem Ausland, sahen sich auch die Arbeiten der 119 modernen italienischen Geigenbauer an.165
Dann verdunkelte sich die Szene wieder. Charles Beare, der im Jahr 1961 zu einem ersten ehrfürchtigen Besuch anreiste, fand dort, wo Stradivaris Haus gestanden hatte, eine Gedenktafel und eine Café-Bar, in die später ein Imbiss einzog. Es sollte bis 1962 dauern, bis die Stadt endlich eine eigene Strad – die |55| »Cremonese« von 1715 – für 17.000 Pfund von Hill’s kaufte, um sie im Rathaus zu zeigen.166 Es war dies eine der schätzungsweise 14 Geigen, die Joseph Joachim, dem großen Virtuosen des 19. Jahrhunderts, gehört hatten.
Theoretisch hätten die Verluste Cremonas zu Gewinnen Venedigs werden müssen. Die Venezianer bauten im 16. und 17. Jahrhundert viele elegante Gamben, Liras, Gitarren, Lauten und Theorben, doch der Geigenbau lief nur langsam an. Geigenbauer mit deutlich nichtitalienischen Namen wie Straub und Kaiser waren seit 1675 aufgetaucht, gefolgt von einem Tross begabter Italiener, von denen einige ihre Techniken der Holzverarbeitung an Holzschuhen ausprobiert hatten. Im Gegensatz zu den Cremoneser Geigenbauern waren in Venedig nahezu alle Vertreter dieses Berufsstandes Migranten, die Venedig genauso ansteuerten wie andere später Paris, Berlin oder Chicago.
Die venezianische Ära war zwar kurz, doch blieb sie unvergesslich. Im Jahr 1715 zählte die Gilde sechs Mitglieder, in einer Stadt mit etwa 40 000 Einwohnern eine beachtliche Zahl. Außerdem gab es noch drei große Geigenbauer, die nicht in der Gilde waren. Der erste war Mateo Goffriller, ein Tiroler, der die Gilde offenbar wegen ihrer Auflage, Instrumente mit Zetteln zu kennzeichnen, mied, um die Steuer zu umgehen. Der zweite, Domenico Montagnana, wurde 1733, als ein kleinerer Konkurrent starb, gebeten, dessen Hinterlassenschaft zu inventarisieren. Montagnana, dessen Werkstatt genug abwarf, um mindestens fünf Mitarbeiter einzustellen, und der genügend Vermögen hatte, um es zu 3,5 Prozent anzulegen und seinen Töchtern Wohnungen im Rialto-Viertel zu kaufen,167 fand etwa 100 deutsche Geigen vor, die er auf einen Preis von eineinhalb Lire pro Stück schätzte. Aus dieser Geschichte kann man zweierlei ableiten: erstes eine generelle Nachfrage nach Violinen, einschließlich Billig-Importen, und zweitens eine Nachfrage nach guten, sogar sehr guten Violinen von Menschen, die es sich leisten konnten, sie zu erwerben.168
Ebenso wie in Cremona aber scheint die Sonne auch in Venedig bereits Mitte des Jahrhunderts untergegangen zu sein. Der dritte große Venezianer, Santo Serafino, stellte im Jahr 1744 aus ungeklärten Gründen die Arbeit ein. Sein Neffe Giorgio, der in die Montagnana-Werkstatt eingeheiratet hatte und dort sehr erfolgreich war,169 starb 1775. Pietro Guarneri war der Letzte einer sowohl venezianischen als auch Cremoneser Linie. Als Napoleon 1793 in Venedig einfiel, gab es zwar 260 Gilden, doch die Gilde der Geigenbauer hatte nur noch ein einziges Mitglied.
Einer der Gründe für den Verfall des italienischen Geigenbaus lag wohl in den Nebenkosten eines Imperiums. In den Jahren 1740/41 verlor das kaiserliche Österreich Maria Theresias Schlesien an das machthungrige Königreich Preußen, und wie so häufig führten militärische Ausgaben zu wirtschaftlichen Reformen und damit zu höheren Steuern, zu Zwangsexporten und zu mehr |56| Macht für die Zentralregierung in Wien. Auf der Verliererseite standen italienische Handwerksunternehmen sowohl in Cremona als auch in Venedig sowie die Wohlhabenden, die ihre besten und treuesten Kunden gewesen waren.170 Im Übrigen war der Niedergang des Geigenbaus keineswegs auf das österreichische Italien beschränkt.171
Ein zweiter Grund scheint in einer verringerten Nachfrage zu liegen. So baute der große Tiroler Geigenbauer Jakob Stainer im Jahr 1669 für die Kathedrale im mährischen Olmütz (heute Olomouc) vier Bratschen. Wann aber würde man wieder welche brauchen? Wer würde für seine Montagnana-, Santo-Serafino- oder Pietro-Guarneri-Geige Ersatz benötigen, solange er von Feuer, Hochwasser und Einbruch verschont blieb und ihn keine Kanonenkugel traf? Ein professioneller Geigenbauer konnte etwa 20 Violinen pro Jahr herstellen, 800 in seinem gesamten Berufsleben. Rene Vannes’ Standardwerk Dictionnaire universel des luthiers172 verzeichnet Mitte des 18. Jahrhunderts allein für Cremona 60 Geigenbauer. Einige wenige, darunter die frühen Amatis, Andrea Guarneris oder Stradivaris, konnten auf Vorbestellung arbeiten, an Sammler verkaufen und ihre eigenen Preise bestimmen. Aber in der unvermeidlichen Rücksicht auf ihren eigenen Lebensunterhalt und auf – wie Walter Kolneder taktvoll formulierte – »ihre nicht selten zahlreichen Familien«,173 mussten die meisten von ihnen auf Vorrat produzieren. Die Frage war, wie viele italienische Geigen der Markt aufnehmen konnte und wie viel die Menschen bereit waren, für sie zu bezahlen.
Ein dritter Grund war vermutlich der Niedergang von Venedig selbst. Seit dem 15. Jahrhundert, als die Türken Konstantinopel überrannten und Kolumbus Amerika entdeckte, steuerte die Stadt auf eine Krise zu. Es folgten Krieg auf Krieg mit den Osmanen, herrliche Siege, künstlerische Triumphe, aber auch ein militärischer und wirtschaftlicher Niedergang, oligarchische Entropie und der schleichende Bedeutungsverlust einer Stadt, die ehemals eine Supermacht gewesen war. Als Napoleon 1797 mit dem Vertrag von Campo Formio die Stadt nach 1 000 Jahren Unabhängigkeit an die Österreicher übergab, bedeutete dies auch für den Geigenbau das Ende einer Epoche, die niemand so sehr verkörperte wie Giovanni Battista Guadagnini, obwohl ungefähr 200 Jahre ins Land gehen sollten, bevor seine bemerkenswerte Karriere vollständig verstanden und gewürdigt wurde.174 Das Geflecht von Mythos und Irrtum, das sich mit der Zeit um seinen Namen rankte, war nicht weniger bemerkenswert. In Wirklichkeit war er nicht – wie teilweise, und nicht selten mit seiner Zustimmung, angenommen wurde – der Sohn eines Geigenbauers, in Cremona geboren oder bei Stradivari in die Lehre gegangen. Ebenso wenig gab es zwei verschiedene Personen mit seinem Namen.
Die Tatsachen sind schillernd genug. Guadagnini wurde 1711 am Rand des Apennin in Bilegno geboren, einem auf der Landkarte kaum erkennbaren Örtchen an einem kleinen Nebenfluss des Po, oberhalb von Cremona. Wie |57| schon bei vielen seiner Vorgänger liegen seine frühen Jahre im Dunkeln. Ein Indiz aber deutet auf einen handfesten Nachteil: Da er sein Leben lang Analphabet war, hatte er offensichtlich keine Schule besucht. In frühen Jahren zog er nach Piacenza, einer Stadt mit 27 000 Einwohnern am Zusammenfluss von Trebbia und Po und der Sitz des Hofes der Familie Farnese von Piacenza-Parma, einem Vasallen der spanischen Krone. Bis Mitte der 1730er-Jahre betrieb sein Vater nacheinander ein Gasthaus, eine Metzgerei und eine Bäckerei, doch keine Geigenwerkstatt. Guadagnini heiratete mit 27 Jahren.
Dass er im Jahr 1748 einer Holzarbeitergilde beitrat, war für Rosengard Grund genug, auf eine Tätigkeit als Schreiner zu schließen, doch baute er zu diesem Zeitpunkt schon seit mindestens zwei Jahren Geigen, und es gibt sogar Anhaltspunkte für eine noch frühere Berufstätigkeit. Das Gesetz schrieb für Geigenbauer eine vierjährige Lehrzeit vor; Hinweise aber, wo oder wann er eine Lehre abgeschlossen hat, sind nicht erhalten. In seinen späten Jahren ist eine Reihe von Strads, von denen er gelernt hatte, durch seine Hände gegangen. Die Zettel, die ihn als »Alumnus Antonii Stradivari« bezeichnen, sollte man nicht wörtlich nehmen – unabhängig davon, ob von ihm sie selbst stammen oder von jemand anderem.
Sein über 40 Jahre dauerndes Berufsleben war im Wesentlichen eine fantasievolle Variation über vier wiederkehrende Themen, von denen eines – wie üblich – die Familie war. Er stand in regelmäßigem Kontakt zu Berufsmusikern. Weit mehr als jeder anderer große Geigenbauer wurde er durch Kriege, Verträge, dynastische Ehen und fürstliche Vermögen hin und her geschoben wie ein Bauer auf dem Schachbrett. Klarer und eindeutiger als bei jedem bisherigen Geigenbauer war sein Schicksal untrennbar mit der Zukunft des Marktes verbunden.
Auch der Zufall mag eine Rolle gespielt haben. Im Jahr 1740 scheinen Guadagnini und seine Frau ihre Wohnung mit einem Schreiner geteilt zu haben, der mit der Tochter eines Geigers verheiratet war. Innerhalb eines Jahres hatte er offenbar gesellschaftlichen Umgang mit lokalen Streichern und baute Geigen um eine innere Form herum. Dass die Ferrari-Brüder zu seinem Kreis gehörten, förderte offensichtlich das Geschäft. Von diesen Söhnen eines lokalen Käsehändlers war der eine Konzertmeister und der andere ein vielversprechender junger Cellist in der Hofkapelle. Nach 1743 scheint Guadagnini über den lokalen Bedarf hinaus produziert zu haben.
Der österreichische Erbfolgekrieg aber hatte für ihn zweischneidige Folgen. Einerseits führte die Belagerung durch die Spanier und ein kurzzeitiger Sieg Prinz Felipes – General und Geigenliebhaber – zu einer aufwendigen Siegesfeier, bei der die Farnese-Mutter des Prinzen und eine Anzahl berühmter Geiger, darunter einer aus Cremona, anwesend waren. Andererseits mag diese Belagerung zum Tod von Guadagninis Vater im Jahr 1746 beigetragen haben, sodass der Sohn nun nicht nur für seine Frau und drei Kinder, sondern auch für |58| seine Stiefmutter und seine Halbgeschwister sorgen musste. Nach der Rückkehr der Österreicher brach eine Epidemie aus, die Guadagninis Frau das Leben kostete. Kurz darauf heiratete Guadagnini die jüngere Schwester seines früheren Nachbarn, die Tochter des Geigers, die selber mit 22 Jahren Witwe geworden war und Kinder hatte. Sie starb fast unmittelbar nach der Hochzeit, was im Jahr 1747 Guadagninis dritte Ehe zur Folge hatte, diesmal mit der Tochter eines Apothekers.
1748 beendete der Vertrag von Aachen den österreichischen Erbfolgekrieg, und Piacenza fiel an Spanien zurück. Guadagnini, noch keine 40 und zweimal innerhalb von zwei Jahren verwitwet, war nun der wichtigste Geigenbauer in der Po-Ebene und für sich selbst sowie für die Familien seines Vaters und seiner zweiten Frau verantwortlich. Ein Jahr später zogen sie alle nach Mailand, wo sich sein Freund Ferrari dem ausgezeichneten Orchester des herzoglichen Hofes als Erster Cellist angeschlossen hatte. Hier erlebten Komponisten und Virtuosen eine Blütezeit, während Amateure aus der Mittel- und Oberschicht, um Rosengard zu zitieren, eine »fast manische Begeisterung« für Freizeit-Ensembles zeigten.175
Innerhalb weniger Jahre war die Werkstatt Guadagninis die am meisten frequentierte, und das in einem Markt, der bereits etablierte Geigenbauer wie die Brüder Testore und Landolfi sowie eine Anzahl kleinerer Konkurrenten ernährte. In den folgenden neun Jahren, so Rosengards Schätzung, könnte er sich mit der Herstellung von mindestens 100 Violinen – darunter etwa ein Dutzend auf 1758 datiert und mit dem Zettel »Cremona« versehen – plus mindestens einem halben Dutzend besonders benutzerfreundlicher Celli der Gesamtproduktion aller anderer lokalen Geigenbauer angenähert haben.176
An diesem Punkt scheint wieder die Politik dazwischengekommen zu sein. Der Friede von Aachen machte aus Felipe, dem geigenliebenden spanischen Infanten, einen Herzog von Parma, und seine Eheschließung mit Louise Elisabeth, einer Tochter des französischen Königs Louis XV., verwandelte den Hof in ein italienisches Versailles. Nachdem Felipe den Franzosen Guillaume de Tillot zum Generalintendanten ernannt hatte, wurde seine Hauptstadt mit ihren 32 000 Einwohnern zu einem Vorposten der Aufklärung, einem Nährboden für die handwerkliche Industrie und einem Zentrum erst der französischen, dann der italienischen Oper. Tillot, ein begabter Technokrat und Musikliebhaber, brauchte für ein Orchester, dessen Musiker sogar aus Paris kamen, einen vorbildlichen Handwerker und den besten verfügbaren Geigenbauer und Restaurator. Vermutlich auf Empfehlung der in den frühen 1750er-Jahren nach Parma gezogenen Brüder Ferrari zog Guadagnini noch einmal um und gelangte 1759 nach Parma.
Ein besonderes Lockmittel könnte dabei eine Festanstellung mit einem Jahresgehalt von 1.200 Lire gewesen sein, das etwa einem Fünftel der damaligen Orchestergehälter und dem Lohn eines Türstehers oder Schuhmachers |59| am Hofe entsprach – für einen Kunsthandwerker eine Seltenheit. Es sollte das sicherste Einkommen bleiben, das Guadagnini je hatte, ausreichend, um drei Töchter zu verheiraten, eine davon mit Tillots Kammerdiener. Doch da die französischen Subventionen der königlichen Extravaganz und dem verlorenen Krieg zum Opfer fielen, stand seine siebenköpfige Familie immer noch vor Geldproblemen. Durch den Tod des musikliebenden Herzogs Felipe ging der Titel an einen weniger kunstsinnigen Erben, und Tillot wurde 1771 entlassen. Die Folge war ein letzter Umzug, diesmal nach Turin. Rosengard schätzte die Umzugskosten auf bis zu 28.000 Lire; Guadagnini indes erhielt vom herzoglichen Hof eine Abfindung von nur 3.600 Lire. Drei Töchter und »viele Enkel« blieben in Parma zurück.177
Auf den ersten Blick war der neue Wohnort in der Hauptstadt eines Herzogtums, das durch den Vertrag von Utrecht zu einem winzigen Königreich geworden war, attraktiv, denn er lag angenehm nahe an Frankreich: ein traditioneller Markt für italienische Geigen. Außerdem war seine Regierung dank eines königlichen Staatsoberhauptes mit außenpolitischen Ambitionen unternehmerisch orientiert und seine Wirtschaft aktiv. Die Turiner Tradition des Geigenbaus reichte zurück bis 1647, als ein paar deutsche Emigranten eine Werkstatt gegründet und sie zum Erfolg geführt hatten.178 Gaetano Pugnani, der amtierende Virtuose der Zeit und gebürtiger Turiner, war kurz zuvor aus London zurückgekehrt, um dem königlichen Orchester vorzustehen. Eine ernst zu nehmende Geigenwerkstatt als Konkurrenz gab es nicht.
Die entscheidende Beziehung scheint sich abermals einem reinen Glücksfall zu verdanken. 1773 trafen der 18-jährige Graf Cozio di Salabue und der 62 Jahre alte Guadagnini aufeinander. Verständlicherweise fühlte sich Cozio zu einem Mann hingezogen, den er für einen Kenner der Cremoneser Szene hielt. Guadagnini, der eine Verbindung zu Cremona für seinen Lebensunterhalt und seinen Ruf offenbar für entscheidend hielt, tat nichts, um ihn eines Besseren zu belehren. Selbst seine Familie glaubte die Geschichte, und Guadagnini beschwor ihren Wahrheitsgehalt unter Eid.
Die Beziehung war nicht einfach, aber bemerkenswert folgenreich. Innerhalb eines Jahres beschäftigte sich der junge Mann diskret, aber eifrig durch Mittelsmänner und Agenten mit dem An- und Verkauf sowie dem Sammeln alter Meisterviolinen, während er Guadagnini mit dem Bau neuer Meisterinstrumente beauftragte. Der ältere Mann vertrat den jüngeren als Bevollmächtigter und Berater bei zunehmend aufwendigen Transaktionen, wobei es keine Hinweise gibt, dass Cozio dabei auch Stradivari-Werkzeuge und -Modelle erwarb. Guadagnini ergänzte Cozios Käufe dann für den Weiterverkauf mit neuen Griffbrettern, Hälsen und Bassbalken.
Zwischen 1774 und 1776 baute Guadagnini monatlich eine Geige, zwei Bratschen und zwei oder drei Celli, was eine Jahresproduktion von mindestens |60| 50 Geigen ergab. Dazu gehörten ein paar Instrumente mit den Zetteln »Guadagnini Cremonen« und sogar »Dominus I[gnatius] A[Lessandro] Cotii«179 – gleich Cozio –, die offenbar als Ware für Cozios Agenten Anselmi zum Weiterverkauf gedacht waren. Dass aber nach Cozios Tod im Jahr 1840 immer noch 48 Guadagnini-Violinen, zwei Bratschen, zwei Celli und eine bunte Mischung von 17 Guarneris, Amatis, Bergonzis, Cappas, Rugeris und einer Stainer-Violine in seinem Besitz waren, beweist, dass dieser Plan nicht aufging.180 Ende 1776 bat Cozio Guadagnini, seine Instrumente um Formen von Stradivari herum zu bauen. Doch Guadagnini war offensichtlich entschlossen, authentische Guadagninis und nicht nachgemachte Strads herzustellen, und weigerte sich. Ein Jahr später endete die Beziehung unter Hinterlassung von Schuldzuweisungen, die nach und nach in Cozios Tagebüchern auftauchten.
Von 1777 bis zu seinem Tod im Jahr 1786 stellte Guadagnini als selbstständiger Geigenbauer weiterhin Violinen her. Er hinterließ eine große Familie, eine kleine Wohnung und kein Testament. Das nachgelassene Inventar enthielt Bögen, Mandolinen, Gitarrenrosetten – Beweise für eine Mehrzweck-Werkstatt – sowie eine Matratze, die Guadagnini einmal von Cozio als Sachleistung erhalten hatte.
Das darauffolgende Schicksal der Werkstatt war sowohl ein ausgedehnter Epilog zu seiner eigenen Karriere als auch eine Art von Generationengeschichte, die zu Romanen anregen würde. Seine Söhne machten sich trotz 14-jähriger französischer Besetzung, revolutionärer Zwangsmaßnahmen und einer entsprechenden Besteuerung, die ihre Stammkundschaft – die Theater und blaublütige Amateure – faktisch auslöschten, einen Namen als führende Gitarrenbauer in Turin. In der schweren Zeit nach dem französischen Rückzug übernahm ein Enkel, Gaetano II., im Alter von 20 Jahren das Unternehmen. Im Gegensatz zu Giovanni Battista war er belesen und gebildet. Er erschloss sich den alten Kundenkreis wieder, richtete seinen Handel mit neu gebauten oder reparierten Instrumenten an dessen Bedürfnissen aus, nahm kluge Geldanlagen vor und hinterließ nach seinem Tod im Alter von 57 Jahren ein beeindruckendes Inventar. Sein Sohn Antonio, ein ausgezeichneter Geigenbauer, der ihm ebenfalls mit 20 Jahren in die Werkstatt folgte, machte sie noch einmal zur Brutstätte eines herausragenden lokalen Geigenbaus,181 bevor er sie an die nächste Generation – an Giovanni Battistas Ururenkel Francesco, ebenfalls ein angesehener Geigenbauer – weitergab. Erst etwa 200 Jahre nachdem der erste Guadagnini begonnen hatte, Geigen zu bauen, beendete der Verlust eines letzten Sohnes im Zweiten Weltkrieg endgültig die Geschichte dieses beispielhaften Familienunternehmens.182