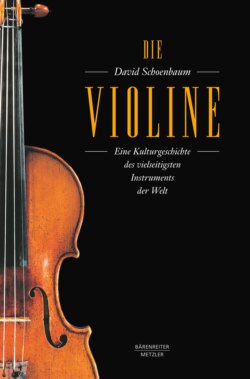Читать книгу Die Violine - David Schoenbaum - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
|148| BUCH II
Der Geigenhandel
ОглавлениеInzwischen ging der Handel seine eigenen Wege. »Nur der geborene Geigenhändler ist wirklich ein Geigenhändler«, konstatierte Albert Berr im Rückblick auf sein erfahrungsreiches Leben in der Branche.1 Zwar gab es von Tarisio bis zu Robert Bein und Geoffrey Fushi bemerkenswerte Ausnahmen. Doch war es zumindest von Vorteil, als ein Chanot, Hill, Hamma oder Beare geboren worden zu sein. Allerdings lässt sich Berrs Aussage auf alle möglichen Kompetenzen und Talente beziehen, beispielsweise auf eine Begabung für Mathematik, für Sprachen oder gar für Musik, die jeder unabhängig von seiner Abstammung mitbringen konnte. George Hart hatte diese Begabung, ebenso William Ebsworth Hill, trotz seines Hangs zu dem, was Haweis als eine »seltsame Art von innerem Anderswo-Sein« bezeichnete,2 und was für den Patrizier Hart unvorstellbar war.3 Aber auch David Laurie, ein ehemaliger Seemann, Händler in galvanisierten Artikeln und Vater von 18 Kindern, hatte dieses gewisse Etwas. Seine Tochter erinnerte sich, dass er einen erfolgreichen Handel mit Erdöl aufgab, um eine »viel interessantere, wenn auch weniger einträgliche« Karriere in der »Fiedeljagd« zu verfolgen.4
Laurie, als Großhändler ein Selfmademan, war »in keiner Weise durch Tradition mit unserem Beruf verbunden«5, wie die Söhne der Gebrüder Hill |149| kühl über einen Mann schrieben, den sie in den frühen 1890er-Jahren sogar vor Gericht zogen.6 Doch sogar sie gestanden Laurie den »ausgeprägten Geschäftssinn und die außerordentliche Energie« zu, die zu dessen »Einführung in einige der besten Beispiele von Stradivaris Genie« führten.7 Ein Jahrhundert später erstreckte sich das Händlerspektrum von Absolventen britischer Eliteanstalten bis zu amerikanischen Studienabbrechern. Darunter gab es auch Frauen, eine Neuerung, die auf ihre Weise ebenso sensationell war wie die Zulassung von Frauen zu Militärakademien.
Die besten von ihnen verfügten über die Geduld eines Zen-Meisters, das Durchhaltevermögen eines Langstreckenläufers, die Nerven eines Kasino-Hasardeurs und das Verhandlungsgeschick eines Henry Kissinger. Giovanni Morelli, ein Pionier in der Kunstgeschichte, konnte die Kopie eines Gemäldes von Botticelli anhand der Neigung eines Ohrläppchens oder der Drehung eines Fingernagels vom Original unterscheiden.8 Ein geborener Geigenhändler konnte ein Strad-Original und seine Kopie anhand einer nur ganz geringfügig differierenden Krümmung eines F-Loches oder einer Ecke auseinanderhalten und sich Instrumente in derselben Weise merken wie Politiker Gesichter.
Politisches Geschick war ein weiterer Teil des Pakets. Je nach Zeit und Ort konnten Händler ihre Kunden als Künstler, Investoren, angehende Gönner – »ziemlich seltsame Menschen, die denken, es wäre nett, eine Strad zu erwerben, nachdem sie plötzlich reich geworden sind«9 – oder als leichte Beute ansehen. Sie konnten die Geigenlehrer, die ihnen zwar zu Geschäften verhalfen, dafür aber auch Provisionen erwarteten, für erfolgreiche Geschäftsleute oder für Schakale halten. Sie konnten in ihren Konkurrenten Schurken und Scharlatane sehen und den Markt als einen Krieg aller gegen alle empfinden. Der Drang zum souveränen Alleingang lag in ständigem Widerstreit zur Unvermeidlichkeit von Zweckbündnissen. »Politik ist kein Kinderspiel«, sagte Finley Peter Dunnes legendärer Kneipenwirt Mr. Dooley in Chicago.10 Der Handel mit Violinen war es ebenso wenig. Dennoch war jemand, der nicht über die »einzigartige Liebe zu einer Geige um ihrer selbst willen, als ein Gegenstand von Schönheit, Wunder, Geheimnis« verfügte, die Haweis W. E. Hill zugeschrieben hatte, schwerlich als bedeutender Händler vorstellbar.11
Außenstehende waren davon ebenso geblendet wie verwirrt. Haweis, der englische Pfarrer, der die Violine kannte und liebte wie kaum ein anderer seiner Zeit, machte sich über den Handel keine Illusionen und hielt Händler für »eine Spezies von Menschen, die von Natur aus geldgierig sind«.12 »Nach langen Jahren«, so schrieb er, »bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es drei Dinge gibt, bei denen ein durchschnittlich ehrlicher Mann überhaupt keine Skrupel kennt – das erste ist ein Pferd, das zweite ein Regenschirm und das dritte eine Geige.«13 Für historisch Interessierte ähnelte der Handel nichts so sehr wie dem Heiligen Römischen Reich. Mit den bedeutenden Händlern und Auktionshäusern hatte |150| er seinen Adel, mit den Familienunternehmen sein Bürgertum und den Dritten Stand mit Beratern, Zwischenhändlern und Orchestermusikern, die als Nebenbeschäftigung die Ware aus dem Kofferraum ihres Autos heraus anboten. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts tauchen Geigen sogar bei eBay auf.
Ebenso wie das Reich war die Branche gleichzeitig hierarchisch, anarchisch und expansiv und hatte mit Vuillaume, den Gebrüdern Hill, Rembert Wurlitzer und Charles Beare ihre Kaiser, deren Bescheinigungen eine nahezu päpstliche Unfehlbarkeit genossen. Ihre Kurfürsten kamen aus einer Handvoll von Geschäften, die mit Spitzeninstrumenten handelten und zunehmend in der ganzen Welt präsent waren. Sie hatte ihr Parlament in der Entente internationale des maîtres luthiers et archetiers d’art, die in den 1950er-Jahren von einer Gruppe von Geigenbauern und -händlern als Reaktion auf eine Serie von Skandalen gegründet wurde. Sie hatte ihre Welfen und Staufer, die in einer andauernden und unerbittlichen Rivalität ineinander verbissen waren, sowie ihre De-facto-Zusammenschlüsse von größeren und kleineren Unternehmen. Sie hatte sogar ihre eigene Version von »cuius regio, eius religio«. Arthur Bultitude, der legendäre Bogenmacher der Hills, erinnerte sich am Ende seiner bemerkenswerten Karriere an sein Vorstellungsgespräch bei Alfred Hill im Jahr 1922. War sein Vater ehrlich, nüchtern und fleißig – so wurde der 14-jährige Bultitude gefragt? Gehörte die Familie der Church of England an?14 Einige Generationen später umrahmte Geoffrey Fushi seinen Schreibtisch sowohl mit den Monografien der Hills als auch dem Gesamtwerk von L. Ron Hubbard, betonte häufig und gern, wie die von Hubbard gegründete Church of Scientology zu seinem Erfolg und dem seines Partners Robert Bein beigetragen hatte,15 und legte ihre Werte neuen Mitarbeitern ans Herz.
Niemand konnte voraussagen, ob der Geigenhandel wie das Heilige Römische Reich 1 000 Jahre fortbestehen würde. Bein, der im Reich der Violine sicherlich zu den Kurfürsten zu zählen war, sah das Endspiel bereits im Jahr 2001 voraus, zumindest dort, wo das Spiel als die Jagd nach alten italienischen Instrumenten verstanden wurde, die den Handel seit dem frühen 19. Jahrhundert beherrscht hatte.16 Aber trotz Problemen mit seiner Glaubwürdigkeit und mit dem Pernambukholz versprach der seit fast 500 Jahren bestehende Handel, zumindest das Weströmische Reich (31 v. Chr. bis 476 n. Chr.) einzuholen.
Statik und Dynamik des Geigenhandels waren so kompliziert wie seine Verfassung. Je nachdem konnte man perfekten wie imperfekten Wettbewerb, Oligopol, Grenznutzen und sogar vernünftige Erwartungen erkennen, aber auch eine Geschichte von Praktiken, in denen der deutsche Kritiker Arnold Ehrlich bereits im Jahr 1899 »eine frappante Aehnlichkeit mit Betrug« erkannte,17 als er gegenüber den bescheidenen Preisen für neue Instrumente einen starken Kursanstieg für alte Violinen feststellte. Tatsächlich waren viele davon keineswegs italienische, sondern gute deutsche Kopien, und es gab keinerlei Hinweise |151| darauf, dass Kritiker oder Publikum einen Unterschied hörten. Selbstverständlich achteten Spieler auf den Ton, doch waren es Sammler, nicht Spieler, die den Ton angaben. Was zählte, war die Echtheit, erst dann kamen Aussehen und Erhaltungszustand, während der Ton kaum eine Rolle spielte.18 1932 beschied der Händler Alfred Hill einem amerikanischen Kunden: »Ein Instrument, das zwar erstklassige Klangqualität besitzt, jedoch bei der Schönheit der Form Mängel an Holz oder Lack aufweist, verkauft sich unendlich schwieriger als eines mit einem attraktiven Aussehen.«19 »Ich habe gesehen, dass sich Sammler eine Strad, die sie kaufen wollten, stundenlang ansahen«, erinnerte sich der Geiger Henri Temianka in den 1970er-Jahren, »aber nie darum baten, sie zu hören«.20
Stradivari und der jüngere Giuseppe Guarneri waren der magnetische Nordpol des Handels. Seit dem frühen 19. Jahrhundert wurden besonders Strad-Modelle weithin mit derselben Unbekümmertheit kopiert, mit der Chinesen eine Epoche später Apple, Starbucks und Kentucky Fried Chicken kopieren würden. Der Katalog des amerikanischen Versandhauses Sears Roebuck bot 1902 »eines unserer original Stradivari-Violinen Modelle«, komplett mit Randeinlagen, für 8 Dollar an. Das »besonders hochwertige original Stradivari-Modell« war für 20 Dollar zu haben.21 Ein Jahrhundert später tauchten die Nachwirkungen immer noch auf der Website des National Music Museum in Vermillion, South Dakota, auf, wo ein steter Strom von Besuchern hoffnungsvoll wissen wollte, ob die Geige mit dem Stradivari-Zettel, die sie soeben unter ihrem Bett oder auf dem Dachboden entdeckt hatten, vielleicht doch eine Strad sei.22 Die Antwort war stets taktvoll, aber selten ermutigend.
In der Zwischenzeit waren die Instrumente der beiden Meister seit zweieinhalb Jahrhunderten durch die Hände von Virtuosen von Spanien bis zum Schwarzen Meer, französischer Adeliger »de l’épée«, »de la robe« und »parvenue«, des englischen Adels des 18. und der oberen Mittelschicht des 19. Jahrhunderts, russischer Großfürsten und mitteleuropäischer Bildungsbürger gegangen. Die kommunistischen Regime in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn waren begierig, ihre knappen Reserven in harter Währung in eine Strad zu investieren, wenn es dazu verhelfen würde, einen einheimischen Spieler im internationalen Wettbewerb nach vorn zu bringen.23 Im Jahr 1995 versammelte das Metropolitan Museum in New York für eine Ausstellung 25 Guarneris unter einem Dach. Unter ihren Besitzern waren zwei der großen Künstler des Jahrhunderts, der Erbe eines mexikanischen Stahlvermögens, ein Vizepräsident von Microsoft, ein Investor und Sammler aus Chicago, ein Gewinner des Lasker-Preises – eines der renommiertesten medizinischen Forschungspreise der Welt –, der Vorsitzende der nationalen Kommission für Arthritis, Museen in San Francisco und Taipeh und eine japanische Stiftung, deren Gründer im Zweiten Weltkrieg dabei geholfen hatte, die Mandschurei zu kolonialisieren, nach dem Krieg drei Jahre als Kriegsverbrecher der A-Klasse im Gefängnis saß und dann |152| mit Motorboot-Rennen ein neues Vermögen machte.24 Der Weg zum Erwerb dieser Instrumente konnte so lässig sein wie eine Fahrt zum Supermarkt oder so aufwendig wie eine dynastische Hochzeit. Gelegentlich nahm er auch die Form einer Schießerei an, zu der sich mehrere Verkäufer mit jeweils einer Strad in der Hand versammelten. Der Vorteil lag hier ausnahmsweise bei dem voraussichtlichen Käufer, und der Verkauf wurde mit dem Händler abgeschlossen, der als Letzter noch aufrecht stand.
Dietmar Machold war besonders stolz auf einen Verkauf, der mit dem Anruf einer angeblichen Speditionsfirma in West-Berlin begann, die ihm mitteilte, dass die Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea) sich nach einer Strad umsah. Unbeeindruckt von der Wahrscheinlichkeit, dass westliche Geheimdienste sein ungesichertes Telefon abhörten, versprach er, zur festgesetzten Zeit am vereinbarten Ort mit einer Strad und Roger Hargrave – zu dieser Zeit sein Restaurator – zu erscheinen. Eine große schwarze Limousine holte die beiden am berühmten Checkpoint Charlie ab und brachte sie auf die andere Seite der Mauer. Bei ihrer Ankunft in der nordkoreanischen Botschaft stellten sie fest, dass sieben Mitbewerber und der Konzertmeister des Philharmonischen Orchesters Pjöngjang schon da waren. Aber es war Machold, der den Zuschlag erhielt und bar bezahlt wurde, da die Koreaner anscheinend entschieden hatten, dass Beare – sein Konkurrent aus London – zu wenig verlangte. Ein paar Jahre später, als Tausende von Nordkoreanern hungerten und die Preise für Geigen weltweit in die Höhe schossen, weigerte sich der Staat immer noch zu verkaufen und schickte seine Strad weiterhin zu Machold in Tokio zur planmäßigen Wartung.25 Sollte die CIA damals tatsächlich mitgehört haben, gab es offenbar keinen Unmut, als Machold Mitte der 1990er-Jahre ein Geschäft in New York eröffnete.
Im Jahr 2006 zog Beare gleich, als Jerry Kohl, ein Amateurgitarrist, der sein Vermögen mit Lederwaren der Luxusklasse gemacht hatte, entschied, dass er statt des Gemäldes von Mark Rothko, das seiner Tochter so gut gefiel, lieber eine Strad besitzen wollte. Nach dreimonatigen Recherchen und Anfragen lud er Vertreter von Beare, Bein & Fushi und Machold ein, ihm zu zeigen, was sie hatten. Sie brachten ihm insgesamt acht Geigen. Kohl selbst fügte noch eine neunte hinzu, die dem Komiker Jack Benny gehört hatte und erst vor Kurzem auf den Markt gekommen war. Dann arrangierte er, dass die Konzertmeister des Los Angeles Philharmonic Orchestra und des Los Angeles Chamber Orchestra die Instrumente über acht Stunden in der neuen Disney Hall eines nach dem anderen vorspielten. In die engere Wahl kamen die »Maria Teresa« von 1712, die fast ein halbes Jahrhundert lang im Besitz der Familie des großen Nathan Milstein gewesen und dann zu Beare gelangt war, und die »Herzog von Alba« von 1719, die Bein & Fushi anvertraut worden war. Am Ende gewann Beare, angeblich mit einem Festpreis von acht Millionen Dollar. »Meine Kinder besitzen nun einen Teil der Geschichte«, äußerte Kohl zufrieden in einem Interview.26
|153| Bei derartigen Verhandlungen sind Provisionen oder Beratergebühren nicht ungewöhnlich, wobei Beare anmerkt, dass in Geschäften mit Japanern aus den üblichen zwei oder drei Kiebitzen leicht zehn werden können.27 Doch sind auch Geschäfte ohne Vermittlung bekannt. Emil Herrmann, vor und nach dem Zweiten Weltkrieg ein großer Händler in New York, verkaufte die »Bayerische« Strad von 1720 praktisch über den Ladentisch an eine New Yorker Bankierstochter, die das Geigenspiel erlernen wollte und dachte, dass eine Strad hierfür ganz nett wäre.28 Einige Jahre später machte Hargrave, der in Bremen für Machold arbeitete, eine ähnliche Erfahrung, als ein Bestatter aus Nashville in seinem Laden vorbeikam, nach einer Strad fragte, auf ihr »The Orange Blossom Special« herunterfiedelte und mit dem, was er hörte, zufrieden war. Dann öffnete er einen Koffer voll mit Dollarnoten, bezahlte seinen Kauf in bar und erkundigte sich nach einem preiswerten Hotel.29
Unabhängig davon, ob der Verkauf nun einfach oder seltsam war, galt es doch als eine Tatsache, wie Beares Mitarbeiterin Frances Gillham anmerkte, dass der Preis für eine del Gesù im Vergleich zu Kunstobjekten in Sammlerqualität »Spucke im Wind« war.30 Doch ist eine Strad immer noch in erster Linie ein Werkzeug, das im Prinzip gleichwertig mit einem Hammer oder einem Traktor ist und ebenso anfällig für Verschleiß. Was sie, trotz ihrer Wurzeln als Gebrauchsgegenstand, zu einem Kunstobjekt werden ließ, waren Geschick, Handwerkskunst und eine Beziehung zur Kultur, die zusammen ausreichten, sie auf das Preisniveau eines Spitzen-Rennpferdes oder einer Seite mit einer ersten Skizze von Beethovens Neunter zu bringen.31 Das war immer noch deutlich weniger als ein Mantegna für 28,5 Millionen Dollar, ganz zu schweigen von Edvard Munchs Der Schrei für 119,9 Millionen.32 Doch in der Welt privater Gegenstände und Besitztümer gab es nichts, das sich mit einer Stradivari-Geige messen konnte, außer einem noch selteneren Strad-Cello oder – am seltensten von allen – einer Strad-Bratsche.
Zugegeben: Ein Preisvergleich ist immer problematisch. Aber das Verhältnis von Strads zum aktuellen Immobilienwert gibt zumindest einen brauchbaren Maßstab an die Hand. Nach seinem Tod im Jahr 1737 hinterließ Stradivari zweien seiner Söhne jeweils einen Satz von sechs Violinen, von denen jeder mit 1.000 Lire – also etwa 170 Lire pro Instrument – bewertet wurde. Ein halbes Jahrhundert zuvor hatte Stradivaris Haus 7.000 Lire gekostet.33 Da keinerlei Hinweise auf eine signifikante Inflation in den dazwischenliegenden Jahren vorliegen, ergibt dies ein Verhältnis von Haus zu Violine von etwa 1 zu 42. Vuillaume bezahlte 1843 den Preis von 38.000 Francs für die Immobilie in einem Vorort von Paris, die er schließlich im Ruhestand bezog und die aus einem dreistöckigen Haus mit einem Ladengeschäft, Pförtnerloge, Stall und einem Garten mit einem kleinen Häuschen bestand. Ein Jahr später verkaufte sein Konkurrent Gand dem Geiger und Tänzer Arthur Saint-Léon eine Strad für 2.600 Francs, |154| was einem Verhältnis von Haus zu Violine von etwas weniger als 1 zu 15 entspricht.34 Der Baseball-Profi Derek Jeter, von 1996 bis 2014 eine Stütze der New Yorker Yankees, baute an der Tampa Bay in Florida ein Haus mit sieben Zimmern für geschätzte 7,7 Millionen Dollar.35 Zu dieser Zeit hatte Kohl für seine Strad 8 Millionen bezahlt.
Doch auch 1 zu 1 blieb eine veränderliche Größe. Als die »Lady Blunt« innerhalb von knapp 40 Jahren zum dritten Mal versteigert wurde, zahlte ein anonymer Käufer im Juni 2011 15,9 Millionen Dollar – ein neuer Rekord. Die auf 6 Millionen Dollar geschätzte »La Pucelle«, die ihre Verkäuferin Huguette Clark – Tochter des Senators William Andrews Clark aus Montana und seiner Frau, der Sammlerin Anna Clark – als Geschenk zum 50. Geburtstag bekommen hatte, ging indessen an den Sammler Dave Fulton. Als Clark 2011 im Alter von 104 Jahren starb und ihre Wohnung verkauft werden sollte, stand damit in Manhattan zum ersten Mal seit 1925 ein Apartment im zwölften Stock zum Verkauf. Mit seinem fürstlichen Blick über den Central Park wurde erwartet, dass es bis zu 25 Millionen Dollar erbringen würde.36
Ältere Orchestermusiker, die das Glück hatten, Mitte des 20. Jahrhunderts alte Instrumente gekauft zu haben, und sich am Markt des späten 20. Jahrhunderts erfreuen konnten, wandelten im Ruhestand ihre Instrumente in Eigentumswohnungen in Florida um. Ihre Nachfolger, die sich um Geld oder Kredite bemühen mussten, um das zu erwerben, was ihre Vorgänger zu Geld gemacht hatten, erbaten die Hilfe ihrer Eltern, die daraufhin zweite Hypotheken auf ihre Häuser aufnahmen.37
Von einer »Alchemie aus Form, Ton und italienischer Abstammung, in der sich Dichtung und Wahrheit auf eine köstliche Weise vermischen und die zu gleichen Teilen von einem florierenden Handel und dem unschuldigen und unerschöpflichen Wunsch des Zuhörers, zu träumen, getragen wird«38, sprach Marie-France Calas, Direktorin des Pariser Musée de la Musique im Jahr 1998 aus Anlass der Ausstellung, mit der an den 200. Jahrestag der Geburt von Vuillaume, dem Vater des modernen Geigenhandels, erinnert werden sollte. Sie war nicht die Erste, die diese Verbindungen entdeckte, doch brauchte es offenbar eine gebildete französische Außenseiterin, um es so elegant in Worte zu fassen.