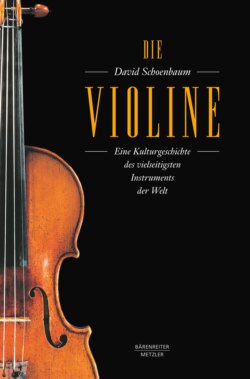Читать книгу Die Violine - David Schoenbaum - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
|20| BUCH I
Geigenbau
ОглавлениеAn Materialien über das, was der Musikwissenschaftler David Boyden die »faszinierende, geheimnisvolle und unergründliche Welt der Violine«1 nannte, mangelt es nicht. Eine Suche nach dem Stichwort »Violine« im Online-Katalog der Library of Congress im Sommer 2002 ergab 9976 Treffer und eine nachfolgende Suche im umfangreicheren Research Libraries Information Network 104881 Titel. Eine Google-Recherche führte von A wie Alf bis zu Z wie Zygmuntowicz und zeigte damit jede nur vorstellbare Dimension des Einflusses, den das Instrument und die Menschen, die mit ihm verbunden sind, hatten und haben. Unter 855 Nennungen waren Geigenbauer, Geigenhändler und Bogenmacher jedweder Art und Qualität, Geiger mit einem Repertoire von Barock bis Bluegrass, Geigenlehrer für jedes Alter und Niveau, Zulieferer mit Waren wie Pferdehaar, aber auch Dienstleister mit Angeboten von Massage bis hin zu endoskopischer Operation, Museumssammlungen, Online-Auktionen, bildliche Darstellungen, Listen von Einspielungen, aber auch von gestohlenen Instrumenten, Letztere überwiegend mit Tonbeispielen, hochauflösenden Darstellungen und Links zu weiteren Webseiten, die meisten davon in englischer Sprache.
Auch jede ernst zu nehmende Forschungsbibliothek bietet Monografien, Handbücher, Methoden, Memoiren, medizinischen Rat und Kataloge an. Es gibt |21| Ratgeber-Literatur, von Dr. Suzuki »Twinkle, Twinkle« für Kleinkinder bis hin zu Heinrich Wilhelm Ernsts polyphonen Studien für die Violine – eine Abhandlung für die Olympiasieger und Wimbledon-Gewinner unter den Geigern. Es gibt Geschichten und Romane, von Lloyd Moss’ Zin! Zin! Zin! A Violin2 für Leser von vier bis acht Jahren bis hin zu schaurigen und nicht immer jugendfreien Geschichten. Es gibt Gerichtsakten und Preislisten, die mindestens bis ins 19. Jahrhundert und Geigerbiografien und Geigengeschichten, die bis ins 17. Jahrhundert zurückgehen. Wachszylinder-Aufnahmen von Joseph Joachim (1831–1907) und Maud Powell (1868–1920) sind auf CD und CD-ROM erhältlich und kurze musikalische Impressionen von Fritz Kreisler (1875–1962) und Eugène Ysaÿe (1858–1931) – gefilmt in der Ära von Rudolph Valentino – sowie Das Kabinett des Dr. Caligari auf VHS, DVD und You Tube. Die Ursprünge der Violine jedoch bleiben weiterhin so dunkel und vieldeutig, wie sie es für Laborde waren.
Trotz größter Bemühungen der jeweiligen Autoren können allerdings die wenigsten Titel zum Thema als zuverlässig gelten. Die Frage nach Ursprung und Entwicklung der Violine hat bahnbrechende Forscher – von François-Joseph Fétis, dem Universalgelehrten des 19. Jahrhunderts und Mitbegründer des Brüsseler Konservatoriums, bis zu Curt Sachs, dem Vater der modernen Instrumentenkunde ein Jahrhundert später – beschäftigt, fasziniert und verwirrt. Sie war für George Hart, den großen viktorianischen Experten und wichtigen Londoner Geigenhändler, ebenso von Interesse wie für Amateure wie Pfarrer H. R. Haweis und den Schriftsteller Charles Reade, der das Thema mit der gleichen Begeisterung verfolgte, die seine Zeitgenossen Thomas Henry Huxley und Bischof Samuel Wilberforce zum Artenursprung führte. Fétis in Brüssel und Joseph Joachim in Berlin sorgten dafür, dass die neuen Musikhochschulen Instrumente genauso selbstverständlich erwarben wie die neuen Museen Knochen, Fossilien und Gesteine. Konstantin Tretjakow, als Industrieller, Sammler und Philanthrop ein Vorreiter, stiftete dem Direktor des Moskauer Konservatoriums, Nikolai Rubinstein, nicht nur mehr als 30 alte italienische Instrumente, sondern gab bei den französischen Geigenbauern Georges Chanot und Auguste Bernardel auch neue in Auftrag.3
Im Jahr 1872 erschien ein großer Teil der achtbaren Bürger Englands in dem, was bald das Londoner Victoria and Albert Museum (V & A) werden sollte, um eine richtungsweisende Ausstellung über den europäischen Geigenbau vor 1800 zu sehen und dort gesehen zu werden. Das Organisationskomitee bestand aus 45 Honoratioren, darunter der zweite Sohn der Königin, der Herzog von Edinburgh, Jean-Baptiste Vuillaume, der große französische Geigenbauer, der Komponist Sir Arthur Sullivan und Ambroise Thomas, Direktor des Konservatoriums von Paris. Für diejenigen, die nicht dabei sein konnten, beauftragte die Abendzeitung Pall Mall Gazette Charles Reade, über das Ereignis so umfangreich zu berichten, dass seine Beschreibung später als Buch erschien. Ein |22| Jahrhundert später kündigte das Museum an, seine Sammlung auf andere Museen zu verteilen oder dauerhaft auszulagern, um Platz für die wachsende Kostüm- und Modeabteilung des V & A zu schaffen.4
Der Ankauf der Violinen-Sammlung belegt das Ausmaß des öffentlichen Interesses im viktorianischen Zeitalter. Als Carl Engel, ein wohlhabender deutscher Kunstsammler und Amateur-Musikhistoriker, 1882 in London starb, hinterließ er 201 Instrumente, unter Ihnen Dudelsäcke aus Northumberland, eine spanische Bandurria, eine norwegische Hardanger-Fiedel, eine Sammlung von Violen, das, was man für eine deutsche Geige aus dem 16. Jahrhundert hielt,5 sowie eine unveröffentlichte Studie über die Violine und ihre Vorläufer. Sein Nachlassverwalter und Neffe Carl Peters, dem es zwar nicht gelang, als Schwimmer den Ärmelkanal zu überwinden, der später aber mit einigem Erfolg in Ostafrika ein deutsches Kolonialreich aufbaute, sorgte dafür, dass die Studie publiziert wurde.6 Dann verkaufte er »das Zeug«, wie der Geigenbauer, Restaurator und Historiker John Dilworth es einige Generationen später nennen sollte,7 an das Victoria and Albert Museum. Für den Kaufpreis von 556 Pfund und 6 Schilling hätte man zu der Zeit eine Stradivari erwerben können.8
Noch 100 Jahre später war die Sammlung eine Herausforderung für die Wissenschaft. Die Quellen selbst waren nur eines der Probleme. Sie bestanden aus Instrumenten, Teilen von Instrumenten, einer Auswahl von Möbeln, Textverweisen in den verschiedensten Sprachen, Abbildungen in buchstäblich jedem Medium mit Ausnahme der Fotografie und waren über weite Teile Europas verstreut wie eiszeitliche Moränen. Ein weiteres Problem war die Qualifikation der Historiker. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hatten sich zwar alle möglichen Disziplinen professionalisiert: politische Geschichte, mittelalterliche Geschichte, Kunstgeschichte, Geologie, Paläontologie, Chemie; aber die Geschichte der Violinen, die seit dem späten 18. Jahrhundert die Domäne von Handwerkern und Händlern war, lag bis weit in das 20. Jahrhundert hinein immer noch in den Händen von Amateuren.
Die Verknüpfung von Werkbank-Perspektive und der Begeisterung von Amateuren hinterließ dauerhafte Spuren. Forschungspioniere, deren Lebensspanne vom Niedergang des Ancien Régime bis zum Erscheinen von Eisenbahn und Fernschreiber reichte, ließen sich von der Herrlichkeit einer immer noch frischen Cremoneser Vergangenheit und den Risiken und Chancen der turbulenten Pariser Gegenwart beflügeln und bereiteten den Weg zur Geschichte der Violine.
Der Hofbeamte Laborde, der 1794 ein Opfer der Guillotine wurde, stellte eine Anthologie über das bisher Bekannte zusammen. Sébastien-André Sibire, ein Geistlicher, der für die letzte Messe von König Louis XV. das notwendige liturgische Gerät besorgte und die französische Revolution überlebte,9 veröffentlichte für ein Publikum, das die Wiederaufnahme einer Verbindung mit der großen italienischen Tradition mindestens genauso ernst nahm wie Napoleons |23| Siege, La Chélonomie ou Le Parfait Luthier,10 einen Essay über den Geigenbau. Fétis, der die Musikwelt seiner Zeit in- und auswendig kannte, hinterließ Monografien über Paganini und Jean-Baptiste Vuillaume, den Superstar der Geigenbauer und -händler,11 dessen dubioser Ruf ungefähr dem Bild entsprach, das Mason Locke Weems von George Washington oder William Herndon von seinem ehemaligen Kompagnon Abraham Lincoln hinterließen. Doch im Gegensatz zu diesem ersten Trio, das auf seine Weise Geschichte schrieb, war es ein zweites Trio, bestehend aus Ignazio Cozio di Salabue (1755–1840), Luigi Tarisio (ca. 1790–1854) und Vuillaume (1798–1875), das Geschichte machte.
Der junge Graf Cozio, Grundbesitzer im Piemont, erbte im Jahr 1771 von seinem Vater eine bemerkenswerte Kollektion klassischer Instrumente, ein Ereignis, das ihn zu einem der wichtigsten Sammler machte. Mit seinem lebhaften Interesse an Handel und Geschäften war er fest entschlossen, alles Wissenswerte über die großen Geigenbauer aus Cremona und ihre Werkstätten in Erfahrung zu bringen, solange es noch eine lebendige Erinnerung an sie gab.
Als Cozios Interesse im Jahr 1824 erlahmte, begann der gleichermaßen besessene Luigi Tarisio, der aus einer Familie stammte, die ebenso proletarisch war wie die von Cozio patrizisch, Stücke aus Cozios Sammlung zu erwerben. Diese und so viele weitere klassische Instrumente, wie er nur auftreiben konnte, brachte er von 1827 bis zu seinem Tod im Jahr 1854 auf den Pariser Markt.12 Seine Strategie war zeitlos und einfach: Kaufe billig in Italien, wo die Instrumente wenig Wert haben, und verkaufe nördlich der Alpen teuer, wo Händler nicht genug von ihnen bekommen können. Was geschehen wäre, hätte sich Cozio direkt nach dem Besuch der Militärakademie der lokalen Geschichte des Piemont, die seine Altersleidenschaft wurde,13 zugewandt oder wäre Tarisio unterwegs von Mailand nach Paris von einer Postkutsche überfahren worden, ist das Gegenstück der Violinwelt zu der Frage, was wohl geschehen wäre, hätten die Franzosen bei Waterloo oder die Südstaaten bei Gettysburg gewonnen.
Der Geigenbau war »vielleicht das einzige Handwerk auf der Welt, in dem das Alte durchgängiger bewundert wird als das Neue und die Instandhaltung schwieriger ist als der Bau«,14 so zitierte Sibire den großen französischen Geigenbauer Nicolas Lupot (1758–1824). Seit Tarisio wurde die Geschichte der Violine, wie sie von ihm selbst und Cozio zusammengestellt und interpretiert wurde, zur Richtschnur und wie ein Familienalbum von Händler zu Händler und von Generation zu Generation weitergereicht. Ihre Vision spiegelte zwangsläufig ihr eigenes Zeitalter der einsamen Helden, der aufstrebenden Nationen und der ehrerbietigen Betrachtung des Italiens der Renaissance wider. Es sollte ein Jahrhundert vergehen, bevor diese Deutung ernsthaft in Frage gestellt wurde. Noch im Jahr 1984 schrieb der Herausgeber eines ansonsten ernst zu nehmenden Handbuchs die Erfindung der Geige einem »unbekannten italienischen Genie, irgendwo in der Nähe von Mailand« zu, das die erste Geige |24| irgendwann »im frühen 16. Jahrhundert konzipierte und baute«,15 und noch im Jahr 2002 zeigte eine von Google angegebene Webseite eine hochauflösende Ansicht der »berühmten Dom-Apsis im Geburtsort der Violine, Cremona«.16
In der Zwischenzeit kam durch neue Forschungen ein ganzes Aufgebot mutmaßlicher Erfinder hinzu – einige von ihnen berühmt, andere nicht. Unter ihnen befanden sich die Stammväter Gasparo Bertolotti, auch bekannt als da Salò (1540–1609) aus Brescia, Andrea Amati17 (ca. 1505–1577) aus Cremona, Caspar Tieffenbrucker (1514–ca. 1571) aus Bayern (den Franzosen und Italienern als Gaspard Duiffoprugcar bekannt) und der Bretone Jean Kerlino, der vielleicht eine Erfindung von Vuillaume war.18 Im frühen 20. Jahrhundert schrieb ein Kommentator dazu: »Besser überhaupt keine Fakten als fadenscheinige«.19 Mit der Zeit folgten auf Cozio und Tarisio wirklich bedeutende Fachleute, auch wenn sie nicht Historiker von Beruf waren. Margaret Lindsay Murray, die gemeinsam mit ihrem Mann, Sir William Huggins, Pionierarbeit auf dem Gebiet der astronomischen Spektroskopie leistete, schrieb eine bahnbrechende Monografie über den Geigenbauer Giovanni Paolo Maggini (ca. 1580–ca. 1630) aus Brescia.20
Brian Harvey, Professor an der University of Birmingham und Verfasser des Standardtextes zum Auktionsrecht, legte – angeregt durch seine Begeisterung für ein geerbtes Cello – eine vorbildliche Sozialgeschichte der Violine in Großbritannien vor und war Mitautor eines Standardwerkes über Violinbetrug.21 Ein ähnliches Interesse für sein eigenes Instrument führte Duane Rosengard, Kontrabassist im Philadelphia Orchestra, zur Entdeckung des Testaments des großen Antonio Stradivari und einer wegweisenden Biografie von Giovanni Battista Guadagnini (1711–1786).22 Andere hingegen schrieben die Geschichte der Violine aus lokaler Sicht. Carlo Bonetti, ein pensionierter Armeeoffizier, grub archivalische Dokumente zu Stradivari aus, die seit 400 Jahren niemand gesehen hatte.23 Bernhard Zoebisch, Zahnarzt in Markneukirchen, stellte eine vorbildliche Geschichte des Geigenbaus im Vogtland zusammen.24
Am Vorabend des 20. Jahrhunderts begründeten die drei Gebrüder Hill aus London, die herausragendsten Geigenhändler ihrer Zeit, mit einer Reihe liebevoll hergestellter und illustrierter Monografien über die Titanen der Zunft eine neue wissenschaftliche Epoche. Von dieser Serie, die direkt an Abonnenten verkauft wurde, waren noch ein Jahrhundert später Exemplare als Taschenbuch erhältlich, sie stehen heute im Bücherregal jedes ernst zu nehmenden Geigenbauers.25 Damit wurde die mündliche Überlieferung zum ersten Mal durch eine Archivrecherche ersetzt, die überwiegend von eigens dazu angestellten Wissenschaftlern durchgeführt wurde. Ein weiteres Novum lag darin, dass die Hills ihre eigenen Verleger waren. Ihre Nachfolger machten die Gattung der Abonnenten-Monografien dann als Nachschlagewerke oder Sammelobjekte zum Standardinventar für Musikliebhaber.
|25| Der erste Band der Hill-Reihe erschien 1892 und war an Lady Huggins als Autorin vergeben worden, deren dankbare Auftraggeber in Anerkennung ihrer Arbeit eine Stradivari von 1707 nach ihr benannten.26 Die weiteren Bände schrieben die Gebrüder Hill selber, 1902 den Band zu Stradivari und 1931 den zu den Guarneris. Seit dem Bau der Instrumente wurde damit zum ersten Mal deren »wahlloser Missbrauch«, der »unglücklicherweise zu der Zeit der letzte Schrei war«, wie ein Italiener ein Jahrhundert später anmerkte, nicht nur bedauert, sondern auch dokumentiert.27 Ein Band über die Amatis war offenbar geplant, ist aber nie erschienen.28
Der nächste Schritt, der an die Schwelle der akademischen Geschichtsschreibung führte, musste noch eine weitere Generation warten. Im Jahr 1965 veröffentlichte David Boyden, Musikwissenschaftler an der University of California, The History of Violin Playing from Its Origins to 1761, eine einfallsreich belegte, fantasievoll dargestellte und gewinnbringend geschriebene Übersicht über Violine, Bogen, Bauer, Spieler, Komponisten, Markt und Publikum, ein Buch, das sich über die dokumentierten frühesten Anfänge bis zur Einführung des modernen Bogens erstreckte und eine weitere Epoche einleitete. Eine weitere Generation später porträtierte Sylvette Milliot, eine Musikwissenschaftlerin, die unter dem Einfluss der französischen Annales-Schule für Geschichtswissenschaften ausgebildet worden war, mehrere Epochen der französischen Geschichte anhand von mehreren Generationen der Geigenbauerfamilie Chanot-Chardons.29 Doch niemand machte es ihr nach.
Stattdessen – so bemerkte John Dilworth – blieb die Geschichte der Violine die Domäne von drei Gruppen, die auf unterschiedlichen Wegen zu je eigenen Ergebnissen gelangt waren und sich deshalb zwar ergänzten, in wesentlichen Punkten aber widersprachen.30 Die erste und älteste dieser Richtungen, die sich von Vuillaume bis Charles Beare, einem Vorzeigehändler des späteren 20. Jahrhunderts, und Philip J. Kass, einem freiberuflichen Experten und Gutachter, der am Curtis Institute in Philadelphia unterrichtet, erstreckte, stammte direkt aus dem Handel. Die zweite bestand aus relativen Neulingen wie Dilworth und seinen englischen Zeitgenossen Roger Hargrave und Andrew Dipper, die alle Geigenbauer, Kopisten und Restauratoren sind. Die dritte Gruppe, von Fétis bis zu seinem unerschrockenen und urteilsfreudigen belgischen Nachfolger Karel Moens eineinhalb Jahrhunderte später, bestand aus Museumsleitern mit akademischer Qualifikation.
Alle drei Gruppen teilten das Interesse für Herkunft und Echtheit. Doch Dilworth zeigte bald auf, dass jede von ihnen die andere mit einem tiefen und erklärlichen Misstrauen betrachtete, denn sie arbeiteten auf unterschiedliche Ziele hin: Händler wollten ihre Ware verkaufen. Geigenbauer und Restauratoren wollten das Unbespielbare spielbar machen und glaubwürdige Alternativen zu den immer teurer werdenden Originalen schaffen. Kuratoren und |26| Musikwissenschaftler wollten die Geschichte zurechtrücken und die Dinge so lassen, wie sie waren. Die Erfahrung, die Charles Beare in den späten 1990er-Jahren mit einer unrestaurierten Violine des Bologneser Carlo Tononi machen musste, zeigt, was geschehen kann, wenn berufsmäßige Skrupel mit den Erfordernissen der wirklichen Welt kollidieren. Als Geigenhändler der vierten Generation mit einem hochentwickelten Sinn für Geschichte und einem großen Respekt vor seiner Ware hätte Beare nichts lieber getan, als das Instrument – so, wie er es vorgefunden hatte – an einen aufstrebenden Geiger aus der Alte-Musik-Szene zu verkaufen. Doch derartige Kunden, so gab er bedauernd zu, sind meistens ein »finanziell minderbemittelter Bevölkerungsteil«, und er musste schließlich auch an seine eigene Miete, an die Gehälter seiner Angestellten und an Versicherung, Heizung und Strom denken. Nachdem er vergeblich auf einen Kunden gewartet hatte, tat er schließlich das, was Generationen von Vorgängern getan hatten: Er stattete die Tononi mit einer modernen Schnecke und ebensolchem Hals aus und verkaufte sie ohne Probleme. Doch im Gegensatz zu den meisten seiner Vorgänger legte er den ursprünglichen Hals für den Fall bei, dass ein künftiger Besitzer den Umbau einmal würde rückgängig machen wollen.31
Bei einem Symposium Anfang 2001 in Washington zeigten sich wieder einmal die Grenzen einer professionellen Synergie. Hier war es Thema und Ziel, die Verzierungen zu entschlüsseln, die eine kleine, aber bemerkenswerte Sammlung von Stradivaris, erbaut zwischen 1687 und 1722 und dem Smithsonian Museum of American History 1997 von dem Sammler und Mäzen Herbert R. Axelrod aus New Jersey überlassen, auszeichnen.32 Zwar wusste es niemand genau, aber es schien gut möglich, dass eine solche Gruppe von Fachleuten zum ersten Mal zu diesem Zweck zusammenkam. Die Diskussionsteilnehmer, einschließlich Kuratoren, Händler, Kunsthistoriker und sogar eines Materialexperten, wurden aus Tokio, Chicago und Philadelphia zusammengerufen.
Für Gary Sturm, Instrumentenkurator in der Abteilung Kulturgeschichte des Smithsonian-Instituts, war die Antwort von besonderem Interesse, denn abgesehen von ein paar Zufallsfunden und einer ähnlichen Instrumentengruppe in Madrid ist die Sammlung nahezu einzigartig. Von den Hunderten von Streichinstrumenten, die Stradivari produzierte, hatten nur elf Verzierungen,33 deren Motive bis zu dem Zeitpunkt ein Rätsel blieben, vielleicht weil sie für Stradivari und seine Zeitgenossen so selbstverständlich waren, dass eine Erklärung nicht nötig schien. Die Experten für Heraldik und Ornamentik entdeckten Hinweise, kamen aber zu keiner endgültigen Antwort. Die Händler kannten sich zwar mit Architektur und Anatomie von Stradivari-Instrumenten aus, wussten, durch wessen Hände sie gegangen waren, konnten ihre Echtheit bestätigen, ihren Zustand bewerten und natürlich ihren Marktwert schätzen, doch Dekorationen waren etwas, über das sie nicht besonders nachdachten oder das sie besonders interessierte. Deshalb war auch von ihnen keine Antwort zu bekommen.
|27| Durch eine Finanzkrise, die das Smithsonian einige Wochen später traf, kam es nicht zu einer Nachfolge-Konferenz, und es sollten sechs Jahre vergehen, bevor Stewart Pollen, der an dem ersten Treffen nicht teilgenommen hatte, die Frage zumindest bis zu einem gewissen Grade beantwortete. Pollen, ehemals Kurator von Instrumenten des New Yorker Metropolitan Museums und jetzt selbstständiger Kundenberater, machte den Ursprung der Dekorationen in einer Sammlung von Stickereien und Schnittmustern im Venedig von 1567 aus.34
In der Zwischenzeit wurden neue Forschungen, die durch eine Hausse, einen Wandel im musikalischen Geschmack und eine immer gezieltere Neugier angetrieben wurden, belohnt wie nie zuvor. Seit dem 19. Jahrhundert hatten sich die Preise für alte Violinen eingependelt oder waren kontinuierlich gestiegen, seit den 1960er-Jahren sogar in dramatischer Weise. Auch das Interesse an der vor 1800 geschriebenen Musik war seit dem Zweiten Weltkrieg gewachsen35 und ebenso der Wunsch, alte Violinen zu kaufen und zu spielen. Allerdings stand dieser zunehmenden Nachfrage ein begrenzter Vorrat gegenüber, und so wurde die Echtheit zunehmend von Belang und glaubwürdiges Wissen zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Der Bedarf an Nachforschungen zu Leben, Methoden und Geschäftspraktiken der erst-, zweit- und drittrangigen alten Meister entstand aus dem äußerst pragmatischen Interesse daran, dass der Kunde auch das bekam, für das er immer mehr bezahlen musste. Der neue globale Markt, der alles überstieg, was sich die Gebrüder Hill jemals hatten vorstellen können, bestätigte nur, dass Wissen sowohl Geld als auch Macht bedeuten konnte, und Händler, Geigenbauer, Restauratoren und Kuratoren hatten gleichermaßen Grund, sich zu freuen.
Wo es alte Geigen gab, musste es auch Restaurierungen geben, denn alle Instrumente, die älter waren als ihre Erbauer und von Spielern herumgeschubst und beschwitzt, von Sammlern missbraucht und vernachlässigt, von Holzwürmern angefressen, von Feuchtigkeit und Oxidation und ihren eigenen Belastungen in Geiselhaft genommen und Opfer katastrophaler Reparaturen und sogenannter Verbesserungen geworden waren, bettelten geradezu um Aufmerksamkeit, seit Tarisio sie erstmals nach Paris gebracht hatte. Zum ersten Mal fiel die Nachfrage nach historisch fundierter Restaurierung mit realen Möglichkeiten zusammen, sie auch zu bekommen.36
Eine weitere Option waren sehr gute Kopien. Ob offen eingestanden oder verschleiert, gut, schlecht oder vom Fließband – seit italienische Instrumente zum Maßstab geworden waren, hatte es für sie ebenfalls einen Markt gegeben. Kopien von britischen Meistern wie Bernhard Simon Fendt (1800–1852), dem wunderbar schillernden John Lott (1804–1870) und der legendären Voller-Familie wurden um ihrer selbst willen geschätzt und die Kopien von Vuillaume, einst als unechte Stradivaris verachtet, nunmehr als echte Vuillaumes gewürdigt. Schon 1995 behauptete der New Yorker Geigenbauer Sam Zygmuntowicz, |28| geboren 1956, dass zeitgenössische Geigenbauer wie er selbst und seine Kollegen Dilworth und Hargrave, die alle umfassend recherchierte, sorgfältig umgestaltete, vorzüglich reproduzierte und überzeugend antikisierte Kopien der Klassiker herstellten, die Vuillaumes der neuen Zeit seien, deren selbstgestelltes Programm im Wesentlichen aus vier Punkten bestand: erstens, die Nachfrage nach einem knappen Gut zu befriedigen, das auf seinem Weg durch unzählige Hände, Läden und Reparaturen bereits viel von seiner ursprünglichen Substanz verloren hatte; zweitens, sich mit historischen Techniken und modernen Materialien vertraut zu machen; drittens, die technischen Fähigkeiten zu verbessern, indem die Messlatte immer höher gelegt wird; und viertens, neue Instrumente in einer vertrauten Form zu bauen, um so ihre Akzeptanz zu erhöhen.37
Dass einige Musiker ein neues Interesse an Alter Musik entwickelten, machte die Sache noch spannender. Ende des 20. Jahrhunderts waren Verzeichnisse mit den Namen der Orchestermitglieder und den von ihnen gespielten Instrumenten etwa in Programmheften bei Aufführungen von Alter Musik weithin gang und gäbe geworden, und das Nebeneinander von »alten alten« und »neuen alten« Instrumenten – etwa eine Jacopo Brandini (Pisa 1793), eine David Rubio (Cambridge 1989), eine David Tecchler (Rom 1780), ein deutsches Instrument von 1750 (George Stoppani 1989)38 – war häufig ebenso unterhaltsam wie die Aufführung selbst.
Museen aus Berlin, Brüssel, Paris, South Kensington und Wien, Moskau, Taipeh und Vermillion in South Dakota vervollständigten diesen »circulus virtuosus«, und Institutionen, einst zur Bewahrung von Geschichte geschaffen, waren nun Orte, an denen sie gemacht wurde. Dynamische und akademisch gebildete, aber unterbeschäftigte Spieler Alter Musik sahen sich dort nach Arbeit um und machten es sich zur Aufgabe, die ihnen anvertrauten Reliquien, Meisterwerke und unbestimmten Artefakte zu decodieren. Geigenbauer mit geschichtlichem Interesse, die nicht selten ihre Kollegen und Altersgenossen waren, wandten sich mit der Bitte um Beratung oder Materialien an sie. »Mein Bummel durch die vielen Etagen des Museums erinnerte mich an ein viktorianisches Fossil«, bemerkte Dilworth nach einer Führung durch das Brüsseler Museum. »Gehört diese Zarge hierhin, und ist dieser vorsintflutlich aussehende, mehrsaitige Klotz ein echter Vorfahr, eine evolutionäre Sackgasse oder eine plumpe Fälschung?«39
Über ihre Arbeit befragt, antwortet Annette Otterstedt, Kuratorin am Musikinstrumenten-Museum in Berlin: »Mein ganzes Leben ging es mir darum, diese wunderbaren Dinge aus ihren Kästen zu nehmen und sie verstehen zu lernen. […] Deshalb bitte ich um genaueste Nachbildung, weil durch sie eine verlorene Fähigkeit zurückgewonnen werden kann, für die wir immer Verwendung haben werden, falls unsere Hände und Köpfe nicht verkümmern.«40 Die Ergebnisse waren gewinnbringend widersprüchlich. Im Grenzbereich eines 500 Jahre alten Berufsstandes bauten zeitgenössische Geigenbauer jetzt alte Instrumente |29| mit modernen Technologien, sogar Verbundwerkstoffen, und vermarkteten sie im Internet. Doch – geradeso wie bei der menschlichen Evolution – wurden die Ursprünge des Instrumentes und das von Generationen angesammelte Wissen nach und nach immer weiter in die Vergangenheit zurückgedrängt.
»Die Violine wurde nicht nur von einem Elternteil geboren, sondern im frühen 16. Jahrhundert von vielen Eltern entwickelt«, schrieb Boyden 1965,41 und Otterstedt ergänzte eine Generation später: »Wir wissen jedenfalls, daß weder ein Maler noch ein genialer Erfinder die ›geheiligte Form der Geige erfunden‹ hat, sondern daß diese das Ergebnis eines jahrhundertelangen Prozesses ist, dessen Vielfalt wir begrüßen anstatt verdrängen sollten.42