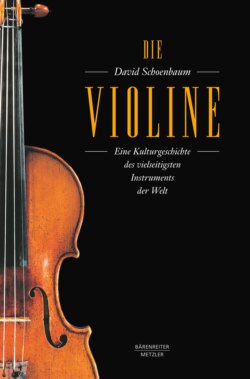Читать книгу Die Violine - David Schoenbaum - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
|61| Über die Berge und immer weiter
ОглавлениеIn der Zwischenzeit ging der Geigenbau an anderen Orten weiter, nicht zuletzt, weil er nie wirklich aufgegeben worden war. Um 1650 waren in Amsterdam Geigen nach italienischen Vorbildern aufgetaucht, und niederländische Zeitgenossen von Stradivari bauten in einer Zeitspanne von nur einer Generation niederländische Amatis mit derselben Unbekümmertheit, mit der der New Yorker Garment District drei Jahrhunderte später Dior-Kleider schneidern sollte. Nach Auskunft des Amsterdamer Händlers Fred Lindeman waren die Zettel nicht als Kundentäuschung, sondern als Ausdruck von Respekt gedacht. Die Idee war, so folgerte der Musikwissenschaftler Johan Giskes, sich durch die Schaffung von lokalen Versionen eines italienischen Designer-Modells einen Marktanteil zurückzuerobern.183
Eine bevorzugte Erklärung dafür, wie das alles möglich war, geht von einem direkten Einfluss aus. Ab 1660 tauchen italienische Violinen in Amsterdamer Versicherungsunterlagen auf, und in einem Auktionskatalog von 1671 finden sich Violinen aus Cremona.184 Neueste Forschungen haben jedoch keine Spuren von italienischen Geigenbauern in Holland oder von aufstrebenden niederländischen Geigenbauern in Italien entdeckt. Vielleicht gab es aber einen indirekten Einfluss: Francis Lupo, ein Geigenspieler und -bauer aus einer jüdisch-sephardischen Familie, die von Italien nach England und dann zurück auf den Kontinent gezogen war, heiratete eine Witwe. Es ist gut möglich, dass ihr Sohn Cornelius Kleynman – ein sehr guter Geigenbauer – das Handwerk von seinem neuen Stiefvater erlernte.185 Hendrik Jacobs, der bedeutendste niederländische Geigenbauer, wohnte in unmittelbarer Nähe, und seine frühen Instrumente ähneln denen von Kleynman. Auch er heiratete eine Witwe und kam so zu einem Stiefsohn, Pieter Rombouts, der der zweite bemerkenswerte niederländische Geigenbauer wurde. Seine Instrumente ähneln denen von Jacobs.
Die wahrscheinlichste Erklärung für den Beginn des Geigenbaus in Flandern aber liegt wohl eher in städtischen als familiären Wurzeln. Im späten 16. Jahrhundert war Amsterdam mit seinen 30 000 Einwohnern eines der wichtigen Handelszentren der Niederlande. 1670 hatte die Stadt bereits 200 000 Einwohner, während Brügge und Antwerpen zunehmend an Bedeutung verloren. Amsterdams Handelsnetze erstreckten sich von Indonesien bis nach Italien, und Einwanderer und Flüchtlinge kamen von weit her, sogar von der iberischen Halbinsel oder den Küsten der Ostsee. Geigenbauer waren nicht darunter, doch gab es sowohl unter den Einwohnern als auch unter den Besuchern zahlreiche Italiener und damit einen starken Einfluss der italienischen Kultur. Es überrascht nicht, dass das erste Goldene Zeitalter des holländischen Geigenbaus |62| mehr oder weniger parallel zu den Geschicken der Stadt und der Kaufmannsrepublik verlief, zu der er gehörte. Im Jahr 1600 gab es für eine Bevölkerung von etwa 50 000 Menschen sechs Hersteller von Saiteninstrumenten, nach 1622 waren es mindestens zehn für eine Bevölkerung von etwa 100 000, darunter einer, der sich ausdrücklich als »Geigenbauer« bezeichnete. Ab 1650 nannten sich nahezu alle Bauer von Saiteninstrumenten so, obwohl ihre Angebotspalette aus Lauten, Zithern, Harfen, Gamben, der Tanzmeistergeige im Taschenformat mit Namen »Pochette« und Cembali bestand.186
Unterdessen stieg das Instrument auf der sozialen Leiter empor – vom Fiedler über Berufsmusiker bis zu vornehmen Amateuren, die Stadthäuser bauten und ihre Familien von holländischen Meistern porträtieren ließen. Obwohl Geigenspiel und Geigenbau nach und nach getrennte Wege gingen, passten beide ihr Angebot an die Wünsche der Reichen und Armen, der Bauern und Bürger, der Amateurorchester und der Theaterleiter sowie an die Erfordernisse von Hausmusik und Kirchenkonzerten an. Um 1700 brachten lokale Verleger italienische Musik auf den Markt, noch bevor sie in Italien angeboten wurde,187 und Malerei und Musik kamen sich immer näher, denn Musiker malten, Maler kauften Instrumente, und Söhne von Geigenbauern gingen in den Kunstbetrieb.188
Rombouts Tod im Jahr 1728 markiert das Ende des ersten Goldenen Zeitalters, als die niederländische Herstellung aus den gleichen Gründen wie in Italien aufgegeben wurde. Da die Nachfrage durch in- und ausländische Anbieter gesättigt war, war es für die nächste Generation nur natürlich, dass sie sich auf Handel und Reparatur konzentrierte. Doch in Den Haag, der zweiten Großstadt der Niederlande und einem Zentrum der Diplomatie, brach bald ein zweites Goldenes Zeitalter an, das stark von französischen Geigenbauern beeinflusst war. Dieses Mal entstand die Nachfrage in einer Stadt, in der italienische und deutsche Virtuosen regelmäßig auf ihrem Weg von oder nach England Halt machten, und kam von Freimaurerlogen, literarischen Kreisen, Reform- und politischen Vereinen und Musikgesellschaften.189
Johann Theodorus Cuypers, 1724 in einem deutschen Dorf kurz hinter der Grenze geboren, scheint aus dem Nichts gekommen zu sein. 1752 taucht er als Bürger von Den Haag auf.190 Was er bis dahin getan hatte, ist nicht bekannt, doch hatte er irgendwo, vermutlich von einem französischen Gitarrenbauer mit Sitz in Den Haag, gelernt, Strad-Modelle von guter Qualität zu bauen. Er hinterließ drei Hinweise auf die Vergangenheit und unmittelbare Zukunft des Handels. Ohne eine offensichtliche Verbindung nach Italien war das italienische Modell mittlerweile zum Goldstandard des europäischen Geigenbaus geworden. Durch das Miteinander von Geigern, Lehrern und Geigenbauern hatte die Violine im bürgerlichen Leben einen festen Platz gewonnen. Und die Kombination aus französischem, kulturellem und unternehmerischem Einfluss hatte aus der französischen Violine mit ihrem |63| verlängerten Hals und dem Bassbalken eine gutbürgerliche Version der italienischen Geige entstehen lassen.
England war hier, wie so oft, sowohl typisch als auch ein Fall für sich. Der englische Geigenbau wurde von einem wachsenden Bedarf an Geigenspielern und Instrumenten belebt, verband ausländische Inspiration mit eingewandertem und einheimischem Talent und schuf so ein Vermächtnis, das sowohl einen Vorrat an guten Instrumenten als auch einen Geigenhandel von Weltklasse einschloss. Da der Warenimport vom Kontinent teuer war und die königliche Familie eine Schwäche für das Instrument hatte, wurde der Bau von Celli in England zu einer Spezialität. Das früheste bekannte englische Cello tauchte im Jahr 1672 in Oxford auf.191
Während der englische Geigenhandel zum internationalen Standard wurde, waren die Instrumente – außer Celli und Bögen – kaum über Dover hinaus bekannt. Doch zu Hause wurden sie hoch geschätzt, wenn auch oft mit einem leicht defensiven Unterton. »Ohne in irgendeiner Weise von der wirklichen Güte der Instrumente von Wm. Forster ablenken zu wollen […], können wir getrost behaupten, dass die großen Cremoneser Geigenbauer konkurrenzlos waren«, warnte ein viktorianischer Schriftsteller angehende Käufer. »Wm. Forsters Violoncelli stehen jedoch (in England jedenfalls) sowohl bei Berufsmusikern als auch bei Amateuren in hohem Ansehen und erzielen gute Preise.«192
Händler auf dem europäischen Festland wussten nichts von englischen Instrumenten, wie Arthur Hill im Jahr 1911 grimmig bemerkte, und taten alles, um ihre Erben ebenso unwissend zu halten, indem sie Zettel vertauschten, wo immer sie ihnen in die Hände fielen. Hill hatte dem legendären Fritz Kreisler gerade eine Violine von Daniel Parker, einem Londoner Geigenbauer, der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts lebte, verkauft. Der begeisterte Kreisler, der sie in der Nacht zuvor öffentlich gespielt hatte, fand sie so gut wie seine del Gesù. Aber auch er wollte das Etikett entfernt haben, sodass er sie nach seiner Rückkehr nach Deutschland als ein Produkt eines Meisters aus dem 18. Jahrhundert, Tomaso Balestrieri aus Mantua, ausgeben konnte.193 30 Jahre später zeigte er sie auf einer Party in New York stolz seinem Kollegen, dem großen Nathan Milstein. Die angebliche Balestrieri, erklärte er, war unterdessen zur »Parker Strad« geworden, denn »sie klingt so gut«.194
Zwischen den Höhepunkten gab es längere Zeiten der Stagnation, in denen die lokale Produktion einen Verlauf nahm, den Charles Beare »W-förmig« nannte.195 Der erste Höhepunkt bestand an der Schwelle des 18. Jahrhunderts aus einer Gruppe begabter Geigenbauer. Der zweite umfasste Mitte des 19. Jahrhunderts eine Gruppe von ebenso begabten, häufig schillernderen und für die Nachwelt besser dokumentierten Kopisten. Es sollten etwa 150 Jahre vergehen, bevor das »W« im späten 20. Jahrhundert einen dritten Höhepunkt erreichte – in |64| einer Gruppe von Restauratoren und genialen Kopisten, die sich von Bremen bis Minneapolis etabliert hatten und deren Fähigkeiten allgemein geschätzt wurden.
Gemeinsamer Ahne aller drei Gruppen war ein Gambenensemble, das zunächst im Jahr 1495 in Mantua aufgetaucht und in England mit Begeisterung aufgenommen worden war. Um 1600 scheinen Violinen fest etabliert gewesen zu sein, obwohl sie durchaus gewöhnungsbedürftig waren. Thomas Mace, ein zeitgenössischer Lautenspieler und Komponist, beklagte sich über »ihren hochgeschätzten Lärm, der die Ohren eines Mannes zum Glühen bringen kann«. Doch noch vor seinem Tod war das, was für den einen Komponisten die »schimpfenden Geigen« waren, für den anderen die »fröhlichen Geigen«, deren »silberne Töne […] so göttlich süß« waren, dass sie den Zuhörer dazu bringen konnten, sich »in Tränen und Gebeten zu Chloes Füßen aufzulösen.«196
Roger North, ein ungewöhnlich kluger und nachdenklicher Beobachter, schrieb den Erfolg der Geige dem »sehr guten Ton, über den dieses Instrument verfügt« und ihrer Fähigkeit zu, Halbtöne und sogar Doppelgriffe rein zu spielen. Außerdem verband er schnell das Potenzial des Instruments mit einem Spieler, der »etwas von der Leistungsfähigkeit und Dimension der Instrumente sowie der erforderlichen Geschicklichkeit, die zu ihnen gehört, versteht«.197 Besonders beeindruckt war er von Nicola Matteis, einem Italiener, der über Deutschland nach London gekommen war und »die Gesellschaft mit einer Kraft und Vielfalt für mehr als eine Stunde in Bann schlug, dass es kaum ein Flüstern im Raum gab, obwohl er voll besetzt war«.198
Im Gegensatz zu Holland hatte England seit Langem eine direkte Verbindung nach Italien. Die ersten Spieler, die für das Streicherensemble von Henry VIII. aus Italien angeworben worden waren, brachten ihre Instrumente nicht nur mit, sondern könnten sie sogar selber gebaut haben. Zu Purcells Zeit waren aus dem Geigenspieler, der traditionell gleichzeitig Geigenbauer war, zwei nahezu autonome Berufe hervorgegangen. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass die neueren Einwanderer englische Instrumente gespielt oder gar erworben haben, geht gegen Null. Man kann davon ausgehen, dass der junge Gasparo Visconti, ein gebürtiger Cremoneser, der Stradivari gekannt und sogar mit ihm gearbeitet hatte, eine Strad spielte, als er um 1700 nach London kam.
Das Orchester des Hofes führte bereits im Jahr 1637 Cremoneser Instrumente ein, als der lokale Geigenbauer John Woodrington eine »neue Cremonia Vyolin« gebaut hatte, offensichtlich in Anlehnung an ein importiertes Original. Ab Mitte des Jahrhunderts kaufte ein Spieler oder Gentleman, der es sich leisten konnte, entweder ein italienisches Instrument oder eine Stainer von dem großen, durch Amati beeinflussten Tiroler. Laut Beare führte dann die Beliebtheit von Stainer-Geigen dazu, dass sie häufig – und meistens schlecht und billig – kopiert wurden, was den britischen Geigenbau in ein Tief führte, das ein halbes Jahrhundert andauern sollte.199
|65| Bereits 1704 wurde Stradivaris langer Schatten in der Arbeit von Barak Norman, einem der ersten wichtigen britischen Geigenbauer, sichtbar.200 Erst um die Wende zum 19. Jahrhundert zeigten Superstars wie Giovanni Battista Viotti oder später Niccolò Paganini, zu was eine Strad oder del Gesù mit ihren erweiterten Griffbrettern und verstärkten Bassbalken fähig war. Von da an wich die Nachfrage nach im Inland hergestellten Stainers einer Vorliebe für im Inland hergestellte Strads – von Regalware bis zur Konzertqualität.201
Ebenso wie ein erstklassiges Geigenspiel hing ein hochqualifizierter Geigenbau stark von italienischen und deutschen Importen ab. Eine der ersten Violinen aus England stammte von Jacob Rayman, einem gebürtigen Füssener, der sich 1625 in London angesiedelt hatte.202 Vincenzo Panormo, von Beare, Dilworth und Kass als der wichtigste englische Geigenbauer seiner Zeit angesehen, war eigentlich ein Sizilianer, der seit Jahrzehnten in Frankreich gearbeitet hatte, bevor er in seinem fünften Lebensjahrzehnt das revolutionäre Paris verließ, um sich in London niederzulassen.203
Die Frage ist allerdings, warum einheimische Talente so lange brauchten, um sichtbar zu werden. Bis Mitte des 16. Jahrhunderts gab es englische Gamben von beispielhafter Eleganz und technischer Raffinesse und Käufer, die bereit waren, für sie Spitzenpreise zu zahlen.204 Doch es sollten fast anderthalb Jahrhunderte vergehen, bis inländische Violinen von vergleichbarer Eleganz und Raffinesse auf dem englischen Markt erschienen. Im Jahr 1726 deutet North zumindest eine mögliche Erklärung an, wenn er schreibt: »Der Einsatz der Violine war sehr gering, […] außer durch gewöhnliche Fiedler«.205 Doch die Bevorzugung der Gambe durch die Oberschicht war in einer Gesellschaft, die selbst bei Cricket-Mannschaften bis weit ins 20. Jahrhundert zwischen Gentlemen und Spielern unterschied, nur eines der Hindernisse für einen ernst zu nehmenden Geigenbau, zu denen vermutlich auch der soziale Status des Handwerks gehörte. »Es ist eine bemerkenswerte Tatsache und zeigt die Unterschiede in Sitten und Gebräuchen der verschiedenen Länder«, seufzte Pearce, »dass sowohl Amati als auch Stradivari offenbar aus alten und ehrbaren Familien stammten und dennoch trotz ihrer Aufnahme einer Tätigkeit, die in England den guten Namen einer Familie befleckt hätte, von ihren Mitbürgern bis zu ihrem Tod respektiert und geehrt wurden.«206
Das puritanische Intermezzo scheint ein weiteres Hindernis gewesen zu sein. Die Puritaner geißelten ohnehin die feine Gesellschaft und waren Musikern und dem, was Mace ihre »Extravaganzen« nannte, wenig freundlich gesinnt. Harvey berichtet von einer Anzahl talentierter Möbeltischler aus Holland, Frankreich und Deutschland, deren von Italien und Tirol beeinflusste Fähigkeiten dem Geigenbau hätten zugutekommen können, wären sie nicht Calvinisten gewesen. Er dokumentiert auch eine zeitgenössische Violine aus Metall. Anscheinend war sie kein Einzelstück, wurde möglicherweise gespielt, |66| und es ist nahezu sicher, dass sie dem Kesselflicker oder Metallarbeiter John Bunyan gehörte, bevor dieser Baptist wurde, zu predigen begann und seine Aufmerksamkeit seinem literarischen Meisterwerk The Pilgrim’s Progress zuwandte.
Dennoch, so behauptet North, zogen es viele vor, lieber »zu Hause zu fiedeln, als rauszugehen und Prügel zu beziehen«.207 Während das Musizieren in der Öffentlichkeit stagnierte, scheint die Hausmusik tatsächlich erblüht zu sein. Die zurückweichenden Fluten der Revolution hinterließen eine Unmenge von Amateurgeigern, die ein gemeinsames Interesse an Lehrwerken, Handbüchern, Instrumenten und Noten verband. Doch paradoxerweise machten die gleichen Umstände, die das Aufkommen eines einheimischen Stradivari und einer eigenen Geigenindustrie verhindert hatten, Import und Handel zunehmend lohnend. Der Handel, ursprünglich aus einem vielschichtigen Netzwerk von Schutzgemeinschaften im Schatten der London Bridge entstanden, folgte der Stadtentwicklung nach Westen in die Welten von Defoe, Hogarth und Samuel Smiles, dem Propheten der frühen viktorianischen Selbsthilfe.
Inzwischen zogen angehende Geigenbauer wie die Familien Forster, Dodd, und Kennedy aus der Provinz in die große Stadt, wo sie und ihre Nachkommen über mehrere Generationen hinweg den Markt dominierten. Einige von ihnen waren überaus erfolgreich, so wie George Miller Hare, der 1725 als wohlhabender Besitzer einer Werkstatt in St. Paul’s Church Yard starb. Im Jahr 1741, demselben Jahr, in dem Henry Fielding von seinem Verleger 183 Pfund für sein Buch Joseph Andrews erhielt – während ein Landpfarrer seine Frau und sechs Kinder von einem Jahreseinkommen von 23 Pfund ernährte –, versicherte Peter Wamsley seine Werkstatt in Piccadilly für 1.000 Pfund.208 Bis zum Ende des Jahrhunderts hatte Richard Duke, der am meisten bewunderte Geigenbauer seiner Zeit, mit seiner florierenden Werkstatt eine besondere Beziehung zum Herzog von Gloucester aufgebaut und private Unterkünfte in Old Gloucester Street und Werkstätten in Gloucester Place errichtet. An der Schwelle des 19. Jahrhunderts beschäftigte John Betts, Geselle bei Duke und selber ein angesehener Geigenbauer, den noch angeseheneren Panormo sowie Henry Lockey Hill, dessen Enkel das Familiengeschäft zum Ritz des Violinhandels machen sollte.
Unzählige andere fielen Epidemien, Armut oder der Vergessenheit anheim. John Kennedy wurde wegen Schulden eingekerkert. Dasselbe geschah mit dem »schottischen Stradivari« Matthew Hardie, der vormals als Schreiner und Soldat gearbeitet hatte. Der Bogenmacher John Dodd trank sich zu Tode. Von den vier geigenbauenden Söhnen des begabten Bernhard Simon Fendt, einem Emigranten aus Füssen, erreichte nur Bernhard jr. ein mittleres Alter.
Wiederum andere, wie John Lott (1804–1870), führten ein unkonventionelles und buntes Leben. Als Sohn und Bruder von Geigenbauern hatte Lott das Handwerk von seinem Vater gelernt und führte es eine Zeit lang auch aus, bis »der Geigenhandel eine von diesen Erkältungen bekam, der alle modischen |67| Gewerbe unterliegen«, wie Charles Reade schrieb.209 Lott überlebte – allerdings nur knapp – eine kurze, aber dramatische Karriere als Feuerwerkskünstler und eine weitere als Wanderschauspieler; er trat einem Theaterorchester bei, wo er seinen Bogen mit Seife einstrich, um beim Geigen gesehen, aber nicht gehört zu werden, und bereiste Europa und Amerika als Wächter eines temperamentvollen und am Ende gemeingefährlichen Zirkuselefanten.
Zwischen den Engagements lernte er, Buchenholz so zu bemalen, dass es wie Eiche, Ahorn oder Nussbaum aussah. Diese Kunst kam ihm ein paar Jahre später zustatten, da die Nachfrage nach hochwertigen Geigenkopien so anstieg wie der Kurs von Eisenbahnaktien. In den späten 1840er-Jahren kopierte Lott Geigen von Guarneri derart erfolgreich, dass die erste Frau von Yehudi Menuhin ihrem Mann ein Jahrhundert später eine als Original kaufte. Als Menuhin sie wesentlich später wieder verkaufen wollte, musste Beare ihm mitteilen, dass es sich um eine Kopie handelte. Damit, so erinnerte sich Beare bedauernd, endete eine langjährige Freundschaft.210
Lott selber hätte vermutlich den Voller-Brüdern William und Arthur und ihrem Vater Charles – einem Kutscher, der über Musikunterricht, den Parfümhandel und die Kriegsmarine zum Geigenbau gekommen war – applaudiert, die Mitte der 1880er-Jahre italienische Instrumente für den führenden Londoner Geigenhändler Hart & Son kopierten. 1899 bestätigte Meredith Morris, der später ein Verzeichnis britischer Geigenbauer erstellen sollte,211 dass es fast unmöglich sei, eine del Gesù von Voller vom Original zu unterscheiden.212 Kopien von Voller, die nicht unbedingt als solche identifiziert wurden, verkauften sich in Italien mittlerweile denkbar gut.
Die Voller-Brüder, die als selbstständige Heimarbeiter in immer bessere Wohngegenden zogen, vergaben die Anfertigung von Geigenzetteln für 6 Pence pro Stück an einen Nachbarssohn mit einer Begabung für Kalligrafie. Um den Rest der Arbeit – das nach Jahresringen richtige Holz, den Lack, Alterung, simulierte Risse, sogar raffiniert altertümliche Hinweise auf frühere Besitzer – kümmerten sie sich selber. So produzierten sie nach einer Schätzung etwa zehn Instrumente pro Jahr. Eine Londoner Reederei mit einem Nebenerwerb im Verkauf von Geigen lancierte um die Wende zum 20. Jahrhundert eine Voller als Strad, die in dieser Eigenschaft eine 60-jährige Karriere hatte.213 Die in Deutschland bekanntesten Händler Hamma & Co. knüpften zu den Vollers eine Beziehung, die über den Ersten Weltkrieg hinaus andauerte. Seit 1920 machten sie auch mit Wurlitzer in New York Geschäfte.
Obwohl sie vor und nach dem Krieg unauffällig blieben, gerieten die Vollers nie völlig aus dem Blickfeld: Große Händler kauften ihre Produkte zu guten Preisen, und wichtige Geiger suchten sie für Reparaturaufträge auf. William, der 1933 mit 79 Jahren starb, hinterließ seiner Frau einen gutbürgerlichen Besitz. Die Nachwelt stellte den Charakter der Vollers in Frage – vielleicht zu |68| Unrecht –, an ihren Fähigkeiten jedoch zweifelte niemand. Es entbehrt nicht der Ironie, dass im Jahr 2002 ein Gedenksymposium für sie aus Mangel an ausleihbaren »Instrumenten erster Wahl, um eine erstklassige Ausstellung zu machen«, abgesagt werden musste.214 Dass es zu wenig Eigentümer gab, ist unwahrscheinlich. Das Problem scheint eher ein Mangel an Eigentümern gewesen zu sein, die bereit waren, dies zuzugeben.
Walter Mayson (1835–1904), der sich im Alter von 39 Jahren nach dem Verlust seines Arbeitsplatzes bei einer Reederei in Manchester ausschließlich dem Geigenbau widmete, baute in einem Arbeitsleben, das nur halb so lang währte wie das Stradivaris, 810 Instrumente. Unter ihnen befanden sich 27 Bratschen und 21 Celli, einige davon mit patriotischen Hinweisen, zum Beispiel auf den Burenkrieg, einige weitere dazu mit als Flachreliefs gestalteten Böden. Nachdem seine erste Frau, um die er sechs Jahre geworben hatte, im Kindbett starb, heiratete Mayson erneut. Danach verbrachte er Jahre damit, die Hypothek auf ein Haus abzuzahlen, das er sich nicht leisten konnte und das schließlich mit Verlust verkauft wurde.
Um sein bescheidenes Einkommen aufzubessern, produzierte er nebenher einen steten Strom von Essays und Gedichten sowie einen Roman. 1888 gewann er einen australischen Wettbewerb, konnte aber die Goldmedaille nicht entgegennehmen, weil die Organisatoren in Konkurs gegangen waren. 1899 nahm er den Auftrag für eine Reihe von Artikeln für The Strad an, die gesammelt und in Buchform veröffentlicht wurden, aber finanziell nur Verluste einbrachten. Als lokale Bewunderer sich zusammentaten, um den königlichen Museen in Salford und London eine Sammlung seiner besten Arbeiten zu präsentieren, gelang es ihnen lediglich, ein einziges Instrument postum zu kaufen.215
Edward Heron-Allen (1861–1943), ein Edwardianer mit der Vielseitigkeit eines Michelangelo und von Geburt an mit besten Beziehungen ausgestattet, hatte ebenso viel Glück wie Mayson Pech. Er war noch ein Schuljunge im Harrow-Internat, als ihn sein Interesse am Londoner Stadtteil Soho, wo sein Vater als Anwalt tätig war, zu einem Interesse an den dortigen Geigenbauwerkstätten führte. Um eine informelle Lehre zu beginnen, für die er sogar selber bezahlte, suchte er sich Georges Chanot aus, den in London ansässigen Sohn einer Pariser Familie, die seit den 1820er-Jahren im Geigenhandel aktiv war.
Er baute mindestens zwei Instrumente. Doch noch in seinem zweiten Lebensjahrzehnt wurde er von Sir Richard Burton, einer noch schillernderen Figur als er selbst, ermutigt, stattdessen über die Violine zu schreiben. Eine Anleitung zu ihrem Bau erschien mit einer Widmung an den Herzog von Edinburgh in Amateur Work Illustrated, einer freiverkäuflichen Zeitschrift. Die Neuveröffentlichung als Buch ist noch 120 Jahre später im Handel erhältlich.216 Nachdem er Edward Heron-Allen in seiner Schulbibliothek entdeckt hatte, ließ John Dilworth in den frühen 1970er-Jahren den Plan fallen, sich an der |69| Universität von Brighton einzuschreiben, und besuchte stattdessen die neu eröffnete Violinschule in Newark, in der Nähe von Nottingham. Die amerikanische Geigenbauerin Anne Cole nutzte das Buch ebenfalls zum Selbststudium, nachdem sie es an der Schwelle zum Teenageralter in Albuquerque, New Mexico, entdeckt hatte.217
Als Geigenbauer, Anwalt und Autor schrieb Heron-Allen mit besonderem Sachverstand über anhängige Rechtsstreitigkeiten, gab die Violin Times heraus und gehörte mit den Gebrüdern Hill, Reade und dem älteren Hart zu den anerkanntesten Experten Großbritanniens.218 Außerdem bereiste er die Vereinigten Staaten, wo er Unterricht in der Handlesekunst erteilte, veröffentlichte Aufsätze über Meeresbiologie, ließ sich in die Royal Society und die Academy of St. Cecilia wählen, übersetzte die Klage des persischen Poeten Baba Tahir aus Farsi, war als Anwalt tätig, schrieb unter Pseudonym okkulte Romane und elegante Pornografie in limitierter Auflage, bildete Pfadfinder aus der Nachbarschaft für den Kriegsfall als Bürgerwehr aus, diente während des Ersten Weltkriegs als Nahost-Experte im Kriegsministerium, hielt in umfangreichen und faszinierenden Aufzeichnungen fest, wie der Krieg die Welt um ihn herum veränderte,219 und entwickelte ein gesteigertes Interesse am Buddhismus.220
Doch während Londoner Händler und englische Gentlemen den geheimnisvollen Nimbus und den Markt des Instruments bestimmten, leiteten französische und deutsche Handwerker den Lauf seiner Geschichte um. Dieser Prozess reichte zurück bis ins 16. Jahrhundert, als Mirecourt in Lothringen und Mittenwald in Bayern begannen, Instrumente zu attraktiven Preisen für einen regionalen Markt herzustellen. Ein Jahrhundert später kam Markneukirchen in Sachsen dazu. Genauso wie Cremona waren alle drei Orte strategisch günstig gelegen, förderten eine Vielzahl von Kunsthandwerken, zählten Kirche und Staat zu ihren Kunden und beobachteten aufmerksam, was südlich der Alpen geschah.
Während der Nachschub aus Italien zurückging, sich die europäische Nachfrage aber erhöhte, wurden alle drei Städte, von denen keine mehr als ein paar Tausend Einwohner hatte, zu Zentren der Handwerksbetriebe. Dieser Wandel demokratisierte die Strad in ähnlicher Weise wie Henry Ford den Rolls-Royce. Im Prinzip strebte jede der Städte eine Produktpalette gewissermaßen vom Familienauto bis zum Kleinwagen an, und französischen Geigenbauern gelang es dabei schnell, sich auf Höhe des Mercedes einzureihen. Die Deutschen hingegen – vor allem in Markneukirchen – mussten sich, ob zu Recht oder zu Unrecht, mit dem bescheidenen Volkswagen, wenn auch dem Modell TS, zufrieden geben.
Am Vorabend des 20. Jahrhunderts rief sich Arthur Hill nahezu täglich ins Gedächtnis, dass »deutsch« ein Synonym für billig, inkompetent und betrügerisch war. Ein Jahrhundert später erklärte Joan Balter, eine Händlerin aus dem kalifornischen Berkeley chinesischen Eltern, die für ihre Tochter einkaufen |70| wollten, geduldig, dass sie für einen italienischen Geigenzettel dreifach, für einen französischen doppelt, für einen aus Mittenwald dagegen nur einen einfachen Preis zahlen müssten, vorausgesetzt, er war handgemacht und alt genug.221 Ein Kenner auf der Suche nach etwas Gleichwertigem aus Markneukirchen, konnte am Wochenende auf Flohmärkten fündig werden.222
Aber die Ähnlichkeiten waren größer als die Unterschiede. Der gemeinsame Wettbewerbsvorteil in allen drei Städten begann bereits mit den Rohstoffen. Sowohl französische als auch deutsche Geigenbauer schätzten den leichten Zugang zu hochwertiger Kiefer und Fichte. Im Jahr 1870 war mehr als ein Viertel von Bismarcks neuem Deutschland bewaldet – eine Fläche, die größer war als die Hälfte des Vereinigten Königreichs. Noch am Vorabend des Ersten Weltkriegs waren in den Wäldern in Deutschland mehr Menschen beschäftigt als bei seinem Schrittmacher, der chemischen Industrie. Frankreich war ebenso gesegnet, denn es verfügte nicht nur über ausgedehnte Gemeindewälder in den Alpen, den Vogesen, dem Jura und den Pyrenäen, sondern als Nebenprodukte seiner Kolonien auch über tropische Harthölzer wie Ebenholz und Pernambuco.223
Ebenfalls im Gegensatz zu Großbritannien blieb die Infrastruktur der Handwerker in allen drei Städten intakt und erkennbar, lange nachdem die Gilden offiziell abgeschafft waren. Ab 1850 waren drei von fünf Briten in der industriellen Fertigung und zwei Fünftel immer noch in der Landwirtschaft beschäftigt, viele von ihnen ohne eigenes Land. Eine Generation später lebten zwei Drittel ihrer französischen Nachbarn auf dem Land, 1911 waren es noch mehr als die Hälfte, rund 80 Prozent von ihnen als Kleinbauern.224 In Bayern, Tirol und dem sächsischen Vogtland, wo umfangreiche Zusammenschlüsse von familiären Arbeitskräften für jede saisonale Beschäftigung dankbar waren, die die Briten zur Mitte des 19. Jahrhunderts längst hinter sich gelassen hatten, war die Situation im Wesentlichen die gleiche.
Mirecourt, eine herzogliche Residenzstadt in guter Lage, war in vielerlei Hinsicht charakteristisch. Doch zwei einander ergänzende Vorteile hätten sicher die Aufmerksamkeit eines Betriebswirts auf sich gezogen. Einer war die Komplementarität ihrer hauptsächlichen Geschäftszweige, der zweite ihr einfacher Zugang zu Paris.
In lokalen Handwerksbetrieben wurden Rüstungen, Lederwaren, Textilien und Spitze hergestellt – alles mit Unterstützung und unter dem Mäzenatentum der Herzöge von Lothringen, deren Nachfolger die Stadt auch nach den Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges vor einem Desaster bewahrten. Berichten zufolge gab es nach 1725 in Mirecourt zehn Geigenwerkstätten. Sieben Jahre später schafften es ihre Besitzer, dass »François, durch die Gnade Gottes Herzog von Lothringen und Bar, König von Jerusalem, etc.«, eine Gilde anerkannte.225 Nach 1748 waren die zehn Geschäfte auf sechzig angewachsen.
|71| Am Vorabend der Revolution beschäftigte ein von den Damen des Klosters Poussay betriebenes Spitzen- und Gardinenunternehmen in einer Stadt mit 7000 bis 8000 Einwohnern fast 1 000 Frauen und unterstützte damit nebenbei den Instrumentenhandel. Die Verbindung ging mindestens bis 1629 zurück, als ein lokaler Händler mit dem prächtigen Namen Dieudonné Montfort auf die Idee kam, seine Produktpalette um gewebte Spitzen zu erweitern. Instrumenten- und Spitzenwirtschaft teilten sich Verkaufsgeschäfte und ein gemeinsames Verteilernetz und waren für die kommenden Jahrhunderte vereint. Neun Chanots bauten und verkauften Violinen in Frankreich und sieben weitere in England, bevor die Linie schließlich 1981 ausstarb.226
Die Revolutionszeit war ein weiterer Schlag für Mirecourt. 1806 beklagte Bürgermeister Jacques Lullier, dass die Blockade und der Seekrieg seine Stadt bis zu 500 exportabhängige Arbeitsplätze gekostet habe. Dennoch gehörten Bauern und Kleinhandwerkerfamilien langfristig zu den Gewinnern der Revolution. Bevor Mirecourts Ruhm endgültig verblasste, waren bis zu 80 Prozent der arbeitenden Bevölkerung im Geigenbau beschäftigt,227 und ebenso wie in Italien hatte der Familienverbund auch hier einen maßgeblichen Anteil daran. Vannes führte in seinem 1932 erschienenen Essai d’un dictionnaire universel des luthiers 830 einheimische Geigenbauer auf, zu denen ab 1580 23 Jacquots und ab 1625 25 Vuillaumes gehörten. Zwischen 1620 und 1954 gab es acht Generationen von geigenbauenden Mangenots.228
Bemerkenswert ist die Stabilität dieses Berufsstandes.229 Die 17 Artikel der Mirecourt-Charta, die als geltendes Recht verbindlich war, führten Privilegien, Pflichten, Verfahren, Ränge, Räumlichkeiten und vor allem Wettbewerbsbeschränkungen auf, die alle so systematisch und detailliert erfassten waren wie die Gesetze des Ancien Régime, allerdings weniger dauerhaft. In ihrer ursprünglichen Form überlebten sie bis 1776, als der königliche Finanzminister Anne-Robert-Jacques Turgot die Gilden einschließlich der Prüfer, die entschieden, wer qualifiziert genug war, um eine Werkstatt zu eröffnen, abschaffte. Turgot, Anhänger der neumodischen Lehre von der Deregulierung, verringerte auch die Gebühren für die Eröffnung eines Geschäfts um fast drei Viertel, zu denen Steuern, Zahlungen an die Gilde, Honorare für die Prüfer und den Gilde-Präsidenten sowie die Verwaltungskosten gehörten. Doch der lange Schatten des ständischen Regelwerkes fiel sogar noch 2002 auf den in England ausgebildeten Hargrave, einen der Versiertesten unter den zeitgenössischen Meistern, als die deutsche Geigenbauerzunft ihn verklagte, weil er ohne eine bei ihnen erworbene Lizenz behauptete, das zu sein, was er eben war.
So hierarchisch, patriarchalisch und leistungsorientiert, wie die Gilde immer noch war, stellte sie schon jetzt all das dar, gegen das die Revolution sich später richtete. Am unteren Ende der Rangordnung befand sich der Lehrling, ausschließlich männlich, in der Regel zwischen zwölf und fünfzehn Jahren |72| alt. Erwachsene Lehrlinge waren selten, Ausländer ungewöhnlich. Ein Vertrag wurde von einem Notar erstellt. Die meisten Lehrlinge kamen aus bescheidenen Familien, die zumindest im 18. Jahrhundert Analphabeten waren: Bauern, Handwerker oder Ladenbesitzer. Diejenigen, die sich die jährlichen Kosten von 100 bis 500 Livres für sechs Jahre Lehrzeit mit Unterkunft und Verpflegung leisten konnten, zahlten die Hälfte davon sofort und den Rest über die verbleibenden Jahre ab. Von den Lehrlingen wurde erwartet, dass sie Kleidung, Bettzeug und Schuhe mitbrachten.
Gildevorschriften verlangten, dass Auszubildende mindestens vier Jahre Abstand voneinander hatten, sodass es in einem Geschäft nie mehr als zwei Lehrlinge gleichzeitig gab. Es wurde behauptet – und vielleicht ernsthaft geglaubt –, dass die Lehranfänger vier Jahre lang eins zu eins angeleitet werden mussten; doch das Gesetz war auch dazu gedacht, die erfolgreicheren Handwerker daran zu hindern, sich durch die Beschäftigung einer großen Anzahl von Lehrlingen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
Familien, die das Lehrgeld nicht aufbringen konnten, überantworteten ihre Söhne zusätzlich als Haushaltshilfe. In einer Zeit ohne Elektrizität, fließendes Wasser und Zentralheizung arbeiteten die Jungen ihren Lehrvertrag mit Hausarbeit ab. Dazwischen erlernten sie an fünf Tagen der Woche zwölf bis fünfzehn Stunden das Handwerk, mit zwei 90-minütigen Essenspausen und einem weiteren Zehnstundentag am Samstag. Mit dem arbeitsfreien Sonntag, rund 30 kirchlichen Feiertagen und freien Samstagabenden kam das Arbeitsjahr auf etwa 240 sehr lange Tage. Mitte des 19. Jahrhunderts begannen die Unterkünfte sich deutlich zu verbessern, doch zu Beginn des 18. Jahrhunderts, so Sylvette Milliot, lebte der Lehrling in einem zur Straße hin geöffneten Laden mit einem zweiten Raum, der dem Meister und seiner Familie als Küche und Schlafzimmer diente, »im besten Fall auf dem Dachboden«.230 Mit Ausnahmen für Schwiegersöhne oder die Söhne von Kollegen, bestand die Abschlussprüfung aus einem sogenannten Meisterstück, das oft etwas kleiner als ein Instrument in Originalgröße war. Unter der Annahme, dass es die Prüfer genehmigten, zahlte der neu qualifizierte Handwerker dann seine Registrierungsgebühr – 17 Livres im Jahr 1715, 18 Livres im Jahr 1730 – und nahm seinen Gesellenbrief in Empfang.
Wenn er in einer der erfolgreichen Werkstätten mit einem Entgelt von sechs Livres pro Tag – drei in bar, drei für Unterkunft und Verpflegung – eine Anstellung fand, durfte er darauf hoffen, die Kosten seiner Ausbildung innerhalb von zehn Jahren abbezahlt zu haben. Zumindest theoretisch hätte er dann eine eigene Werkstatt eröffnen können, doch das konnten sich nur wenige leisten. Der normale Lauf der Dinge war es, gegen Lohn in derselben oder in einer anderen Werkstatt zu arbeiten, in der vorausgesetzt wurde, dass er bei Bedarf auch jede andere Arbeit verrichten würde.
|73| Der Meister konnte nun je nach Vorlieben und Volumen so viele dieser Mitarbeiter beschäftigen, wie er wollte, und unter der Voraussetzung, dass beide einverstanden waren, konnte ein Mitarbeiter auf unbestimmte Zeit bleiben. Wenn der Meister starb, heiratete der Geselle trotz eines manchmal erheblichen Altersunterschiedes häufig dessen Witwe, die oft die Geschäftsführerin war. Marie-Jeanne Zeltener, die nacheinander vier Gesellen heiratete, überlebte mindestens drei von ihnen, darunter Louis Guersan (um 1700–1770), der mit seiner Werkstatt – »in der Nähe der Comédie Française«, wie seine Etiketten betonen – der Hill des Paris des 18. Jahrhunderts war. Zeltener hinterließ einen Schrank mit 31 Kleidern und Unterröcken, deren Wert insgesamt auf 2.600 Livres geschätzt wurde.231
Der Schritt vom Kunsthandwerker zum Geschäftsinhaber war mit hohen Kosten für den Kauf, für Miete und Ausstattung der Räumlichkeiten sowie für die obligatorische Einweihungsfeier verbunden und somit sehr groß. Der Handwerker war jetzt zwar ein Kaufmann, doch die Verordnungen der Gilde gestatteten ihm nur einen einzigen Laden und verpflichteten ihn, dort ausschließlich selber zu verkaufen, sodass Verkäufe außerhalb von Ladengeschäften fahrenden Händlern überlassen waren. Auch der Erwerb von Holz und anderen Rohstoffen unterlag Überprüfungen, nicht zuletzt um sicherzustellen, dass niemand den Markt zu vorteilhaften Preisen aufkaufte, um dann die Ware mit einem Aufschlag weiterzuverkaufen. Der Wettbewerb war soweit wie möglich auf die Qualität des Produktes beschränkt. Besondere Arbeiten wie Vergoldung oder Intarsien wurden manchmal ausgelagert, obwohl manche Geigenbauer auch selber in der Lage waren, Schnecken anzufertigen, die in Gänseblümchen oder einer eleganten Muschel endeten.
Erfolg war die Summe aus handwerklichen Fähigkeiten, Geschäftssinn und dem Markt, wie Milliot feststellte. Der erstere Summand wurde bis zu einem gewissen Grad durch die Gilde kontrolliert. Der zweite war wie Mathematik, Sprachen, musikalische oder sportliche Fähigkeiten etwas, das einige Leute hatten und andere nicht. Der dritte lag wie das Wetter außerhalb jeder Kontrolle.
Dann war da aber auch noch das Glück. Die letzten Jahrzehnte des Ancien Régime verliefen für die französische Krone bekanntlich bemerkenswert schlecht, doch in Paris – und Potsdam und Parma – führten sie für den Geigenhandel zu einem Frühling. Zunächst stellten sich Berufsmusiker als Kunden ein, doch das war erst der Anfang, es folgten Kollegen und Schüler der Musiker, die Beamten, die deren Orchester und Instrumente verwalteten, nicht zuletzt Arbeitgeber wie Marie Leczinska, die Ehefrau von Louis XV., mit ihren drei Kammermusiken pro Woche und ihrem Tross von musikalisch begabten Kindern einschließlich des Dauphin und Madame Adelaide, beide begeisterte Geiger.
Guersan, zweites Kind eines früh verstorbenen Webers, der ihm nichts hinterlassen hatte, gab den Takt für gesellschaftliche Mobilität vor. Er war seit |74| seinem 25. Lebensjahr in der Werkstatt tätig gewesen, zog aber bereits mit 30 Jahren in eine elegantere Nachbarschaft, in der der Virtuose Leclair, die Komponisten Guillemain und Rameau und der junge Prinz von Guémenée, ein ernst zu nehmender Amateurcellist, zu seinen Kunden zählten. 1754 wurde er zum »Geigenbauer von Monseigneur dem Dauphin«, dem späteren Louis XVI., ernannt.
Der Zusatz »in der Nähe der Comédie Française« auf seinem Zettel war ein Signal, das auf mehr als nur den Standort hinwies. Er hatte alles: persönlichen Charme, erstklassige gesellschaftliche Verbindungen, günstige Handels- und Kreditbedingungen, technische Fähigkeiten für Reparaturen und Restaurierung und repräsentative Räume für elegante Empfänge. Seine Spezialität war der Umbau von Gamben zu Celli. Der Prozess, der durch den Ersatz von kleinen durch große Bassbalken und von kurzen, geraden Griffbrettern durch längere, gewinkelte aus einer barocken Nachtigall die Art von Violine machte, die Paganini seine »Kanone« nannte, war damit Mitte des 18. Jahrhunderts auf einem guten Weg.
Von 1776 an, dem Jahr, in dem Turgot die Gilden abschaffte und die amerikanischen Kolonien ihre Unabhängigkeit erklärten, hätten Angebot und Nachfrage ebenso gut von Adam Smith geplant worden sein können, dessen Wealth of Nations im selben Jahr erschien. Eine wachsende Gemeinschaft von zunehmend qualifizierten Facharbeitern nutzte die Wettbewerbsvorteile durch Materialien und Marktzugang aus. Eine wachsende Zahl von Abnehmern aus der Mittel- und Oberklasse fand gute und sehr gute Instrumente zu erschwinglichen Preisen vor.
Wo ungelernte Arbeiter darum kämpften, ihren Lebensunterhalt mit 100 bis 300 Livres pro Jahr zu sichern – vergleichbar mit den niedrigsten Kosten einer Ausbildung zum Gesellen –, konnte ein staatlich geprüfter Arbeiter nunmehr mit über 700 Livres rechnen, dem Gegenwert des Gehaltes eines Lateinlehrers am Anfang seines Berufslebens und mindestens so viel oder sogar mehr als das, was Kollegen in anderen Handwerken nach Hause brachten. Ein unabhängiger Geigenbauer konnte zwischen 1.000 und 3.000 Livres im Jahr verdienen, das entsprach dem Gehalt eines Assistenzlehrers in einer Fürstenfamilie und war genug, um ohne Zimmervermietungen oder andere Zusatzeinkommen sorgenfrei leben zu können. Mit 3.000 Livres wurde das Leben ganz entschieden angenehm, 5.000 Livres waren der allgemein anerkannte Schwellenwert zu einem bürgerlichen Status. Einige der Geigenbauer verdienten bis zu 5.500 Livres, sodass sie wie ihre Kollegen in Cremona in Mietwohnungen investierten, ihre Sonntage mit dem Anbau von Obst und Gemüse in den großen Gärten ihrer Landhäuser verbringen und sich an Möbeln, Schränken, Gemälden, Bibliotheken und damit an einem sozialen Status erfreuen konnten, den ihre Eltern und Großeltern nie gekannt hatten.
Für einige der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Branche scheint die Revolution sogar eher eine Unannehmlichkeit als ein großer |75| Zusammenbruch gewesen zu sein. Im Jahr 1790 ersetzte Jean-Henri Naderman, ein weiterer »Geigenbauer der Königin«, sein Ladenschild durch eines, das ihm für eine Welt von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit geeigneter erschien. Auf dem neuen Schild war zu lesen: »An Apollo«, doch es hätte ebenso gut dort heißen können: »Vorsicht, Pragmatismus und Verlegertätigkeit«. Letzteres, seit 1777 Nadermans Nebenerwerb, wurde nun seine Haupttätigkeit, als er sein Warenverzeichnis, das zuerst auf Literatur für Harfe und Tasteninstrumente beschränkt war, um Musik für Blasorchester und eine achtteilige »Marche des Marseillois« erweiterte.232
Georges Cousineau fand es ratsam, seinen Titel »Geigenbauer der Königin« durch »Cousineau, Vater und Sohn, Geigenhändler, Paris« zu ersetzen. Doch trotz eines Lebenslaufes, in dem sein Sohn Jacques-Georges ausdrücklich als »Harfenlehrer der Königin« bezeichnet wird, beauftragte der Wohlfahrtsausschuss diesen, bei der Inventarisierung der von Auswanderern hinterlassenen Instrumente zu helfen. Inzwischen spekulierte Vater Cousineau mit beschlagnahmten Immobilien, vermarktete allerdings im Wettbewerb mit der harten Pariser Konkurrenz weiterhin Violinen bis nach Portugal.
Er starb im Jahr 1800 und hinterließ seinem Sohn nur eine Handvoll von Hypotheken. Jacques-Georges gelang es dennoch, 1805 zum »Geigenbauer Ihrer Majestät der Kaiserin« und zum »Berater für Harfe der Kaiserin Josephine« ernannt zu werden. Wenigstens überlebte der erste Titel die kaiserliche Scheidung und den Aufstieg der neuen Kaiserin Marie-Louise. Als der Wind aus Richtung Waterloo wehte und die zurückkehrenden Bourbonen mit sich brachte, gewann Besonnenheit erneut die Oberhand. Auf der Sterbeurkunde seiner Mutter im Jahr 1815 ist Cousineau als »Geigenbauer des Herrschers« und »Sohn des ehemaligen Geigenbauers der Königin« bezeichnet.
Eine bemerkenswerte Ausnahme war Léopold Renaudin, ein angesehener Geigenbauer, der Mirecourt im Alter von 16 Jahren Richtung Paris verließ und unzählige Kunden glücklich gemacht zu haben scheint, indem er ihre alten Instrumente auf moderne und benutzerfreundliche Größen brachte – ein Verfahren, das im folgenden Jahrhundert so etwas wie eine Pariser Spezialität werden sollte. Am Vorabend der Revolution war er gerade mal 40 Jahre alt und reparierte Bässe für die königliche Akademie, vermietete der Oper Gitarren und produzierte seine eigene Version der Strads, die bei Gastsolisten immer beliebter wurden. Ein Jahr später wurde er in den Bürgerrat seiner Wohngegend gewählt.
Von da an nahm seine Karriere eine Wende, die nicht nur im französischen Geigenbau sondern vermutlich auch in der Geschichte des Geigenhandels einzigartig ist. Im August 1793 wählten ihn seine Kollegen in den Stadtrat, wo er von Maximilien Robespierre, dem Anwalt, der zum Revolutionär wurde und der Welt das Konzept der »Terreur« gab, kooptiert wurde. Innerhalb weniger |76| Wochen ließen Robespierres Anforderungen an das Revolutionstribunal die Anzahl der Juroren von 16 auf 30 anwachsen.
Unter den neuen Juroren war Renaudin, der bald über so berühmte Angeklagte wie die Königin, die Girondins, Jacques Hébert, Georges-Jacques Danton und Camille Desmoulins zu urteilen hatte. »Er wollte nie jemanden freisprechen«, so zitierte ihn später ein Zeuge aus seinem eigenen Prozess. Ein neues Gesetz beschleunigte nur das Tempo des Tribunals. Zwischen dem 10. März 1793 und dem 10. Juni 1794 gab es 1220 Hinrichtungen; in den folgenden sieben Wochen waren es 1376. Am 27. Juli zogen in der Nationalversammlung Rebellen, die befürchteten, dass sie die Nächsten sein könnten, einen Schlussstrich und forderten Robespierre und seine Mitarbeiter zum Rücktritt auf. Renaudins Geschäft wurde versiegelt, und er selbst stellte sich der Polizei. Am nächsten Tag wurde Robespierre verurteilt und hingerichtet. Vier Tage später wurde Anklage gegen seinen Oberstaatsanwalt Fouquier-Tinville und weitere Offiziere des Tribunals erhoben.
Im März 1795 sagte Renaudin, der trotz mehrerer Eingaben seiner zunehmend mittellosen Frau immer noch ohne Anklage inhaftiert war, so umsichtig wie möglich als Zeuge zu seiner Beziehung zu Robespierre aus. Im Lauf des Verfahrensmarathons im März und April sprachen acht Zeugen zu seiner Verteidigung, darunter ein Arzt, ein Zahnarzt, ein Musiklehrer, ein Trio von Handwerkern und der Präsident seines Gemeinderats. Er selber, Renaudin, hielt sich an die Argumentation von Fouquier, der darauf bestand, nur Befehlen gefolgt zu sein. Unter Tränen, so ein Berichterstatter, erklärte er seine Liebe zu seiner Frau und wies auf seine väterlichen Pflichten hin. Das Gericht blieb ungerührt. Gefragt, ob die Angeklagten Verursacher oder nur Beteiligte einer fehlgeleiteten Justiz waren, befand die Jury nur Fouquier als Verursacher. Doch auf die Frage, ob 31 Mittäter mit bewusster Bosheit gehandelt hatten, befand das Gericht 16 von ihnen für schuldig und verurteilte sie zum Tod, darunter Renaudin.233
Selbst der Höhepunkt des Terrors konnte Nicolas Lupot, den »französischen Stradivari«, nicht davon abhalten, sich im Jahr 1794 in Paris niederzulassen und einen Laden zu eröffnen, in dem er – nach Beare und Milliot – nicht nur »den Maßstab schuf, an dem der Rest der großen französischen Schule gemessen wird«, sondern auch beispielhafte Standards für eine politische Steuerung setzte.234 Im Jahr 1813, in dem sich Napoleon bereits ungebremst auf rutschiger Bahn befand, wurde Lupot zum Geigenbauer der kaiserlichen Kapelle ernannt. Nur drei Jahre später wurde er zum Geigenbauer der königlichen Musikschule berufen, aus der bald ein Konservatorium werden sollte.235
Der Goldregen ließ noch eine Generation auf sich warten, bis die Truppen aus Waterloo und die Bourbonen aus dem Exil zurückkehrten und sich der Staub der Geschichte gesetzt hatte. Doch das vor der Revolution geschaffene |77| Sach- und Humankapital, das in Immobilien, täglichen Reparaturen und pragmatischem Überleben versteckt worden war, machte sich nun bezahlt, und die Dinge verbesserten sich zusehends. Über Paris hatte sich bereits 1818 der Himmel aufgehellt, als J. B. Vuillaume im Alter von 20 Jahren mit sechs Livres in der Tasche in die Stadt kam. Später folgten ihm drei seiner Brüder, die mit ihm und ihren Altersgenossen Europa für mindestens drei Generationen in einer Weise dominierten, wie es Napoleon nie getan hatte. Ihre Schatten waren an der Schwelle zum 21. Jahrhundert immer noch auf der New Yorker West 54th Street zu spüren, wo René Morel und Gael Français weiterhin das taten, was ihre Vorfahren in Mirecourt ein Vierteljahrtausend zuvor begonnen hatten.
Das Prinzip hinter der neuen französischen Vorherrschaft war einfach. Seit den Zeiten von Andrea Amati zog es Violinen zur Macht und zum Geld. Vor und nach der Revolution zog es Macht und Geld nach Paris. Der dritte Schritt war einleuchtend, aber die Mechanismen, die ihn erfolgreich machen sollten, waren es nicht.
Der erste Synergieeffekt beruhte auf der Dynamik, die italienische Musiker und Instrumente – ebenso wie italienische Köche, Maler, Bildhauer, Tanzlehrer, Landschaftsarchitekten und praktisch jede andere Kunst und jedes Handwerk – spätestens seit den Medici nach Norden und französische Gelehrte, Künstler, Geistliche, Kaufleute und vor allem Soldaten spätestens seit Charles VIII. nach Süden zog. Diese Kombination machte es nahezu unvermeidlich, dass seit spätestens 1770 sowohl französische Musiker als auch Sammler unter den Ersten waren, die italienische Geigen entdeckten, kauften, enteigneten und begehrten und die in das Handwerk einheirateten und von italienischen Geigen – mit besonderem Augenmerk auf Strads – lernten.
Der zweite Synergieeffekt entstand aus dem Zusammenhang mit der Musik, die Paris zur Geigenhauptstadt machte, während Italien – mit viel indirekter Hilfe durch französische Staatsmänner und Generäle – langsam den Betrieb einstellte. London und Wien waren ebenfalls anziehend, doch keine der beiden Städte konnte es mit der sich selbst tragenden Infrastruktur der Amateur- und Profimusiker, Sammler, Lehrer, Konzertmanager und Gönner aufnehmen, die sich um das neu gegründete Pariser Konservatorium und seinen italienischen Leiter Luigi Cherubini – französischer Bürger seit den 1790er-Jahren – versammelten. Das Ausmaß des Bestands, die Vielfalt der Auswahl und des technischen Sachverstands, über die die ungefähr 30 Pariser Händler, 19 Instrumentenbauer, fünf Bogenmacher und fünf Saitenmacher an der Schwelle der 1830er-Jahre verfügten, waren ebenfalls unerreicht.236
Der dritte Synergieeffekt – gleichermaßen ein Erbe von Louis XIV., der Revolution und Napoleons – bestand aus der ganz eigenen französischen Mischung aus Konservatismus und Emanzipation, von Hauptstadt und Provinz, die ehrgeizige junge Geigenbauer zu Charakteren in einem Balzac-Roman |78| machte, während sie die Wechselseitigkeit, mit der sich die Angebotsseite in Mirecourt und die Nachfrageseite in Paris ergänzten, zu einem nationalen Modell werden ließ. Paris wandte sich auf der Suche nach Instrumenten, Bögen und Zubehör sowie nach Mitarbeitern und Auszubildenden nach Mirecourt, Mirecourt wandte sich für Bestellungen nach Paris, und der Verkehr zwischen den beiden Städten lief ununterbrochen. Auf beiden Seiten fand eine strenge Arbeitsteilung statt, häufig mit der Hilfe von Familienmitgliedern.
Der exemplarische Mirecourter, ausnahmslos männlich, verließ die Stadt in seiner Jugend, um nach Paris zu gehen, wo er dann, beginnend um sieben Uhr morgens, vier Jahre lang Winter wie Sommer und für 4 Francs pro Tag an rund 300 Tagen ein Arbeitspensum von zehn bis zwölf Stunden absolvierte. Nach Abschluss seiner Ausbildung stieg seine Tageseinnahme auf 7 Francs – sofern er nicht Akkordarbeit verrichtete.237 Zumindest im Prinzip war der Lohn dieses Elends eine unabhängige Existenz, ein Familienbetrieb und irgendwann die Rückkehr in einen angenehmen Ruhestand, oft genug in Mirecourt.
In der Schwerpunktsetzung gab es deutliche Unterschiede. Während ungefähr ein Dutzend Pariser Geigenbauer auf eine exklusive Kundschaft abzielte, strebte Mirecourt den Massenmarkt an. Wo die Pariser schätzungsweise 12 Prozent ihrer Produkte exportierten, waren es bei den Mirecourtern drei Viertel und mehr ihrer zahlenmäßig sowieso größeren Produktion. Im Jahr 1839 baute die Werkstatt von Charles Buthod in Mirecourt aus Gründen der Umsatzsteigerung etwa 900 Instrumente pro Jahr. Vuillaumes Werkstatt in Paris produzierte 150 Stück.238
Aber zu einem wirklichen Durchbruch kam es erst eine Generation später. 1857 trat der 24-jährige Louis Emile Jérôme Thibouville-Lamy, dessen Familie seit 1790 im Instrumentenbau tätig war, in das Unternehmen Husson-Bouthod & Thibouville ein. Er brauchte nur ein Jahrzehnt, um es als Alleininhaber zu übernehmen. Ein weiteres Jahrzehnt später hatte er die Produktion rationalisiert und mechanisiert, in Wien Violinen zu 5, 10 und 20 Francs zum Kauf angeboten und vier Fabriken gegründet, die insgesamt 420 Mitarbeiter beschäftigten. Allein die Jahresproduktion in Mirecourt betrug 25 000 bis 30 000 Instrumente, akribisch sortiert nach Stil und Materialkosten. Thibouvilles Katalog für das Jahr 1867 bot eine Auswahl von 28 Geigenbögen und 48 Violinen. Im Jahr 1900 hatte Drögemeyer, sein Konkurrent aus Mirecourt, die Auswahl auf 360 Modelle erweitert.239
Die Spitze des französischen Geigenbaus zeigt sich in zwei Geschichten, von denen die eine individuell, die andere kollektiv ist. Das Individuum ist Vuillaume »dieser Wal des Geigenhandels«, »dieser Rastignac«, wie Emanuel Jaeger ihn anlässlich seines 200. Geburtstages nannte.240 Das Kollektiv ist die Familie Chanot, später Chanot-Chandon, in deren Generationen sich die Erfahrungen |79| eines Handels, eines Berufes, einer Kultur, sogar einer Nation widerspiegeln – vom Niedergang des Ancien Régime bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts.
Sie waren zeitlebens Konkurrenten, die einander respektierten, und beide gingen sie aus der Aufklärung des 18. Jahrhunderts hervor, die in der napoleonischen Zeit immer noch nachleuchtete. 1817 erfand Félix Savart, ein 20-jähriger Arzt, der mehr an Akustik als an Patienten interessiert war, eine trapezförmige Violine mit senkrechten, bleistiftähnlichen Schalllöchern, die entfernt an eine Balalaika erinnerte und es bis zur Serienproduktion durch Geigenbauer brachte, die ernsthaft davon überzeugt waren, dass die Geige zu einer noch größeren Vollkommenheit gebracht werden konnte als die, die ihr die von der Empirie geleiteten Cremoneser bereits verliehen hatten. Aber sie wurde kein Erfolg.241
Im selben Jahr, in dem Savart seine Trapezvioline präsentierte, erprobte die Musikabteilung der Académie Royale des Beaux Arts eine weitere Erfindung. Diesmal hatte das Instrument eine Gitarrenform mit einer Schnecke, die nicht in Richtung des Spielers, sondern von ihm weg wies. Ein paar Jahre später bewies sein Schöpfer, François Chanot, dass sein Instrument sogar Platz für eine fünfte Saite hatte und damit auch als Bratsche einsetzbar war.242
Ebenso wie Savart war Chanot ein Wissenschaftler und entschlossen, die theoretischen Voraussetzungen eines grundlegend auf Erfahrung und Eingebung beruhenden Handwerks aufzudecken. Geboren 1788, stammte er aus Mirecourt, wo schon sein Vater Geigen gebaut hatte. Es wurde eigentlich vorausgesetzt, dass er in das Familienunternehmen einsteigen würde. Stattdessen trat er mit 19 Jahren in ein Polytechnikum ein, machte einen Abschluss als Schiffsingenieur und arbeitete sich bis zum Kapitän und Konstrukteur eines Schiffes mit 74 Kanonen hoch.
Mit der Schlacht von Waterloo endete das halbe Jahrzehnt seines beeindruckenden Aufstiegs. Zum 1. Januar 1816 wurde er aus dem Dienst entlassen, denn man verdächtigte ihn bourbonenfeindlicher Ansichten. Sein Antrag auf Revision wurde abgelehnt, und mit einer Abfindung von 1.750 Francs verließ er Paris und ging mangels Alternativen zurück nach Mirecourt.
Seine Rückkehr nach Paris mit einem Prototyp und einem erläuternden Papier erbrachte ihm ein Zehnjahrespatent, und es schien sich eine vielversprechende zweite Karriere abzuzeichnen. Er hatte ein Streichquartett und einen Bass gebaut; brachte Pierre Baillot, den amtierenden König der französischen Geiger, dazu zu zeigen, was in seinem Instrument steckte, er gründete eine Firma in Mirecourt, um die Pariser Nachfrage befriedigen zu können und überzeugte sogar Nicholas-Antoine Lété, den orgelbauenden Sohn eines weiteren Mirecourt Clans, 20.000 Francs in sein Unternehmen zu investieren. Nach seiner Rehabilitation überließ er das Unternehmen seinen Partnern und kehrte in den Dienst der Marine zurück.
|80| Seine vier Jahre im Violingeschäft waren vielversprechend, doch sie hatten erst begonnen, sich auszuzahlen. Chanots Instrumente, obwohl gut gemacht, von der Streicherfakultät des Konservatoriums mit Hochachtung angenommen und bei einem Preis von 300 Francs durchaus wettbewerbsfähig, wurden bald Kandidaten für das Instrumentenmuseum.243 Dennoch hinterließ er ein doppeltes Erbe. Das eine war sein jüngerer Bruder Georges, der nach Paris geschickt wurde, um bei der Fürsorge für François’ Kinder zu helfen. Das andere war Vuillaume, der Mirecourt verlassen hatte, um in der Pariser Werkstatt zu helfen.
Vuillaumes einzigartige Fähigkeit, sich von anderen abzugrenzen und erfolgreich zu sein, sollte ihn im kommenden halben Jahrhundert auszeichnen. Wie Millionen seiner Zeitgenossen verbrachte er sein Arbeitsleben auf einer der großen politischen Bruchlinien. Doch drei Revolutionen, ein zweiter napoleonischer Staatsstreich, eine preußische Belagerung und mindestens ein Bürgerkrieg scheinen ihm nichts Schlimmeres eingetragen zu haben als ein paar Unannehmlichkeiten während der Kommune von 1870, die es angeraten sein ließ, Paris zu verlassen und auf das Anwesen seiner Tochter zu ziehen.244 Wie Millionen seiner Zeitgenossen verbrachte Vuillaume sein Arbeitsleben aber auch an der Schnittstelle zweier Epochen. Zu Beginn seiner Karriere wich die aufklärerische Wissenschaftsgläubigkeit, die ihn nach Paris gebracht hatte, der romantischen Leidenschaft für Geschichte. Rothschilds und Pereires rundeten ihre kurz zuvor erworbenen Antiquitätensammlungen mit makellos gestalteten Faksimiles ab.245 Der Palast von Westminster, der Bahnhof Paddington, Neuschwanstein und das neue ungarische Parlamentsgebäude bezeugten auf je eigene Weise die Bewunderung der Vergangenheit. Doch nur wenigen gelang ein solcher Brückenschlag zwischen Innovation und historischem Bewusstsein wie Vuillaume.
»Werdet reich durch harte Arbeit, Sparsamkeit und Ehrlichkeit«, hatte König Louis-Philippes Premierminister François Guizot seiner normannischen Wählerschaft im Jahr 1841 empfohlen. Vuillaume setzte Guizots Rat 20 Jahre lang in die Praxis um. 1838 hatte er ein erstes Haus für 80.000 Francs, dann ein weiteres für 120.000 Francs gekauft. Wie alle solche Investitionen seit der von Nicolò Amati wurde das zweite Haus als Goldesel benutzt. 1843 kam für weitere 38.000 Francs ein Landhaus mit weitläufigen Gärten und Nebengebäuden hinzu, wohin er sich schließlich in den Ruhestand verabschiedete und damit nebenbei die Pariser Verbrauchssteuer auf importiertes Holz umging.246 Ein paar Jahre später fügte er für 72.200 Francs ein drittes angrenzendes Stadthaus hinzu – zu einer Zeit, in der selbst die besten Strads immer noch für 5.000 bis 7.000 Francs zu haben waren.247
In Vuillaumes Augen war es schwerer, Geld zu behalten, als es zu verdienen, doch beherrschte er auch diese Kunstfertigkeit. Lange Zeit verweigerte er seiner Frau eine Kutsche, obwohl sie sich einen ganzen Fuhrpark hätten |81| leisten können; er selbst war lieber auf Schusters Rappen unterwegs. Doch er verheiratete seine beiden Töchter mit einer Mitgift von jeweils 1.000 Francs plus einer Goldmünze – einen Écu –, die er bei seiner Ankunft in Paris im Jahr 1818 aus Mirecourt mitgebracht hatte.248 Da er für den Immobilien- und Wertpapiermarkt ein ebenso feines Gespür hatte wie für die Qualität des Holzes in alten Chalets und selbst für die von in ihrer Rinde gelagerten Bäumen, diente er seinem Brüsseler Bruder auch als Anlageberater.249
In seinen Memoiren erinnert sich der Glasgower Geigenhändler David Laurie, der regelmäßig Geschäfte mit den Vuillaumes machte, an einen Donnerstag in deren Landhaus und Werkstatt, wo sich der alternde Jean-Baptiste einmal wöchentlich für eine offene Haus- und Bürostunde zur Verfügung stellte. Er fand den Besitzer, der bereits eine Legende war, dabei, seinen patentierten Lack in bester Stimmung an Geigenbauer zu verkaufen, die von ihm als Berühmtheit fasziniert waren. Selbstverständlich, so gab Vuillaume zu, nachdem die Besucher ihn verlassen hatten, war es nicht der Lack, den er selbst verwendete.250
Dennoch war es ihm um die Zufriedenheit seiner Kunden ebenso zu tun wie um die Qualität seines Produktes. Vuillaume war in beiderlei Hinsicht erfolgreich und exportierte schätzungsweise 75 Prozent seiner Produktion.251 Beginnend mit Paganini, dessen Guarneri er in Gegenwart ihres entsetzten Besitzer öffnete,252 arbeitete er mit und für die Großen der Zeit, darunter der norwegische Virtuose Ole Bull,253 der belgische Virtuosen Charles-Auguste de Bériot und der eigene Schwiegersohn Jean-Delphin Alard, Professor am Konservatorium. 1851 präsentierte er auf der Weltausstellung in London neun Kopien und gewann die höchste Auszeichnung. Bei seiner Rückkehr in die Heimat wartete auf ihn die Rosette der Ehrenlegion.254
Den Grundstein für seinen Erfolg hatte er bereits wenige Monate nach seiner Ankunft in Paris gelegt. Ebenso wie Chanot und Savart war sich auch Vuillaume sicher, dass die Geige immer noch verbessert werden konnte, doch erkannte er auch, dass es ihre italienische Vergangenheit war, um die die Öffentlichkeit sich riss. Er machte es sich zur Aufgabe, ihr zu geben, was sie wünschte. Aber auch wenn Amateursammler manchmal drei oder vier alte italienische Instrumente auf einmal kauften, lag die eigentliche Herausforderung darin, Instrumente zu verkaufen, die sich auch die Spieler leisten konnten.
Seine Lösung war wunderbar einfach. Für diejenigen, die sie bezahlen konnten, gab es alte Italiener von alten Italienern. Für diejenigen, die das nicht konnten, gab es alte Italiener von Vuillaume ab 200 Francs. Aber auch das war nicht billig in einem Land, in dem von etwa 30 Millionen Einwohnern nur 200 000 pro Jahr die 200 Francs an direkten Steuern bezahlten, wodurch ihnen erlaubt wurde, ihr Wahlrecht auszuüben. Doch war es im Vergleich zu den üblichen Preisen für Strads immer noch günstig. Anlässlich eines Symposiums |82| zu Vuillaumes 200-jährigem Jubiläum zitierte Morel den Geigenbauer: »Sehen Sie, Sie werden eine exakte Kopie einer Stradivari mit Lack, Ton usw. bekommen, niemand erkennt den Unterschied, meine Instrumente kosten aber nur 500 bis 800 Francs, also warum eine Strad kaufen, die Sie nicht für unter 6.000 bis 8.000 bekommen können?«255 Und das meinte er genau so und verlangte für seine Kopien von Strads, Guarneris und Amatis fast das Dreifache dessen, was zu dieser Zeit für originale Mantegazzas, Balestrieris und Gragnanis verlangt wurde – und er bekam es offenbar auch.256
Als Vuillaume im Alter von 76 Jahren starb, hatte er etwa 3000 Instrumente gebaut und alle zur Bestätigung seiner eigenen Rolle in ihrer Herstellung nummeriert und signiert. Allein zwischen 1842 und 1850 entstanden 464 Instrumente257 – eine Anzahl, die sowohl im Durchschnitt als auch in der Gesamtsumme deutlich über derjenigen von Stradivari lag, der wesentlich länger arbeitete. Die Verstärkung kam dabei von unterstützenden Mitarbeitern, die Vuillaume angestellt hatte, um für ihn – den Pariser Stradivari mit zwei Töchtern, aber keinen Söhnen – die Rollen von Stradivaris Söhnen Francesco und Omobono zu übernehmen.
Mit Preisen, die er nach Materialkosten gestaffelt hatte, waren Vuillaumes Instrumente peinlichst gewissenhafte und zugleich kreative Kopien der wichtigsten italienischen Geigenbauer, künstlerisch neu geschaffen durch einen Mann, der sich ihnen in jeder Hinsicht gleichwertig fühlte. Seine besten Instrumente hatten Konzertqualität. Gemäß Millant machte Paganinis Schützling Camillo Sivori eine glänzende Karriere auf einer Vuillaume-Kopie von Paganinis berühmter Guarneri-»Kanone«, die aber nur eine von vielen war. Im Jahr 1946 spielte Fritz Kreisler auf ihr.258 In den Zeiten ausgedehnter Seereisen ließen vorsichtige Europäer ihre Strads häufig lieber zu Hause und reisten mit einer Vuillaume durch die Vereinigten Staaten. Ein Jahrhundert später, so René Morel, kehrte Aaron Rosand den Vorgang um: Er ließ seine Guarneri zu Hause in Amerika und bereiste Europa und die Welt mit einer Guarneri von Vuillaume. Ruggiero Ricci reiste über neun Monate mit einer Maggini von Vuillaume (die Fritz Kreisler gehört hatte), während sich seine Guarneri in Morels Geschäft befand. Die Rezensionen, mit denen er nach New York zurückkehrte, waren voller Bewunderung für den großartigen Ton des Instruments.259
Derweil arbeitete Vuillaume an einem steten Strom von geistreichen Experimenten und patentierten Erfindungen. Unter ihnen war der Octobass: der »ultimative« Bass, der über 3,45 Meter hoch war und dessen C eine Oktave unter dem des Cellos lag; ein hohler Bogen aus Stahl, den de Bériot ausprobierte und den Paganini tatsächlich als »unendlich zu bevorzugen und denen aus Holz hoch überlegen« bezeichnete;260 ein Bogen, der es einem Virtuosen auf Reisen erlaubte, ihn mit Hilfe eines vorgefertigten Mechanismus ohne professionelle Hilfe zu beziehen; eine Bratsche in tiefer Altlage; ein siebensaitiges Cello als |83| Klavierersatz namens Heptacord zur Begleitung von Rezitativen; eine automatische (d. h. durch das Kinn betriebene) Stummschaltung, die dem Spieler unbequeme Handbewegungen ersparte; und eine Fräse, die Violindecken und -böden für die preiswerteren Modelle seiner späteren Jahre ausformte.261
Nichts davon war ein kommerzieller Erfolg. Aber viele ehemalige Mitarbeiter gehörten zu den erfolgreichsten Adepten der Zunft – unter ihnen die Geigenbauer Hippolyte Silvestre, Honoré Derazey, Charles Buthod, Charles Adolphe Maucotel, Joseph Germain und Telesphore Barbe sowie die Bogenmacher Clement Eulry, J. P. M. Persoit, Dominique, François und Charles Peccatte, Joseph Fonclause, Nicolas Maline, Pierre Simon, F. N. Voirin und Hermann Richard Pfretzschner.262 Diese Auszeichnung war hart verdient. Selbst bei den normalerweise üblichen vier Francs Tageslohn für die alltägliche Arbeit scheint Vuillaume ein außergewöhnlich geiziger Arbeitgeber gewesen zu sein. Da er sehr stolz auf seine eigenen bescheidenen Anfänge war, in denen er regelmäßig nur eine einzige gekochte Birne zu Mittag gegessen hatte, zahlte er seinen Angestellten anfangs nur drei Francs pro Tag und gab ihnen einen Abstellraum als Unterkunft. Doch dank Vuillaumes Werkstatt, so bemerkt Milliot ohne Ironie, wurde die französische Schule zu einer würdigen Nachfolgerin der italienischen, und Fétis konnte – vieldeutiger als vermutlich beabsichtigt – behaupten, dass Paris das Cremona des 19. Jahrhunderts war.263
Vuillaume war der Erste, der den Weg für die Mittelklasse-Strad und den modernen Markt bereitete, doch auch die Nachkommen von Joseph Chanot blieben nicht tatenlos. Sie belieferten die Mittelschicht mit Instrumenten und versuchten, zu ihr aufzuschließen. Das Tempo gab eindeutig der Ingenieur und Marineoffizier François an, dicht gefolgt von seinem Bruder Georges. Ebenso wie Stradivari war er bis ins hohe Alter aktiv, wurde jedenfalls alt genug, um sich darum Sorgen zu machen, ob sein Enkel, der 1870 geborene vierte Georges der Familie, das Abitur schaffen würde. Sein Tod im Jahr 1883 wurde von der Tageszeitung Le Figaro vermeldet.264
Wann der erste Georges in Paris eingetroffen war, ist ungewiss, doch eröffnete er 1821 in einer erst kurz zuvor erschlossenen Pariser Wohngegend sein erstes Geschäft. Zwei Jahre später, im Alter von 22 Jahren, gründete er mit der vier Jahre älteren Marie-Sophie Florentine Demolliens eine Familie. Mit der Geburt eines Sohnes, Auguste-Adolphe, im Jahr 1827 heiratete das Paar und legitimierte damit auch die vier Jahre zuvor geborene Tochter.
Eine Quittung aus dem Jahr 1828 über den Verkauf eines Guarneri-Cellos beweist, dass Georges wusste, wo gute Waren zu haben waren, dass er imstande war, ein italienisches Meisterinstrument als authentisch zu erkennen, und dass er Kunden hatte. Noch bemerkenswerter ist, dass eine auf der jährlichen Exposition des produits de l’industrie française ausgestellte Violine von 1827 bestätigt, dass seine Frau ebenfalls Geigenbauerin war. Als die einzige |84| bekannte Geigenbauerin ihrer Zeit stellte sie mindestens drei Violinen her. Die erste, mit einer lateinischen Inschrift, emaillierten Darstellungen von Engeln und historischen Figuren, die vor einer gotischen Fassade auf alten Instrumenten und vor einem allegorischen Spielmann spielen, den ein Dämon verfolgt, wurde offenbar alsbald von einem unbekannten Pariser Geigenbauer erstanden. Dieses erste Projekt führte zu einem zweiten, das auf Anregung eines Schützlings von Viotti von einem englischen Amateur in Auftrag gegeben war.265
Erhaltene Aufzeichnungen belegen einen stetigen Handel sowohl mit Mirecourt als auch mit Pariser Lieferanten von Saiten, Etuis und Bögen zur Ergänzung von Chanots Kopien italienischer Instrumente. Ständig auf der Suche nach Käufern, investierte er sogar in Englisch- und Deutschunterricht. Dann machte er sich auf die Reise und überließ es seiner Frau, dem jungen Auguste und dem Dienstmädchen der Familie, Rose Chardon, sich um den Laden zu kümmern. 1841 fügte er Spanien und Portugal zu seiner Reiseroute hinzu.
Ein Besuch in London zahlte sich aus, weil Georges dort eine Verbindung zu Charles Reade herstellen konnte. Ein Besuch in Berlin führte ihn zum Konzertmeister des preußischen Königs, der Chanot seine Strad zur Reparatur gab, sowie zu einem lokalen Händler, der seine Strad-Kopie kaufte. Als der Händler nach Philadelphia weiterzog, folgte ihm eine 150 Kilogramm schwere Ladung von Chanot-Geigen, Etuis, Saiten und Noten. Nachdem er auf den französischen Industriemessen in den Jahren 1839, 1844 und 1849 Medaillen gewonnen hatte, ging Chanot nach St. Petersburg, wo er einem lokalen Händler drei Violinen verkaufte, bevor er über Dresden, Leipzig, Wien und Hamburg wieder nach Paris zurückreiste. Zwischen 1845 und 1858 war seine ausländische Kundschaft genauso zahlreich wie seine inländische, einschließlich der Stammkunden in Zürich, Berlin, St. Petersburg und Istanbul. Der Kundendienst ging so weit, dass der in London etablierte Maucotel, der ebenfalls aus Mirecourt stammte, Chanot nicht nur als einen Lieferanten betrachtete, sondern ihn über einen in London ansässigen französischen Kunden mit 3.000 Francs und dem Auftrag ausstattete, das Geld in sardische Eisenbahnaktien zu investieren.266
Nach drei Umzügen in 20 Jahren verlegte Georges Chanot die Werkstatt 1847 in neue Räumlichkeiten, in denen sie bis 1888 blieb, während die Familie vier zunehmend gut möblierte Räume im vierten Stock des gleichen Hauses bezog. Bis zur Einführung fließenden Wassers und der Einrichtung eines Badezimmers sollten etwa weitere 35 Jahre vergehen.267 Aber auch die Tatsache, dass der Vermieter ein Comte de Labord, ein adeliger Parlamentsabgeordneter war, deutet darauf hin, dass der Umzug auch ein sozialer Aufstieg war.
Milliot weist auf drei Erfolgsfaktoren hin. Einer war ein lebhafter und freier Handel nicht nur mit alten italienischen Instrumenten, die beschädigt gewesen oder durch zahllose frühere Händler und Sammler ausgeschlachtet worden waren, sondern auch mit neu hergestellten Teilen, die für Restaurierungen |85| benötigt wurden. Ein anderer war das Warenlager, darunter sechs Guarneris, vier Ruggeris, drei Landolfis, zwei Gaglianos und eine Maggini. Der dritte Faktor war ein Wertpapierbestand, unter anderem mit rumänischen, sardischen, piemontesischen und elsässischen Eisenbahnaktien. Zwischen 1847 und 1859 erwirtschaftete das Unternehmen schätzungsweise 5.000 Francs, eine Summe, die etwa dem Wert von einer oder zwei Strads entsprach. Zum Vergleich: Die Investitionen erbrachten Chanot schätzungsweise 9.800 Francs plus weitere 6.200 für Antoinette, die Schwester des Dienstmädchens.268
Doch obwohl die Geschäfte florierten, geriet die häusliche Lage in schweres Wetter. Im Jahr 1840 verlor Florentine ihren Verstand; sie war zeitweilig sogar gewalttätig, und man verlegte sie in ein Nebengebäude des Hauses einer Schwester in ihrem Heimatdorf. Zurück in Paris, gelang es der Familie, ohne sie auszukommen, so gut es ging. Chanot selber begleitete Auguste-Adolphe nach London, der dort von John Turner, einem angesehenen Händler und Stammkunden, das Handwerk erlernen sollte. Erhaltene Korrespondenzen bestätigen einen herzlichen Empfang, einen Arbeitstag von neun bis zehn Stunden und ausreichend Roastbeef, Kartoffeln und Bier, um den jungen Chanot vom Mittagessen bis zum Frühstück am nächsten Morgen bei Kräften zu halten. In einer Stadt, in der die Winter besonders lang und dunkel zu sein schienen und Auguste-Adolphe nur wenige Freunde hatte, sehnte er sich nach französischen Büchern. Ein branchenweites Liquiditätsproblem ließ ihn dann in das Geschäft seines Vaters zurückkehren, wo er sich als Bogenbauer und Restaurator hervortat. Die Machtübernahme von Napoleon III. im Jahr 1848 war für Auguste-Adolphe ein Schlag. Außerdem fantasierte er, der sich wie so viele junge Männer für das Theater begeisterte, von einem möglichen Erfolg als Bühnenautor. Er starb jedoch – auch hier wieder ein Vertreter seiner Zeit – mit 27 Jahren an Tuberkulose.
Georges II., Sohn des ersten Georges, war von anderem Kaliber. Da er zunächst zögerte, sich dem Geschäft überhaupt anzuschließen, erlernte er zuerst das Bogenmachen, zeigte während einer ersten Verkaufsreise nach London eine frühreife Begabung für den Handel und kehrte als ein noch schwierigerer Mann, als er es schon vorher gewesen war, nach Hause zurück. Als sich bei Maucotel eine Arbeitsstelle bot, schickte ihn sein dankbarer Vater zurück nach London, wo er schnell in eine Affäre mit einem Mädchen verwickelt und zum Duell gefordert wurde.
Hingerissen von einer anderen Engländerin, entschloss er sich, in London zu bleiben, zeugte Georges III. und eröffnete 1857/58 ein eigenes Geschäft. Ein Jahr später starb seine Mutter, und sein Vater heiratete Antoinette, die ihm inzwischen einen Sohn, Joseph Chardon, geboren hatte. Aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen wurde dieser nicht offiziell anerkannt, sondern es wurde vereinbart, dass er mit Beginn seines 18. Lebensjahrs nach und nach das Geschäft übernehmen und unter Aufsicht seiner Mutter am Besitz beteiligt sein |86| sollte, während Georges I., nunmehr 60 Jahre alt, sich auf einen 6.000 Francs teuren Besitz in der Nähe einer Eisenbahnstation zwischen Paris und Versailles in den Ruhestand zurückzog.
1868 wurde die Werkstatt, die ein Fenster zur Straße hin hatte, offiziell in »Chanot-Chardon« umbenannt. Zwei Jahre später bekamen Joseph und eine Angestellte, die er nur einige Wochen später heiratete, einen weiteren Georges, diesmal Georges IV. Der Krieg mit Preußen, der kurz darauf ausbrach, brachte das Unternehmen für mehrere Monate zum Stillstand. George, der weder wie seine ersten beiden Kinder Republikaner, noch wie das dritte Bonapartist war, sah mit Entsetzen, wie Napoleon III. abgesetzt wurde, denn dessen Regime war zumindest für die Wirtschaft gut gewesen.
Es dauerte bis Juli 1871, bis die Pariser Werkstatt wieder eröffnet werden konnte, und während das Land die Kosten für Niederlage und Reparationen verkraften musste, liefen die Geschäfte erst nur langsam an, bevor sie wieder Fahrt aufnahmen. Als ein Jahr später die berühmte Gillott-Sammlung in London zur Versteigerung kam, war Joseph einer der wenigen Ausländer, die kauften, wenn auch – wegen des schwachen Francs – mit Vorsicht.
Nichtsdestoweniger scheinen die Geschäfte ertragreich genug gewesen sein. Zu den Kunden zählten unter anderem die belgischen Virtuosen Henri Vieuxtemps und Hubert Léonard, der Komponist Camille Saint-Saëns sowie unzählige Anwälte, Lehrer und Architekten, die sich an das Haus Chanot wegen seiner zuverlässigen Fachkenntnisse, kunstfertigen Restaurierungen und Ausstattungen wandten.
Inzwischen war eine neue Generation herangewachsen. Der ältere Sohn Frederick scheiterte mit dem Versuch, in dem heftig umkämpften Londoner Markt eine Werkstatt aufzubauen. Sein Bruder Georges-Adolphe hingegen war in Manchester erfolgreich, wo er ein Strad-Cello verkaufte, das Joseph ihm überlassen hatte. Dann rettete er die Familienehre, indem er auf der Londoner Ausstellung von 1885 mit einer Goldmedaille prämiiert wurde.
Nach seiner Rückkehr nach Paris konnte Joseph Georges IV., der als Erster in der Familie ein Gymnasium besucht hatte, für eine weitere Generation der Partnerschaft gewinnen. Die Firma, nun als Chardon & Fils bekannt, unterhielt Beziehungen zu einem treuen Kundenstamm von Lehrern, Orchestermusikern und Amateuren, der sich von der Insel Réunion bis nach Rostow am Don erstreckte. Doch auch wenn Restaurierungen und Begutachtungen immer noch zuverlässige Geldquellen waren, hatten sich die Stars schon lange aus der Kundenliste verabschiedet. Verkäufe alter italienischer Instrumente wurden seltener, und auch der Bau von Geigen war zurückgegangen.
Georges IV., am Vorabend des Ersten Weltkriegs ein 24 Jahre alter Quartiermeister, verbrachte die langen traurigen Kriegsjahre damit, 14 Violinen und vier Bratschen zu bauen und auf der Suche nach Schnäppchen um die |87| Markthalle zu streichen. Sein Sohn André, im Jahr 1914 ein Freiwilliger, wurde aufgrund seiner Begabungen als Cellist und eigenständiger Facharbeiter geschätzt. Er überlebte den Krieg und verwaltete das Orchester der 10. französischen Armee im besetzten Mainz. Später kehrte er in das Familienunternehmen nach Paris zurück.
Die Nachkriegsjahre brachten einen bescheidenen Wohlstand und ein Apartment mit einem Gaveau-Klavier und japanischen Vasen – etwas, das sich der Patriarch Georges niemals hätte vorstellen können. Die Kundschaft bestand jetzt aus Musikern aller Pariser Orchester sowie aus Konzertmeistern von Helsinki bis nach Istanbul und ausländischen Händlern, die selbst aus New York kamen. André war jetzt ein viel bewunderter Bogenmacher. Im Mai 1937, demselben Monat, in dem in Cremona die Strad-Ausstellung eröffnete, sammelte die französische Gilde einschließlich Georges ihre Kräfte für die Pariser Weltausstellung, nicht zuletzt mit freundlicher Unterstützung einer Bürokratie, die entschlossen war, »neue Instrumente zu präsentieren, die fähig sind, mit Hilfe unserer unvergleichlichen Handwerker im Geigenbau, um die die Welt uns beneidet, Amerika den Wert des französischen kreativen Genies zu zeigen«.269
In den Nachwehen eines weiteren unheilvollen Krieges erstand das Haus Chardon unter der Leitung von André und seiner Schwester Josephine noch einmal neu, doch war das sein Schwanengesang. André starb 1963 im Alter von 66 Jahren ohne andere Erben als Josephine, die auch bereits 62 Jahre alt und unverheiratet war. Als ein fernes Echo von Florentine hatte sie sich selbst beigebracht, Bögen zu beziehen und Instrumente einzurichten, führte kleinere Reparaturen durch und kaufte mit der Unterstützung von Kollegen Instrumente. Sie starb mit 80 Jahren, nachdem sie einen Kunden bedient hatte.
Die deutsche Szene war das, was Frankreich hätte werden können, hätte es nur aus Mirecourt bestanden. Zumindest bis zum Ende des 18. Jahrhunderts behielten deutsche Geigenbauer im In- und Ausland respektable Standards bei. Dann entschieden sie sich für die Massenproduktion. Doch selbst in Mittenwald und Markneukirchen, wo Geigen quasi am Fließband produziert wurden wie in Detroit Autos, gab es weiterhin gute, sogar sehr gute Geigenbauer.
Einige Jahrhunderte später, nach der deutschen Wende 1989, musste Dutzenden entsetzter ostdeutscher Besitzer so schonend wie möglich beigebracht werden, dass das, was sie für alte italienische Instrumente gehalten hatten, weder alt noch italienisch war.270 Auch die DDR-Staatssammlung, die das westdeutsche Innenministerium 1990 erworben hatte, bestand fast ausschließlich aus Kopien.271 Mit etwas Ironie könnte man die Geschichte als einen Qualitätsbeweis für deutsche Handwerker ansehen, deren Instrumente über Jahrzehnte alles das geliefert hatten, was die lokalen Konzertmeister, die selber Produkte einer der großen Orchesterkulturen der Welt waren, von ihnen verlangten.
|88| Jakob Stainer, der einzige Deutsche, der in einem Atemzug mit den großen Italienern seiner Zeit genannt wird, ist wegen seiner Karriere, als Beispiel und als ein historiografisches Puzzle ebenso interessant wie Nicolò Amati und Stradivari. Doch im Gegensatz zu ihnen sind seine hinterlassenen Dokumente ungewöhnlich umfangreich. Briefe und Geschäftsunterlagen spiegeln eine Bildung wider, die weder für die Branche noch für die Zeit typisch war, zeigen aber auch eine schwierige Persönlichkeit. Gerichtsakten werfen darüber hinaus ein Licht auf die unruhigen Zeiten, die durch Stainers Hang zu undiplomatischen Meinungsäußerungen und heterodoxen Lesegewohnheiten noch unruhiger wurden.272
Zwangsläufig gibt es auch Leerstellen, beginnend mit dem Datum seiner Geburt in Absam, einem Tiroler Dorf, in dem es offenbar erst 30 Jahre nach Stainers Geburt einen ortsansässigen Priester gab, der Eintragungen in das Kirchenbuch vornahm. Die frühesten Zeugnisse von Stainers Existenz – ein dokumentierter Erbfall des Bruders einer Urgroßmutter mütterlicherseits – stammt aus dem Jahr 1623. Zu diesem Zeitpunkt, so Stainers Biografen, war er mindestens zwei, wahrscheinlich aber schon sechs Jahre alt, hineingeboren in eine Familie von bitterarmen Arbeitern und Bergleuten hoch über der großen Fernstraße zwischen Verona und Augsburg. Doch selbst in kleinen Tiroler Dörfern gab es Schulen, in denen Latein gelehrt wurde, und Kirchenmusik, die Bergleute und Chorknaben sangen. Zwischen 1624 und 1630 scheint Stainer selber Chorknabe gewesen zu sein, möglicherweise am Hof von Innsbruck. In einem Brief von 1669 bezeichnet er das Geigenspiel als eine nützliche Fähigkeit für Geigenbauer, er könnte also zumindest einige Unterrichtsstunden gehabt haben.
Wo er sein Handwerk lernte, ist ein weiteres Rätsel. Wenn die Verbindung zu Innsbruck stimmt, so könnte das für einen Bezug zu Italien sprechen. In Stainers Korrespondenz und in den Erinnerungen anderer Menschen an ihn finden sich Spuren der italienischen Sprache. Aber wohin er ging und wo er arbeitete, kann nur vermutet werden. Füssen wäre eine Möglichkeit, wenn es nicht in den Jahren, in denen Stainer Lehrling hätte sein können, unter der Pest, unter schwedischen Invasoren und dem Dreißigjährigen Krieg zu leiden gehabt hätte. Tirol und Innsbruck waren vor räuberischen Armeen vergleichsweise sicher, doch aus Mangel an einem dortigen Geigenbauer hätte er seine Ausbildung bei einem Tischler beginnen müssen.
Das an Amati orientierte Aussehen seiner Instrumente deutet auf eine Verbindung nach Cremona, ebenso wie ein Zettel aus Cremona von 1645, der 1910 in einer Geige entdeckt wurde, die auch mit »Brüder Amati« signiert war und unter dieser Herstellerangabe in den 1850er-Jahren von Vuillaume an einen Wiener Sammler verkauft wurde. Den Amati-Zettel kann man vergessen, denn beide Brüder waren 1645 schon lange gestorben. Doch als das Instrument 1892 geöffnet wurde,273 fand man keinen Zettel von Stainer, und der |89| »silberne« Klang des Instruments, der Löwenkopf als Ersatz für die Schnecke sowie die deutsche Bauweise deuten ebenso auf Venedig hin wie auf Cremona, was wiederum nach Füssen und Tirol zurückführt.
Angesichts der Armut der Familie ist eine weitere offene Frage, wie Stainer oder sein Vater die Kosten für fünf bis sechs Jahre Unterkunft, Verpflegung und Lehrgeld bezahlen konnten. Die Regeln der Gilde sahen die Eheschließung mit der Tochter eines Geigenbaumeisters als Alternative zur Barzahlung vor, doch Stainers Frau scheint eine Bergmannstochter gewesen zu sein. Sie heirateten im Jahr 1645, etwa zehn Jahre nachdem seine Lehrzeit hätte beendet sein müssen.
Seine frühesten bekannten signierten Instrumente stammen von 1638, als Stainer um die 20 Jahre alt war.274 Die ersten Dokumente über einen Verkauf an den Hof zu Salzburg stammen aus dem Jahr 1644. Im folgenden Jahr verkaufte er schon nach München, und wiederum ein Jahr später erhielt er einen Gesamtauftrag vom Innsbrucker Hof. Weil er aber längere Zeit abwesend war – vermutlich in Venedig auf der Suche nach Pigmentfarbstoffen –, musste ein Teil des Auftrags an Konkurrenten, darunter ein Cousin des Hofuhrmachers und des Hofgeigers, vergeben werden. In den frühen 1650er-Jahren machte es ihm die Kombination von familiären Zufällen, kommerziellem Erfolg und einer bescheidenen Erbschaft von seinem Schwiegervater möglich, sesshaft zu werden. In der Zwischenzeit hatte er sich erfolgreich um die Erteilung eines Wappens beworben – ein bescheidenes Statussymbol, das ihm erlaubte, ohne Eid als Zeuge vor Gericht aussagen zu können. Es zeigt eine Bergziege, die eine Geige hält, darunter die Buchstaben seines Namens.
Zunehmend war Stainer auch als Pate gefragt und so gut beleumundet, dass ihm ein ortsansässiger Kaufmann und später ein Richter 150 Gulden liehen, wahrscheinlich für den Kauf oder die Renovierung eines Hauses. Das Darlehen war das Fünffache dessen, was Stainer dem Bayerischen Kurfürsten für ein ungewöhnlich elegantes Instrument, das mit Ebenholz und Elfenbein verziert war, in Rechnung stellte. 1658 kam es zu einem Auftrag des spanischen Hofes, und im Lauf der Zeit sollten weitere Bestellungen aus Italien, aus Nürnberg, von großen Klöstern und vom Erzbischof von Olomouc (Olmütz) in Böhmen folgen, der ein ganzes Ensemble aus zwei Violinen, vier Bratschen, zwei Gamben und einem Bass wünschte. Der toskanische Großherzog Ferdinando de’ Medici hatte zwei Stainers, der toskanische Virtuose und Komponist Antonio Veracini besaß – als Hälfte seiner Sammlung – zehn.275
1658 war auch das Jahr, in dem Stainer von Ferdinand Karl – dem Tiroler Erzherzog, legendären Mäzen und Ehemann einer Medici – zum Hoflieferanten ernannt wurde. Dieser Titel entsprach nicht ganz dem eines Hofgeigenbauers, doch erlaubte er ihm, Instrumente zu reparieren und sich bekannt zu machen, wenn reisende Virtuosen wie der englische Hofgambist William Young am Hof |90| weilten. Mit dem Tod des Erzherzogs im Jahr 1662 verlor Stainer den Titel, doch gab es eine Wiedergutmachung, als der Kaiser sechs Jahre später eine ähnliche Ernennung vornahm.
1659 führte eine obskure Schlägerei mit ein paar Bauern zu Schadensersatzforderungen. Zwei Jahre später forderte ein anderes Gericht Stainer auf, eine von ihm angefochtene Rechnung von 50 Gulden zu zahlen. Das mutmaßliche Darlehen für sein Haus von 1657 war zehn Jahre später immer noch nicht getilgt. Von diesem Zeitpunkt an ging es nur noch bergab.
Das Österreich der Gegenreformation war in vielen Dingen tolerant, aber nicht, wenn es sich um Protestanten handelte. Stainer selbst war kein Protestant, wurde aber verdächtigt, einige zu kennen und mit ihnen zu sympathisieren. Laut einem Zeugen besaß und las er Bücher, die die katholische Kirche missbilligte, und redete über sie – noch dazu eloquent – mit Bekannten, zu denen ein Schneider, ein Kaufmann und ein Sägewerkbetreiber gehörten. Im Jahr 1668 wurde Stainer vor einen Ausschuss von Kirchenbeamten geladen, offenbar um sich einer Anklage der Verbreitung von Irrlehren zu stellen. Das ursprüngliche Urteil, das von den Beklagten verlangte, in Sackleinen und mit Kerzen zu erscheinen, ihrem Irrtum abzuschwören und sich erneut zum katholischen Glauben zu bekennen, wurde in die Aufforderung umgewandelt, ihre Bücher zu verbrennen. Stainer wurde außerdem inhaftiert, vielleicht, um seine Flucht zu verhindern. Nachdem er ins Feld führte, dass er vertraglich verpflichtet sei, Instrumente zu liefern, wurde er gegen Kaution freigelassen. Er wurde exkommuniziert, 1669 erneut verhaftet und erst entlassen, nachdem er versichert hatte, offiziell in der Kirche Buße zu tun.
Doch während all dies geschah, scheint das Geschäft geblüht zu haben – teilweise begünstigt durch seinen guten Ruf als Geigenbauer von Qualität, teilweise aber auch durch die wachsende Vorliebe für Instrumentalmusik. Doch Liquidität war ein Dauerproblem, denn der Erzherzog – selber überschuldet – zahlte seine Rechnungen nicht. Ferdinand Stickler, Dekan der Pfarrkirche in Meran, der 1678 eine Gambe bestellte, wollte in Wein bezahlen. Stainer erklärte sich bereit, für eine Barzahlung von 16 Talern (statt der üblichen Kosten von 20 bis 30 Taler) anstelle der Schnecke einen Löwenkopf draufzulegen und das Instrument zurückzunehmen, falls es Stickler nicht zusagte.
1679 zahlte der Münchner Hof 150 Gulden auf die Übersendung von Instrumenten an. Dieses Mal erschien die Nemesis in Gestalt fehlender seelischer Gesundheit, möglicherweise eine bipolare Erkrankung. Senn schätzt, dass Sticklers Instrument innerhalb eines Monats gebaut wurde, aber Berichten zufolge musste man Stainer dazu an die Werkbank ketten. Inzwischen fanden sich vermehrt gefälschte Stainers, und er selbst bekam es mit einer steigenden Flut von Schulden zu tun. 1682 versäumte er Zinszahlungen und wurde unter die Obhut eines gerichtlich angeordneten Vormunds gestellt. Ein Jahr später |91| starb er. Nachdem die Schulden bezahlt waren, blieb von seinem Vermögen wenig übrig, und seine überlebenden Töchter fristeten bis zu ihrem Tod ihr Leben als Dienstboten im Haus eines verstorbenen Schwagers.
Doch Stainers Vermächtnis lag in so vielem mehr. Bevor sich über ein Jahrhundert später ein umfassender Wandel im Musikgeschmack abzeichnete und Viotti und die Strad auf der Bildfläche erschienen,276 sollten Stainers »silbertönende« Geigen, die im In- und Ausland gleichermaßen bewundert wurden, für das Gewerbe der Goldstandard bleiben. »Die Geigen aus Cremona sind nur durch die von Stainer überflügelt worden […], dessen Instrumente wegen eines vollen und durchdringenden Tones bemerkenswert sind«, berichtete der englische Musikwissenschaftler Sir John Hawkins in seiner fünfbändigen General History of the Science and Practice of Music (London 1776). In Deutschland, Italien und England konnten Kopisten die Nachfrage kaum befriedigen. Nachfolgende Geigenbauer von Augsburg bis Mittenwald und von Nürnberg bis Prag wurden von Stainers Beispiel beeinflusst und inspiriert.
In Füssen, einer Stadt mit 1400 Einwohnern, in der der Bau von Geigen im italienischen Stil seit spätestens 1666 betrieben wurde, eröffneten im Laufe des 18. Jahrhunderts etwa 80 Meister eine Werkstatt, und unzählige Lehrlinge erlernten das Handwerk. 1752 beantragte Johann Anton Gedler als fünfzehnter Geigenbaumeister die Bürgerschaft. Kein Problem, erklärte der Stadtrat, setzte sich über die Gilde hinweg und genehmigte den Antrag mit der Begründung, dass die aktuelle Nachfrage aus Italien, Frankreich und vor allem Deutschland Hunderte Geigenbaumeister ernähren könne. Ortsansässige Gesellen hatten keine Probleme, Arbeit in Wien, Olmütz, Breslau oder Prag zu finden. 1769 bat ein Meister aus München – der einzige Geigenbaumeister in einer Stadt mit 40 000 Einwohnern – einen ihm bekannten Bäcker aus Füssen um Hilfe bei der Suche nach einem Lehrling.277
Leonhard Mausiell, gebürtiger Nürnberger, verkaufte nach Stainer-Vorbildern gebaute Geigen und Celli an die dortigen Kirchen, kirchlichen Schulen und sogar an das Rathaus. Allein der Nachlass eines lokalen Händlers verzeichnete 38 Mausiell-Violinen und weitere mit Mausiell-Zetteln.278 Interessant wurde eine ansonsten ereignislose Geschichte mit der Ankunft von Leopold Widhalm, einem begabten Gesellen niederösterreichischer Herkunft, der Arbeit in der ersten Werkstatt der Stadt annahm und im Jahr 1745 mit der Tochter des Meisters ein Kind zeugte. Dieses Verfahren war der schnellste Weg zur Bürgerschaft und wurde so regelmäßig benutzt, dass der Stadtrat schließlich Beschlüsse fasste, die seinem Ärger über den häufigen Gebrauch sowohl von Protestanten als auch von Katholiken Ausdruck verliehen.279 Jedenfalls wollten sich Mausiell und Michael Vogel, ein weiterer lokaler Geigenbauer, mit Widhalms Vorgehen nicht abfinden und brachten den Fall vor den Stadtrat. In einem derart abgeschotteten Markt, in dem Widhalm als katholischer Außenseiter |92| im Begriff war, ein ernsthafter Konkurrent für den seit Jahrzehnten anerkannten protestantischen Fachmann Mausiell zu werden, standen die Geschäftsinteressen eindeutig im Vordergrund. Aber in einer Gesellschaft, der Status so viel bedeutete, dass sie die Adjektive in Todesanzeigen vorschrieb und die zulässige Zahl der Sargträger festsetzte, zählte auch der Rang.280
Die Lösung des Problems war überraschend einfach. Der Rat wies zunächst Widhalms Anspruch auf die Familienwerkstatt in Nürnberg zurück, gestattete dann aber dem Paar nicht nur, sich außerhalb der Stadtmauern in der passenderen Nachbarschaft von Soldaten, Prostituierten, Ausländern, religiösen Sektierern und anderen randständigen Handwerkern anzusiedeln, sondern erlaubte Widhalm auch, die Holzreserven seines Schwiegervaters mitzunehmen. Bis zu seinem Tod im Jahr 1776 restaurierte er über 30 Jahre lang Lauten, nahm Harfen in sein Angebot auf, verkaufte seine Produkte vermutlich auch an katholische Stiftungen und exportierte sie Berichten zufolge nach Spanien, Frankreich, Amerika und Russland. Er konnte sogar einen lokalen Verleger und einen kaiserlichen Postbeamten als Paten für seine Kinder gewinnen. Nach dem Tod seiner Frau, die fünf Jahre nach ihm starb, gingen Haus und Werkstatt an zwei Söhne über, die am Ende einen Besitz von geschätzt mehr als 20.000 Gulden hinterließen – ein respektables Vermögen in einer Branche, in der Stradivaris mit 125 Gulden, Stainers mit 75 bis 150 Gulden, Mausiells mit 21 bis 22 Gulden und Widhalms mit 21 bis 55 Gulden bewertet wurden.
Wenn Nürnberg ein Cremona war, wie es sich Wagners Meistersinger ausgedacht haben könnten, so war Mittenwald ein Absam ohne Stainer. Als ein weiterer Umschlagplatz in den Alpen hätte sich das Marktstädtchen ebenso gut auf die Herstellung von Kuckucksuhren und Krippen verlegen können. Dass das nicht geschah, ist Mathias Klotz, 1653 geboren, zu verdanken, der vermutlich eine Lehre bei dem Geigenbauer Giovanni Railich in Padua absolvierte und ein paar Jahre vor Stainers Tod in seine Heimatstadt zurückkehrte. Es gibt keine Hinweise auf eine Verbindung zu Stainer, aber seine Produkte bezeugen Stainers Einfluss.
Ab 1684 arbeitete Klotz in einer zusammengewürfelten Gruppe von mindestens drei Geigenbauern281 und baute dort gute Instrumente, Geigen allerdings wohl erst dann, als sie einige Jahre später in Mode kamen. Die eigenen Instrumente und die seiner Kollegen vermarktete er mit Energie und Unternehmergeist. Am bemerkenswertesten ist jedoch, dass mit ihm eine sich über acht Generationen und bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts erstreckende Dynastie von insgesamt 36 bodenständigen Geigenbauern begann. 1890, fast 150 Jahre nach seinem Tod, bedachte eine dankbare Gemeinde seine Leistung endlich mit einem Denkmal.
Was Mittenwald in der Zwischenzeit auszeichnete, war der allmählich eintretende Wandel vom Handwerk zur Heimindustrie. Dieser Prozess begann schon 1800, als Napoleons Kontinentalsperre den Weg nach England, ein |93| bevorzugter Markt für Mittenwalder Erzeugnisse, blockierte. Zu dieser Zeit waren selbstständige Geigenbauer, die ihre Waren auf Messen anboten und an Klöster verkauften, durch eine Handvoll Zwischenhändler ersetzt worden, die in den Ballungszentren Geschäfte eröffneten, ihr Glück in so weit entfernten Ländern wie Russland oder Amerika suchten und dabei ihr Kapital riskierten.
Einzelhändler lieferten Materialien, schlossen Arbeitsverträge ab und vermarkteten die Erzeugnisse. Kiefernholz fand man vor Ort. Ahorn, der ursprünglich ebenfalls einheimisch war, kam nun immer aus Bosnien, der Herzegowina und der nördlichen Türkei. Ebenholz war natürlich tropisch. Darmsaiten wurden aus Rom, Neapel, Padua, sogar aus dem Mittenwald-Konkurrenten Markneukirchen und von Zulieferern importiert. Die Arbeit selbst war immer ausschließlich saisonal, zum Teil, weil eine kleinbäuerliche Bevölkerung Heu machen und Holz hacken musste, zum Teil, weil Alternativen wie eine Arbeit in der Forstwirtschaft, Kellnerarbeit, Pagendienste in einem örtlichen Hotel, sogar Arbeit als Treiber oder Wildhüter für den bayerischen Prinzregenten, den Großherzog von Luxemburg oder den deutschen Eisen- und Stahlbaron Gustav Krupp von Bohlen und Halbach besser bezahlt wurden. In einem Dorf mit ein paar Tausend Einwohnern unterhielten Vermittler für einen Wochenlohn von 15 bis 25 Mark einen Kader von rund 20 bis 40 regelmäßigen Mitarbeitern. Frauen arbeiteten unabhängig von der Jahreszeit nur beim Auftragen des Lackes. Für die Arbeit im Winter standen 200 bis 250 Männer zur Verfügung und verdienten an Arbeitstagen mit 12 bis 14 Stunden in etwa 8 bis 12 Mark in der Woche. Angesichts der Möglichkeit, in der Forstwirtschaft für 3 bis 4 Mark täglich zu arbeiten ist es einleuchtend, dass der Geigenbau jahreszeitlich bedingt war.282 Dennoch beschäftigte Ludwig Neuner, der vor seiner Rückkehr in das Familienunternehmen im Jahr 1884 sechs Jahre bei Vuillaume verbracht hatte, bis zu 200 Gesellen, um für eine globale Kundschaft eine Angebotspalette zusammenzustellen, die er in Amerika zu Preisen von 2,45 Dollar für Einsteigermodelle bis zu 108 Dollar für ein im Großhandel im Dutzend angebotenes Spitzenmodell mit durch Perlenintarsien verziertem Boden anbot.
Warum die Gewinnspannen so eng waren, ist leicht zu erklären. Mittenwald produzierte am Vorabend des 20. Jahrhunderts 25 000 bis 30 000 Instrumente im Jahr. Ein Teil dieses Erfolges verdankte sich angelernten Arbeitskräften, dem sparsamen Einsatz von Materialien und einer sorgsamen Preisstruktur, die Transportkosten, Lebensmittelpreise und die Versicherung berücksichtigte. Doch der Angelpunkt waren Unternehmer, die bereit und in der Lage waren, ein paar Mark für örtliche Erzeugnisse zu zahlen, die schließlich für 5 bis 300 Mark, durchschnittlich zwischen 30 und 70 Mark, wiederverkauft werden konnten, die deutschen Kunden eine Zahlungsfrist von drei bis sechs Monaten einräumten und die sogar noch länger auf ihr Geld warten konnten, wenn es sich um Schecks aus Russland und Lateinamerika handelte.
|94| Dass bei diesen Preisen das fachliche Können sank, ist kaum verwunderlich. In einem Verfahren, das die Herstellung auf vier Stufen reduzierte, bauten Stainers Nachfolger die Geigenkörper aus Boden, Decke, Zargen und geschnitztem Hals, lackierten das zusammengesetzte Ergebnis oder waren für die Einrichtung des Instrumentes zuständig. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es beinahe niemanden mehr, der wusste, wie man eine komplette Violine baute.
Bayerns König Maximilian II., ein Liberaler mit einem Faible für Kunst und Wissenschaft, gründete 1858 eine Unterrichts- und Musterwerkstatt, in der ortsansässige 14- und 15-Jährige das Handwerk ihrer Väter erlernen konnten. Die Einrichtung sollte nach und nach zu einer der weltweit ältesten und renommiertesten Geigenbauschulen werden. Aber es waren die Zwischenhändler, die mit ihrem offensichtlichen Interesse am Erhalt des Status quo an der Schnittstelle von Angebot und Nachfrage die Schule finanzierten und Grundmaterialien zur Verfügung stellten.
Es dauerte bis 1888, bevor der Lehrplan endlich auf den Bau eines ganzen Instrumentes erweitert wurde, und bis 1901, bevor die Leitlinie darlegte: »Die Mittenwalder Geigenbauschule hat die Aufgabe, ihre Schüler in der Herstellung von Holzinstrumenten zu unterrichten, sodass sie aus den Grundmaterialien eine vollständige und marktfähige Violine bauen und eine alte Geige so reparieren können, dass sie wieder verwendet werden kann.«283 Am Ende brachten die wirtschaftlichen Folgen des Ersten Weltkriegs die lokale Industrie zum Erliegen, obwohl die Nationalsozialisten im Jahr 1938 versuchten, den Ruhm von Mittenwald in der gleichen Weise und aus den gleichen Gründen wiederzubeleben, aus denen ihre italienischen Verbündeten 1937 versucht hatten, den Ruhm von Cremona wieder auferstehen zu lassen.288
Im selben Jahr wurden die Arbeitslosen von Markneukirchen zum Bau einer Straße verpflichtet, die später als »Geigenbauerkurve« bekannt wurde. In der Zwischenzeit begannen emsige Funktionäre, 21 unabhängige Gilden (sieben davon von Instrumentenbauern) unter einem gemeinsamen braunen Dach zu versammeln. Trotz schwacher Exportmärkte, einer steigenden Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften und der Mobilisierung für den Zweiten Weltkrieg zählte die vereinigte Gilde im Jahr 1941 – dem Jahr, in dem Deutschland in die Sowjetunion einfiel und den Vereinigten Staaten den Krieg erklärte – immer noch 257 Mitglieder.285
Von nun an ging es bergab. Ein kommunistisches Nachkriegsregime erklärte Privatunternehmen den Krieg. Diejenigen, die in den Westen hatten fliehen können, ließen das Kombinat Musikinstrumente hinter sich – ein sozialisiertes Fließband mit allein rund 1200 Mitarbeitern in der Produktion von Streichinstrumenten, das vor allem auf den sowjetischen Markt ausgerichtet war.286 Dennoch gab es 1970 noch genug Privatinitiativen, um vor dem örtlichen Instrumentenmuseum ein dezentes, aber unmissverständliches Denkmal für |95| den unbekannten Gildemeister zu errichten. Doch die kapitalistische Vergangenheit, die Markneukirchen einst zu einer der reichsten Gemeinden in Deutschland gemacht hatte, durfte praktisch nicht mehr erwähnt werden.287
Die Wurzeln des Erfolges von Markneukirchen lagen im 16. Jahrhundert, als leicht verfügbare Kiefer- und Ahornhölzer, ein Kupfer-Boom und ein sächsischer Hof mit einem Faible für Instrumentalmusik zu einem Aufstieg handwerklicher Unternehmen führten. Paradoxerweise trug derselbe Dreißigjährige Krieg, der Füssen verwüstet hatte, zum Erfolg von Markneukirchen bei. Der Strom österreichischer Flüchtlinge in das protestantische Böhmen, der durch die Gegenreformation ausgelöst worden war, setzte sich nach 1620 nach dem katholischen Sieg in der Schlacht am Weißen Berg erneut in Bewegung und floh in das benachbarte Sachsen. Die Vorzüge einer bürgerlichen Identität, eines Wochenmarktes und einer auf Mobilität basierenden Dienstleistungsgesellschaft wiesen nach Markneukirchen, das sogar über einen gewählten Richter und über Prozesse vor Schwurgerichten verfügte und wohin ein Dutzend böhmischer Geigenbauer zwischen 1648 und 1677 übersiedelte.288
1677 erkannte Herzog Moritz von Sachsen »die ehrenvolle Zunft der Neukirchener Geigenbauer« an. Von Kandidaten für den Meisterbrief wurde erwartet, dass sie eine Geige, eine Gambe und eine Zither vorlegten. Die Gilde ihrerseits übernahm es, die Prüfer mit Bier, Schnaps und »ein paar Brötchen« zu vergüten und erfolgreiche Prüflinge mit einem Abendessen zu ehren, zu dem »drei Kübel Bier« gehörten. Vier Jahre später tauchte der Geigenhändler Heinrich Götz im lokalen Steuerregister auf wie die erste Amsel im Frühjahr. Was als Nebenerwerb von Fuhrleuten begann, wurde durch Kunden, die so weit entfernt wie Warschau, Straßburg oder Skandinavien wohnten, bald zu einem einträglichen und eigenständigen Geschäftszweig. Ab 1700 arbeiteten in einer Stadt mit 6000 Einwohnern 30 Geigenbauer, darunter vier (von ursprünglichen zwölf) aus Böhmen. 1713 erhielt Elias Pfretzschner als erster Händler einen Meisterbrief.289 Mitte des 18. Jahrhunderts gingen die ersten Exporte der Stadt über Nürnberg nach Nordamerika.290 Es waren jedoch der Zusammensturz der Gilde und der Aufstieg der Händler ein Jahrhundert später, die Markneukirchen so bedeutend und reich machen sollten.
Dieser Prozess begann lange vor der formellen Abschaffung der Gilde im Jahr 1861. Mit ihrem Verbot, Lehrlinge von außerhalb auszubilden, wurde sie als ein Bündnis mit Sperrvertrag angesehen, doch zumindest am Anfang zahlte sich dies in erweiterten Familienbetrieben und einem robusten Lokalpatriotismus aus. Vannes Verzeichnis listet über die Generationen hinweg 15 Gliers, 20 Dollingers, 26 Gläsels und Fickers und 37 Gütters auf – beeindruckende Zahlen, sogar nach den Standards von Mirecourt.291
Klingenthal, Markneukirchens unweit gelegener Wettbewerber, nahm auswärtige Lehrlinge an, verlangte jedoch, dass die Produktion vor Ort |96| stattfand. Im Gegensatz dazu schwieg sich die Charta von Markneukirchen über Verträge mit Auswärtigen aus. 1828 rühmte sich Markneukirchen einer Gilde mit 52 Meistern, sechs Gesellen, zehn Lehrlingen und 40 mitarbeitenden Ehefrauen und Kindern. In Klingenthal waren 145 Meister, sieben Gesellen, elf Auszubildende und 17 Mädchen und Frauen beschäftigt. Jede der beiden Städte stellte rund 7000 Violinen im Jahr her. Aber während die Instrumente aus Klingenthal in traditionellen Werkstätten entstanden, erfolgte die Herstellung in Markneukirchen bereits in kleinen Fabriken, mit wachsendem Interesse am Umsatz, einem Standbein in Russland und einer gut entwickelten Arbeitsteilung. Diese ging bis 1710 zurück, als aus dem Geigenbau zusätzliche Handelszweige entstanden,292 darunter die Einfuhr von Rohstoffen, Wirbeln, Kinnhaltern, Stegen, Hälsen und unfertigen Geigen – also von Einzelbauteilen – von Fachleuten aus umliegenden Städten; auch die unabhängige Bogen- und Saitenherstellung sollte globale Bekanntheit erreichen.
Der vielleicht bemerkenswerteste der neuen Berufe war der des Instrumentenhändlers, der zur entscheidenden Verbindung zwischen einem mitteleuropäischen Lieferanten und dem ersten weltumfassenden Massenmarkt wurde. Schon Ende des 18. Jahrhunderts stand diese Branche in voller Blüte. Das brachte um die Wende zum 20. Jahrhundert nicht nur ein US-Konsulat nach Markneukirchen, sondern auch eine pittoreske Ansammlung wilhelminischer Burgen und italienischer Villen auf den Hügeln oberhalb der Hauptstraße und verhalf einer Gruppe unternehmungslustiger Auswanderer – Hammig, Möller, Wurlitzer, Mönnig – zu Führungsrollen in Berlin, Amsterdam, Cincinnati, New York und Philadelphia.
Ein in Markneukirchen ansässiger Heimatforscher weist gerne darauf hin293 – und das beispielhafte Ortsmuseum bestätigt es –, dass die respektable Handwerkskunst dort nie ausstarb und sogar an ihren Rändern eine Blütezeit erlebte. Ayke Agus, sowohl eine versierte Geigerin als auch Korrepetitorin des großen Jascha Heifetz, spielte eine Ernst-Heinrich-Roth-Geige von 1922. Die »alte deutsche Geige« mit »Teilen aus verschiedenen europäischen Werkstätten« und einer Storioni-Signatur, die von der Jazzmusikerin Regina Carter – MacArthur-»Genie« von 2006 – eindrucksvoll gespielt wurde, klingt ebenfalls sehr nach einem Produkt aus Markneukirchen.294
Doch Markneukirchen wollte nie ein sächsisches Cremona sein oder werden. Ab 1834 wurde die traditionelle Lehrausbildung durch eine Fachschule ergänzt, deren Absolventen die Stadt in ein weltweit anerkanntes Zentrum für Gitarren, Zithern, Mundharmonikas, Akkordeons und Geigen verwandeln sollten. Am Ende des 19. Jahrhunderts wurden 90 Prozent der in 22 Einzelbereichen produzierten Erzeugnisse exportiert.
Bereits 1870 wurden Griffbretter mit von Gas angetriebenen Fräsmaschinen geschnitten, und die neuen Maschinen zeigten so viel Potenzial, |97| dass 1907 eine Aktiengesellschaft mit mehr als 50 Mitarbeitern gegründet wurde, um 52 000 Instrumentenkörper pro Jahr herzustellen. Das wäre auch gelungen, wenn nicht weniger mechanisierte Werkstätten ihre Preise und Profite so weit gesenkt hätten, dass sogar Maschinen nicht mehr mit ihnen konkurrieren konnten. Doch am Vorabend des Ersten Weltkriegs besaß Markneukirchen immer noch einen weltweiten Marktanteil von 52 Prozent für Streich- und Zupfinstrumente und von 96 Prozent für Saiten und hatte zehn Jahre nach Kriegsende diesen Marktanteil weitgehend zurückerobert. Sogar als es auf die Rutschbahn geriet, die von der Weltwirtschaftskrise und dem Aufstieg Hitlers zu 40 Jahren Kommunismus bis zum Fall der Berliner Mauer führen sollte, stellten in Markneukirchen 655 Mitarbeiter in 348 Werkstätten Streichinstrumente her. Mit zusätzlichen Subunternehmern und Spezialbetrieben wurde eine Anzahl von 4247 Mitarbeitern in 1779 Werkstätten erreicht, deren Lebensunterhalt weitestgehend von der Bereitschaft und Fähigkeit weit entfernt lebender Eltern abhängig war, ihren Kindern Musikunterricht angedeihen zu lassen.295
Zu diesen weit entfernten Orten gehörte Japan, wo derselbe Wunsch nach Modernisierung, der zu japanischen Kriegsschiffen und japanischem Baseball führte, auch mit sich brachte, dass Geigen populär wurden. Eine Vorreiterdelegation von Samurai, die im Zuge der Meiji-Restauration den Westen erkundete, kehrte tief beeindruckt von den einheitlichen Bogenstrichen der europäischen Orchestermusiker zurück. 1874 baten Hofmusiker das Marineministerium um eine westliche Ausbildung.
Etwa zur gleichen Zeit erschienen die ersten zaghaften Beispiele eines heimischen Geigenbaus. Die entscheidende Figur war dabei Masakichi Suzuki, geboren 1859 in Nagoya, heute eine bedeutende Industriestadt. Der Sohn eines Samurai wandte sich, nachdem der Kriegerstand abgeschafft worden war, Geschäften zu, nahm nach dem Scheitern des Familienunternehmens Musikunterricht und kopierte 1887 seine erste Violine. Zwei Jahre später zeigte er Rudolf Dittrich, dem ortsansässigen Deutschen am neu eröffneten japanischen Konservatorium, zögernd sein bestes Instrument. Ab 1890 verkauften Vertriebspartner in Osaka und Tokio Suzuki-Geigen für die Hälfte bis ein Drittel des Preises einer importierten Violine, obwohl dies immer noch die Hälfte bis ein Drittel des Monatslohns eines Berufsanfängers als Lehrer oder bei der Polizei betrug und damit keineswegs billig war. Ab 1897 stellten zehn Mitarbeiter 1200 Violinen pro Jahr her, und ab 1907 produzierten etwa 100 Mitarbeiter mit von Suzuki entwickelten Maschinen Tausende von Violinen. Der wirkliche Durchbruch aber kam im Jahr 1914. Da Mirecourt, Mittenwald und Markneukirchen erst einmal unerreichbar waren, erhöhte eine Belegschaft von fast 1 000 Mitarbeitern die Jahresproduktion auf 150 000 Violinen und 500 000 Bögen.296 Ihre Ähnlichkeit mit den Erzeugnissen aus Markneukirchen war kein Zufall.
|98| Dass das eine oder andere Produkt Suzukis in der Zeit nach dem Krieg seinen Weg nach Deutschland fand, schloss den Kreis. 1923 schrieb sich Suzukis Sohn Shinichi für den Sommerkurs an der Berliner Musikhochschule ein und nahm Unterricht bei Karl Klingler, dem ehemaligen Zweiten Geiger des Joachim-Quartetts. In einem auf Englisch geschriebenen Brief informierte der ältere Suzuki vier Jahre später Georg Schünemann, den stellvertretenden Direktor des Konservatoriums, von seiner Absicht, »Ihnen in Zukunft jedes Jahr eine meiner guten Geigen in die Hand zu geben, für einen guten Schüler, der bei Ihnen seinen Abschluss gemacht hat, wenn Sie möchten, dass ich das tue«. Schünemann willigte ein. Im Januar 1928 wurden mehrere Suzuki-Violinen per Post aufgegeben, kamen im März zollfrei in Berlin an und wurden wunschgemäß an bedürftige Studenten weitergereicht.297
Gut 50 Jahre später gründete Soroku Murata in einem Land, in dem Nikon und Minolta längst mit Vogtländer und Zeiss, Sony mit Grundig und Telefunken und Toyota mit Volkswagen auf gleicher Höhe waren, eine Geigenbauschule in Tokio. Als ein Absolvent von Mittenwald, dessen Kopie der »Hellier«-Strad eine Goldmedaille der Violin Association of America gewann, war er erschüttert, dass zwar einerseits junge Japaner das Geigenspiel erlernen konnten, ohne ihre Heimat verlassen zu müssen, dass aber andererseits junge Japaner, die Geigen bauen oder restaurieren wollten, immer noch ins Ausland gehen mussten.
Für universitätsübliche Studiengebühren sowie einem zusätzlichen Drittel dieses Betrags für Werkzeuge konnten sich gleichzeitig acht bis zwölf Schüler für einen vierjährigen Kurs in Theorie und Praxis des Instrumentenbaus bei einem Lehrer einschreiben, der als »Oyakata« angesprochen wird – im europäischen Sinne ein Schreiner- oder Handwerksmeister, kein »Sensei«, wie der Lehrer, Führer oder Trainer im Judo, in der Kalligrafie, der Teezeremonie und dem Klavierspiel genannt wird. Obwohl japanische Musiker einheimische Violinen mit der gleichen Verachtung straften, die sie gegebenenfalls für japanischen Scotch298 zeigten, überstiegen die Zulassungsanträge die Anzahl der verfügbaren Plätze bei Weitem.299 2006 jedoch setzte Murata sich zur Ruhe, und die Schule wurde geschlossen. Indessen baute Tetsuo Matsuda, ein 1945 in einem japanischen Bergdorf geborener Absolvent von Cremona, in seinem Haus in einem Vorort von Chicago weiterhin elegante Guarneri-Kopien und verkaufte sie über Bein & Fushi, einen der großen Händler der Welt, in der Michigan Avenue, einer der großen Straßen der Welt.300
Zu dieser Zeit kam über das ostchinesische Meer ein neuer Zyklus in Gang. Genauso wie das Christentum, indisches Opium und das Fahrrad erreichte die Geige China durch westliche Besucher. Mindestens ein chinesischer Geiger – Tan Shu-zhen – hatte in den frühen 1930er-Jahren den Weg in das Shanghai-Orchester geschafft,301 und Sito Fu-Quan, Mitbegründer des Konservatoriums von Shanghai, hatte sich den Geigenbau mit Hilfe des Handbuchs |99| von Heron-Allen, Robert Altons Violin and Cello. Building and Repairing (London 1923), und einer deutschen Wirtschaftsdelegation, die ihm erklärte, wie man Holz und Werkzeuge aus Markneukirchen bestellt, selbst beigebracht.
In den späten 1940er-Jahren gab es in Shanghai mindestens zehn westliche Musikgeschäfte. In demselben Jahr, in dem die Volksrepublik ausgerufen wurde – 1949 –, wurde auch eine Instrumentenfabrik »Neues China« gegründet. Ein Jahrzehnt später gab es schätzungsweise 50 verstaatlichte chinesische Geigenfabriken, deren ansteigende Produktionskurve, unbeirrt und sogar unterstützt von der vehementen antiwestlichen Haltung der Kulturrevolution, im Jahr 1977 mit nahezu 345 000 Instrumenten ihren Höhepunkt erreichte. Etwa die Hälfte davon war für den Export bestimmt. Tan, ebenfalls Gründungsmitglied des Konservatoriums, sorgte dafür, dass auch eine Werkstatt vorhanden war, in der Lehrer und Schüler kostenlos Instrumente und Reparaturen erhalten konnten. Mit Hilfe eines staatlichen Zuschusses erwarb er mongolische Baumstämme, rekrutierte einen Kader von Tischlern und Holzbildhauern, die italienische Modelle nach den Vorgaben von Heron-Allen kopieren sollten und organisierte in 15 Fabriken im ganzen Land Schnellkurse.
Tan tauchte 1978 aus den Verwüstungen der Kulturrevolution dort wieder auf, wo er aufgehört hatte. Mit 125.000 Dollar aus dem Kulturministerium, die er für gute Instrumente ausgeben konnte, wurde er zum Einkaufen sogar in die USA geschickt. Er kam mit drei Pressendas, einer Vuillaume und der Überzeugung zurück, dass die Ressourcen der Nation in einen langen Marsch hin zur inländischen Produktion investiert werden sollten. Das Ergebnis war ein Vier-Jahres-Curriculum in Geigenbau für eine Klasse mit zehn Schülern pro Jahrgang, von denen erwartet wurde, ebenso gut wie ihre Mitschüler zu spielen und während ihres Aufenthaltes sechs oder sieben Instrumente zu bauen. 1980 wurden zwei Studenten nach Mittenwald geschickt. 1983 wurde Zheng Quan, ein weiteres rehabilitiertes Opfer der Kulturrevolution, nach Cremona gesandt. Vier Jahre später kam er mit Unterstützung der chinesischen Botschaft in Rom mit einem Grundinventar an Büchern, Werkzeugen und Holz zurück und gründete das Forschungszentrum für Geigenbau des zentralen Musikkonservatoriums. Außerdem sollte er die Verfügbarkeit von für den Geigenbau nutzbarem Ahorn prüfen. 1991 belegte eine Zheng-Geige in einem Wettbewerb in Cremona den ersten Platz.302 Indessen konnte die jüngste Version der Markneukirchener Strad – Modell spätes 20. Jahrhundert – sowohl in einem taoistischen Tempel in Suzhou als auch in der Hauptstraße von Parma (wo Paganini begraben ist) über den Ladentisch erworben werden.
Im frühen 21. Jahrhundert waren schätzungsweise 50 bis 80 Prozent der Schülerviolinen auf dem Markt chinesische Instrumente von respektabler Qualität und zu einem erschwinglichen Preis zu haben. Da die europäischen Geigenbauer mit chinesischen Lohnkosten nicht konkurrieren konnten, sahen |100| sie sich entweder nach Maschinen um oder importierten unfertige Instrumente aus China, so wie Markneukirchen sie einst über die böhmische Grenze eingeführt hatte. Sie stellten sie fertig, fügten einen Zettel ein und vermarkteten sie im Internet, genauso wie Markneukirchen ehemals fertige importierte Geigen mit einem Zettel versehen und per Katalog über das Versandhaus Sears Roebuck, angeboten hatte. Schätzungsweise 60 Prozent der chinesisch-europäischen Importe hatten europäische Zettel. Der Rest war unverfälscht chinesisch; das Forschungszentrum des Geigenbaus im zentralen Musikkonservatorium und die Geigenbauabteilung der China Musical Instrument Association kündigten ihren ersten internationalen Wettbewerb im Frühjahr 2010 an, und westliche Händler fragten sich ohne Ironie, wie die chinesischen Geigenbauer so schnell so gut hatten werden können.303