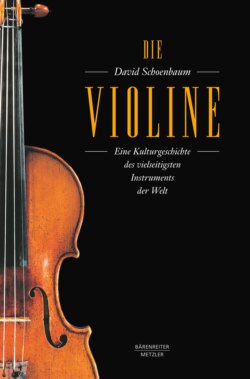Читать книгу Die Violine - David Schoenbaum - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Brennpunkt Frankreich
Оглавление»Hätte es nicht dieses ›Fieber‹ nach Stradivari-Geigen gegeben«, so bemerkte Santoro im Jahr 1973, »wäre es kaum zu den Forschungen über die Cremoneser Schule und die Kunst des Geigenbaus gekommen, die seit dem frühen 16. Jahrhundert in Cremona blühte.«92 Diese Argumentation war sowohl originell als auch zutreffend, galt aber auch umgekehrt: Ohne die Forschung, die von Stradivari inspiriert wurde, und nicht zuletzt die eigene von Santoro, wüssten wir kaum etwas über das »Fieber« und seinen Einfluss auf den modernen Violinenmarkt.
|171| Die zweite Geschichte beginnt dort, wo die erste Geschichte aufhört. Gemäß den Angaben Santoros standen die Geigenbauer bis zu Stradivari auf der Angebots- und die lokalen Spieler – viele von ihnen in den drei Akademien oder Musikvereinen Cremonas organisiert – auf der Nachfrageseite. Nach Stradivaris Tod begannen sich die Dinge zu ändern. »Nachahmer, Spekulanten, Profiteure, Sammler und Forscher«93 wurden nun zu den Hauptakteuren in der Geschichte. Das betraf sowohl die Österreicher als auch die lokale Geigengemeinde, die die großen Werkstätten gekannt hatten, bevor sie geschlossen wurden. Ihr kollektiver Einfluss sollte sich bald zu einer nahezu unverwüstlichen mündlichen Überlieferungstradition verfestigen.
Der Einfluss Wiens kann dabei kaum überschätzt werden. Im Jahr 1736 vertrieb Österreich die Franko-Piemonteser aus Cremona. 1738 annektierte es Parma und dominierte Norditalien – zumindest bis zur Schaffung eines italienischen Königreichs mehr als ein Jahrhundert später – in derselben Weise wie vorher Spanien. Lokale Gesichtspunkte waren ebenfalls wichtig. Als die legendären Läden geschlossen wurden, die Bestände zurückgingen und die lokale Wirtschaft sich verschlechterte, sahen Spieler und Lehrer ihre Chance. Es waren die Violinen, die die Stadt Cremona auf die Landkarte gebracht hatten, und Besucher, die von so weit her wie England kamen, waren begierig, sie in die Finger zu bekommen. Was lag da näher als eine zweite Karriere als Berater, Gutachter oder Bevollmächtigter? Und wer war für ein Produkt, das so »begehrt war wie Brot«, besser geeignet als der zunehmend klamme Paolo Stradivari, jüngster Sohn des großen Antonio, und sein gleichermaßen klammer Sohn Antonio II.?94
Paolo, der 1771 63 Jahre alt und Teilhaber in einem zwar gut gelegenen, aber zunehmend unsicheren Textiliengeschäft war, fand diese Anreize unwiderstehlich. Seine Kunden, darunter die österreichische Armee und der örtliche Landadel, bezahlten ihre Rechnungen entweder spät oder gar nicht; er war bereits gebrechlich, bekam keine Kredite mehr, und unter seinen Kindern waren ein Mönch, eine Nonne und eine weitere Tochter, deren Mitgift von 12.000 Lire zur Hälfte in den Familienbetrieb investiert worden war. Die Auflösung aller Vermögenswerte bis hin zur Werkstatt seines Vaters muss ihm als letzte Hoffnung erschienen sein. Die Anreize waren aber ebenso für Antonio II., Paolos zweiten, 1738 geborenen Sohn, verlockend, der bis zu seinem Tod im Jahr 1789 sechs Kinder zeugte. Es ist nicht bekannt, dass er im Alter von 33 Jahren einen Beruf ausübte. Ein Zusatz zu Paolos Testament schloss ihn als Erbe sowohl aus dem Familienunternehmen als auch aus dem Nachlass seines Vaters und der Wohnung in einem Haus aus, das einmal seinem Großvater gehört hatte und Mieteinnahmen erhoffen ließ. Da die Werkstatt sechs bis acht Jahre nach dem Tod von Stradivari weiterbetrieben wurde, gab es dort wahrscheinlich noch Inventar, das verkauft werden konnte. Der vergleichsweise unregulierte Zustand des Berufs erlaubte es Geigenbauern, die ein Geschäft besaßen, nicht nur ihre eigenen |172| Arbeiten, sondern auch die Produkte anderer Geigenbauer unter einer Hausmarke zu verkaufen, deren Fortbestand für die Dauer der Existenz der Werkstatt gesetzlich gewährleistet war. Santoro vermutet, dass beide Bedingungen den Handel mit unverkauften und unfertigen Strads nach Mustern von Antonio (von postumen ganz abgesehen) begünstigten. Cozio, einer der bevorzugten Adressaten für Angebote aus ganz Europa, stellte seit spätestens 1750 einen Anstieg bei legalen und illegalen Amati- und Stradivari-Kopien fest.95 Mehr als drei Jahrzehnte später waren es sein Wunsch nach echten Strads und seine zufällige Verbindung zu dem alternden Paolo, die den Weg zum modernen Markt ebneten.
Um 1772 verhandelte Paolo über den Verkauf des Quintetts, das sein Vater einst Spaniens König Felipe V. persönlich hatte vorstellen wollen. Erhaltene Dokumente belegen die Genehmigung zur Bezahlung in spanischer Währung für das verzierte Quintett plus zwei Stradivari-Geigen, verbürgen die Echtheit der Instrumente, bestätigen die Vermittlungsleistungen durch einen Bruder Domenico und einen Bruder Francesco aus Madrid und bestätigen den 24-jährigen Prinz Carlos als Endnutzer.96 Der jugendliche Graf Cozio machte inzwischen Paolo wie ein ehrgeiziger Almaviva mit Hilfe mehrerer Figaros den Hof. Zu den Figaros zählten Giovanni Anselmi, ein Turiner Kurzwarenhändler und Cozios bevorzugter Mitarbeiter und Vermittler; die geigenbauenden Mantegazzas aus Mailand; Guadagnini, der denkbar beste technische Ratgeber und Francesco Diana (»Spagnoletto«), Cremonas amtierender Virtuose. Unter der Voraussetzung, dass sie echt waren, wollte er alle Strads und Amatis haben, die er nur bekommen konnte, teilweise um ihrer selbst willen, teilweise, um sie nachzubauen und bis hin nach Wien und London anzubieten.97 Es sollten allerdings mehr als 200 Jahre ins Land gehen, bevor die großzügigen Dimensionen seines Geschäftsmodells vollständig erkannt wurden.98 Die Verhandlungen mit Paolo gingen bis zu dessen Tod im Jahr 1775 weiter und wurden dann mit Antonio II. fortgesetzt. 1801 gab es sogar eine kurze Wiederauflage, da die Nachricht, dass Antonio seit zwölf Jahren verstorben war, Cozio nicht erreicht hatte.99
In der Korrespondenz von Paolo ist vage von fast 100 unverkauften Instrumenten die Rede, darunter einige Bratschen und Celli, die sich immer noch in Paolos Gewahrsam befanden. Santoro hält diese Zahl allerdings für völlig überhöht. Am Ende bekam Cozio wohl zehn bis zwölf Geigen, möglicherweise einschließlich der Strad von 1716, die Vuillaumes Schwiegersohn Alard später die »Messias« nennen würde.100 Verständlicherweise verteidigte Paolo die Urheberschaft seines Vaters. Als er aber aufgefordert wurde, eine eidesstattliche Erklärung vorzulegen, umging er eine notarielle Beglaubigung der Echtheit, indem er erklärte, nur Instrumente seines Vaters und seines Halbbruders Francesco zu verkaufen.101 Antonio II., der beim Tod seines Großvaters noch nicht einmal geboren und erst sieben Jahre alt war, als die Werkstatt für immer schloss, wurde ebenfalls befragt, doch war er kaum dazu qualifiziert, ihre Echtheit zu verbürgen.
|173| Landgüter müssen verwaltet werden. Österreichische Reformen, gefolgt von der österreichischen Reaktion, erschwerten diese Aufgabe noch. Im Jahr 1796 stürzten sich französische Truppen erneut auf Norditalien, diesmal in revolutionärem Rot-Weiß-Blau geschmückt und von einem General angeführt, der seinen hungrigen Soldaten versicherte, sie in »die fruchtbarsten Ebenen der Welt« zu führen, wo sie nichts als Ehre, Ruhm und Reichtum erlangen würden.102 Cozio arrangierte klugerweise, dass seine Instrumente bei Carlo Carli, einem Mailänder Freund, Bankier und Amateurmusiker, verbleiben konnten. Eine Generation später scheint sich seine jugendliche Leidenschaft auf ein bleibendes Interesse abgekühlt zu haben. Mit der Hilfe eines Angestellten und dessen Tochter begann er 1819, die Notizen und Korrespondenzen zum Cremoneser Geigenbau zu sortieren, die 150 Jahre später wie der Stein von Rosetta geprüft werden sollten.103 Doch das zu diesem Komplex geplante Handbuch erschien nie, obwohl Cozio 85 Jahre alt wurde.104
Aus dem Plan, zur Wiederbelebung des Ruhmes der Stadt die vollständige Sammlung an reiche Cremoneser zu verkaufen, wurde nichts,105 vermutlich, weil es sie, ähnlich wie die großen Cremoneser Geigenbauer, nicht mehr gab. Stattdessen wurde Carli autorisiert, die Sammlung nach und nach aufzulösen. Im Sommer 1817 kaufte Paganini eine Strad von 1724; möglicherweise spielte er sie ein Jahr später in Cremona.106 Im Jahr 1824 tauchte am Beginn seiner eigenen bemerkenswerten Karriere Tarisio auf und blieb ein treuer Kunde, solange es etwas zu kaufen und weiterzuverkaufen gab. Enrico Ceruti, ein damaliger Cremoneser Geigenbauer, suchte gemeinsam mit einer Handvoll von Orchestermusikern aus Cremona hinter jedem Busch nach alten Violinen. Sie nahmen alles, dessen sie nur habhaft werden konnten, und dominierten den lokalen Markt bis mindestens 1870.107
Das Geheimnis von Tarisios Erfolg scheint eine seltene Mischung aus kaufmännischem Genie und selbst erworbenem Wissen gewesen zu sein, die offenbar von einer derart intensiven und zielstrebigen Leidenschaft gespeist wurde, dass für alles andere kein Platz blieb. Zeitgenossen, die an einem Ende eines großen Raumes Instrumente hochhielten, beobachteten ehrfürchtig, wie Tarisio diese vom anderen Ende des Raumes aus identifizierte, obwohl es Jahrzehnte her war, dass er sie zuletzt gesehen hatte. »Die ganze Seele des Mannes gehörte den Geigen«, berichtet Reade bewundernd.108 Tarisio wurde ein halbes Jahrhundert nach dem Niedergang von Cremona vermutlich zum Zimmermann ausgebildet und brachte sich das Geigenspiel selber bei. Seine frühen Jahre verbrachte er offenbar als Wandergeselle in Norditalien, reparierte Möbel, spielte als Bezahlung für eine Übernachtung mit Frühstück auf der Geige und arbeitete sich bis zum Neulackierer der Instrumente von Wandergesellen hoch. Diese Instrumente tauschte er dann mit Dorfbewohnern und Landpfarrern gegen deren alte, die diese für wertlos hielten, und restaurierte sie in seinem |174| Dachzimmer im vierten Stock eines heruntergekommenen Mailänder Hotels mit dem unwahrscheinlichen Namen »Hôtel des Delices«. Doch wie auch immer er sein Geschäft erlernt hatte: Als er mit Mitte 30 bei Carli auftauchte, verstand er etwas davon. Offenbar machte er auch einen glaubwürdigen Eindruck, denn es war nur schwer vorstellbar, dass Cozio oder sein Stellvertreter jemandem, den der Pariser Händler Etienne Vatelot später als einen »kleinen Geizhals auf der Suche nach was auch immer« bezeichnete, die Tür geöffnet oder gar eine Geige verkauft hätten.109
Der Wendepunkt war dem Vernehmen nach ein zufälliges Gespräch in Mailand mit einem Verkäufer und Sammlerkollegen, der vor Kurzem aus Paris zurückgekehrt war, von dort berichtete, dass alte italienische Instrumente sowohl selten als auch sehr gesucht seien, und fragte, ob Tarisio nicht ebenfalls hinfahren möchte, um den Pariser Händlern einiges von dem, was er hatte, zu zeigen. Tarisio, von der Idee begeistert, machte sich mit sechs Violinen auf den Weg. Wie üblich reiste er zu Fuß, spielte in Gasthäusern und Tavernen und schlief in Scheunen. Es dauerte einen Monat, bevor er das Haus des Geigenbauers und -händlers Jean-François Aldric, seines ersten Interessenten, erreichte. Geld und Instrumente wechselten ihre Besitzer, doch Tarisio war von den Preisen enttäuscht. Hart vermutete, dass er erst noch lernen musste, selbst für eine Nachfrage zu sorgen.110 Als Tarisio das nächste Mal in Paris erschien, legte er Wert darauf, in einer Kutsche vorzufahren und anständig gekleidet zu sein. Er machte auch den Konkurrenten von Aldric (einschließlich Thibaud, Chanot und Vuillaume) seine Aufwartung. Von da an stieg die Preiskurve erfreulich nach oben. Mit einem Hilfstrupp von lokalen Vermittlern, die auf Provisionsbasis arbeiteten, durchkämmte er das Piemont und die nördliche Toskana nach allem, was er nach Paris und später nach London bringen konnte. Über die nächsten 30 Jahre sollte die Gesamtsumme allein für verkaufte Geigen bei mehr als 1 000 liegen.111
Tarisios Strategie zur Umgehung von Einfuhrzöllen war ebenso einfach wie effektiv. Vor einem Grenzübertritt montierte er Saiten, Wirbel, Stege und Griffbretter ab und stopfte die zerlegten Instrumente in Taschen. Bei der Ankunft in Paris suchte er sich ein Hotel wie das in Mailand, wo er sich für zwei Tage verkriechen konnte, um die Instrumente wieder zusammenzusetzen. Dann nahm er Kontakt mit seinen Kunden auf, die buchstäblich nicht genug bekommen konnten. Vuillaumes Ruf als Virtuose der Holzbearbeitung scheint eindeutig mit Tarisio in Verbindung zu stehen, der ihm regelmäßig Anlässe bot, seine Kunst zu perfektionieren. Laut Morel war eine Strad-Viola einmal so stark beschädigt, dass Vuillaume den Boden ersetzen musste. Eine Wertsteigerung durch Etiketten von einem anderen Luthier scheint eine weitere von Tarisios Dienstleistungen gewesen zu sein.112
Obwohl das Ende der Fahnenstange immer greifbarer wurde, reiste Tarisio weiterhin etwa alle sechs Monate nach Paris. Ein Jahr vor seinem Tod |175| 1854 räumte er selber ein, mit »Gemüse« zu handeln, und Chanot merkte in einem Brief an seinen Sohn Adolphe an, dass mindestens zwei der wichtigsten Pariser Händler – darunter Thibout, der Geigenbauer der Opéra und des ehemaligen Königs Louis Philippe – seine Instrumente nicht mehr in Kommission nahmen. Trotzdem war Tarisio noch für eine letzte Überraschung gut. Im Januar 1855 erfuhr Vuillaume von einem durchreisenden Mailänder Seidenhändler, dass Tarisio gestorben sei. Er nahm stillschweigend seine Koffer und 100.000 Francs und machte sich mit der höchsten Geschwindigkeit, die eine Kutsche in einem transalpinen Winter aufbringen konnte, auf den Weg zum Hôtel des Delices. Bei seiner Ankunft in Mailand vier Tage später bestätigten ihm die Nachbarn, dass Tarisio seit Tagen nicht mehr gesehen worden war.
Jean-Baptiste Vuillaume, Geigenbauer und Händler, Paris, Mitte des 19. Jahrhunderts
Sonderlich glaubhaft ist die Geschichte allerdings nicht. Wenn Vuillaume vier Tage für seine Reise brauchte, so galt das ebenso für seinen Seidenhändler-Informanten. Seit Tarisios Tod mussten also mindestens acht Tage vergangen sein. Wenn dem Seidenhändler Tarisios Ableben bekannt war, ist es seltsam, dass niemand sonst davon wusste. Doch nach Vuillaume – wie so oft die einzige Quelle – war in der Zwischenzeit nichts geschehen. Auf jeden Fall wurde die Polizei gerufen, die Tür aufgebrochen und – wiederum nach Vuillaume – |176| Tarisio im Bett gefunden, gestorben an einem Herzinfarkt und mit einer Geige in seinen Armen. Vuillaume, entschlossen wie stets, ergriff die Initiative. Er stellte sich als Geschäftspartner vor, und es wurde ihm gestattet, sich um alles zu kümmern. Das Zimmer war ein einziges Durcheinander aus einem Berg von Instrumenten, unter dem sich ein Bass von Gaspar da Salò und eine Reihe von Stradivari-Geigen befanden. Eine von ihnen lag in der untersten Schublade einer klapprigen Kommode: Es war die »Messias«, die Vuillaume zeit seines Lebens behielt. Neben ihr lag die del Gesù, die später nach seinem Schwiegersohn Delphin Alard benannt wurde.113
Der nächste Schritt für Vuillaume war es, sich eine Option auf den Rest zu sichern. Von Tarisios Schwester begleitet, ging Vuillaume auf den Bauernhof, auf dem Tarisio zehn Jahre zuvor ihre Söhne untergebracht hatte – »seine tölpelhaften Neffen«, um Chanot zu zitieren. Nach der offiziellen Lesart hatten sie keine Ahnung von dem, was sie für das Gerümpel ihres Onkels hielten, waren an schnellem Geld interessiert und gaben sich schnell mit einem Verkaufspreis von 80.000 Francs zufrieden – und das in einer Epoche, in der man für 2.000 bis 2.500 Francs eine Strad bekommen konnte. Chanot, der sowohl etwas von Bauern als auch von Violinen verstand, schätzte die gesamte Hinterlassenschaft einschließlich des gesamten Besitzes, Bargeld und Liegenschaften sowie Instrumenten auf rund 140.000 Francs.114 Es war in jedem Fall ausreichend, um Tarisio, dem Jungen vom Lande aus Fontanetto d’Agogna, das Recht auf eine Nische in der Ruhmeshalle der Geigenhändler zu sichern. Inzwischen kehrte Vuillaume, der Junge vom Lande aus Mirecourt, der sich ihm später in der Ruhmeshalle der Geigenhändler zugesellen würde, mit 144 bis 246 Instrumenten – darunter nicht weniger als 24 Strads – nach Hause zurück.115
Sein Abenteuer, das mit einem Gewinn belohnt wurde, der in Vergangenheit und Gegenwart ohne Beispiel war, sorgte dafür, dass sogar ein so qualifizierter und geschäftstüchtiger Konkurrent wie sein alter Freund und Landsmann aus Mirecourt – Chanot – nur noch die zweite Geige spielte. Milliot berichtet, dass Chanot selbst eine Gänsehaut bekam, als Nicholas Vuillaume seinen großen Bruder mitbrachte, um eine Guarneri und eine Stradivari zu inspizieren, die Chanot ihm verkaufen wollte, wohl wissend, dass J.-B. »bis auf das, was er selbst verkaufte, nichts perfekt fand«. Vuillaume, so erinnerte sich Chanot, sah sich die Instrumente durch seine Brille sehr genau an und ließ nichts verlauten, was den Handel hätte verderben können. Die drei Herren gingen dann zum Abendessen – auch ein halbes Jahrhundert später bei großen Geigenverkäufen immer noch ein üblicher Brauch –, und Nicholas kehrte beglückt nach Brüssel zurück. Chanot war über die 3.500 Francs für den Verkauf ebenfalls beglückt, doch er war auch sichtlich erleichtert, dass sein Fachwissen der Musterung durch »seinen Kollegen, der zugleich sein Freund war«, standgehalten hatte.116
|177| Der Handel hatte allen Grund, sich an einen Vuillaume zu erinnern, der in jeder Hinsicht mit den Superstars und Professoren der Konservatorien, die sein Geschäft immer noch stürmten, mithalten konnte. Flankiert von Gallionsfiguren wie Beare und Morel erinnerte der alte Löwe Vatelot auf der Hundertjahrfeier an ihn als einen Mann, der »zuweilen mit einer leicht ironisch angehauchten Fröhlichkeit« aufmerksam zuhörte, die »etwas unterwürfige Gefälligkeit, die viele Händler im Gespräch mit ihren Kunden zeigen«, vermied und die Kunden dazu brachte, Dinge über sich selbst zu erzählen, ohne dass er selber etwas von sich preisgab. Dennoch verließen sie ihn glücklich und zufrieden.117
Ein gutes Beispiel hierfür bietet Achille Paganini. Er entstammte der kurzlebigen Verbindung seines Vaters mit Antonia Bianchi, einer venezianischen Opernsängerin, und war 15 Jahre alt, als sein Vater starb und ihm als einzigem Erben ein Vermögen von geschätzten zwei Millionen Francs hinterließ. Unter den Aktiva waren Schmuck, Möbel, ein Titel als Baron, ein Berg von Briefen, ein Stapel von Musikautografen, eine feine Instrumentensammlung (von der das Stradivari-Quartett nur ein Teil war) sowie die Adresse von Vuillaume. Sechs Jahre später entschied er sich, Letzteren darum zu bitten, das Quartett zu verkaufen, das später seinen Weg nach New York, Washington, Iowa City und schließlich in japanischem Besitz zurück nach New York fand. Die Verkaufsverhandlungen zeigten einen Meister der Branche in Bestform. Sie zogen sich über fünf Jahre hin, und es sollten fünf weitere vergehen, bevor das letzte Instrument endlich verkauft war. Der Verkaufsprozess begann im Spätherbst 1846. Achille, der das Quartett offenbar zu Reparaturzwecken bei Vuillaume gelassen hatte, schrieb ihm von seinem Haus in Genua aus und schlug einen Zielpreis von 20.000 Francs mit einer Händlerprovision von 15 Prozent vor. Vuillaume antwortete, dass der Preis angesichts des Zustands der Instrumente recht hoch sei, er aber sein Möglichstes getan habe, um sie wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Er legte eine Rechnung über 160 Francs für die Reparaturen bei, versicherte, mögliche Angebote an Achille weiterzuleiten, und bat ihn um eine Ermächtigung, Anzeigen in den großen Zeitungen aufzugeben.
Von Achilles Preisvorstellung war nie wieder die Rede. Etwa drei Jahre später war das Quartett immer noch nicht verkauft. Stattdessen – und dies konnte nur auf einer Anfrage von Achille beruhen – berichtete Vuillaume ihm, dass er für ihn nicht nur einen erstklassigen Akkordeon-Techniker gefunden, sondern in einem wunderbaren Kauf auch ein Vier-Oktaven-Klavier für 200 Francs erworben habe, das er im Begriff war, über Marseille an ihn zu verschiffen. Sechs Wochen später – offenbar ein zusätzlicher Kundenservice – kündigte er den Versand von 12,5 Metern Seidenmaterial zu 168,75 Francs sowie eines Mantels aus Samt, Seide und Wollspitze zu 150 Francs an. Die Instrumente waren immer noch nicht verkauft.
|178| Im Dezember 1850 – über vier Jahre nach Beginn der Verhandlungen – lieferte Vuillaume einen weiteren Beweis seiner Kundenfreundlichkeit. Er hatte mit dem Herausgeber der Paganini-Biografie von Fétis, Schonenberger, gesprochen der bereit war, 6.000 Francs für eine Reihe unveröffentlichter Kompositionen von Paganini zu bezahlen. Achille indes wollte 10.000. Vuillaume schlug vor, dass sich Achille und Schonenberger die Differenz teilten, und fügte hinzu, dass er auf dem Weg zur Weltausstellung in London war, auf der er Achilles Quartett anbieten wollte. Doch 20.000 Francs waren eine Menge Geld, und – verkauft oder nicht – Großbritannien erhob 15 Prozent Zoll auf eingeführte Geigen. Er riet Achille erneut, seinen Preis zu senken.
Drei Monate später, als die Handschriften für 6.750 Francs verkauft worden waren und Achille den Preis für das Quartett auf 14.000 reduziert hatte, gab es offenbar schon ein Angebot über 12.000 Francs. Vuillaume schlug vor, es anzunehmen und auf seine Kommission und die für Anzeigen und Reparaturen bereits ausgegeben 232 Francs zu verzichten. Alternativ dazu könne ihn Achille als der Eigentümer des Quartetts nach London begleiten und so beim Zoll Kosten sparen. Als Achille dies ablehnte, standen sie erneut vor der Frage, wie sie die Instrumente deklarieren sollten. Vuillaume warnte, dass, wenn die Instrumente so gut wären, wie Achille glaubte, er sie schon vor Jahren einzeln zu Achilles Preis verkauft haben würde. Aber nur die Bratsche war erstklassig. Das Cello hatte zumindest Seltenheitswert. Die Geigen waren in Ordnung, doch fehlte ihnen die »Pracht des Lackes und der Adel des Holzes«, für die die Kenner zahlten. Als er erneut aus London schrieb, bedauerte Vuillaume abermals, dass Achille sich geweigert hatte mitzukommen. Zwei Händler zeigten zwar Interesse, boten aber weit unter Achilles Preis. Er bat um einen Rat. Der weitere Ablauf kann aus einem Liefervertrag vom 10. September 1851 abgeleitet werden. Achille erlaubte Vuillaume, die Instrumente einzeln zu verkaufen – für jeweils 2.500 Francs für die Violinen und die Viola sowie 5.000 für das Cello. Ein oder zwei Jahre später verkaufte Vuillaume die Violinen an interessierte französische Amateure weiter. Obwohl keine Preise genannt werden, ist es schwer vorstellbar, dass er dabei einen Verlust machte. Im Jahr 1856, so sagt Lebet, ging das Cello für 6.000 Francs an einen deutschen Amateur, und die Viola – Teil eines Gesamtverkaufs von 9.000 Francs, in dem das Piatti-Strad-Cello von 1736 und eine Vuillaume-Violine enthalten waren – an einen englischen Amateur.118 Auch hier bleibt die Marge unbekannt, doch es kann von einem respektablen Gewinn ausgegangen werden.
Die Karriere von Chanot war ein Gegenpol zu denen seiner alten Freunde und Konkurrenten. Er war mit denselben eher bäuerlichen Tugenden wie gesunder Menschenverstand, Geduld, Arbeitsmoral und Sparsamkeit ausgestattet, pflegte den Kontakt zu gutsituierten Amateuren, entwickelte seine eigenen besonderen Beziehungen zur Diaspora der französischen Geigenbauer |179| und brachte seine Söhne in Londoner Geschäften unter. Wenn Vuillaume ihn necken wollte und ihn aufforderte, einmal in seinem Geschäft vorbeizukommen – nach Milliot eine verschlüsselte Aufforderung »zu sehen, was ich gerade von Tarisio bekommen habe« –, konnte Chanot durchaus gleichziehen. Bei einer Auktion in Douai trieb er mit seinen Geboten den Preis für ein Instrument dramatisch in die Höhe und stieg dann aus, sodass Vuillaume den überhöhten Preis zahlen musste.119 Dennoch standen gegenseitige Höflichkeit und Respekt nie zur Disposition, und Vuillaume stellte die Frage: »Wer wird etwas von alten italienischen Instrumenten verstehen, wenn Chanot und ich nicht mehr leben?«120
Ebenso wie Vuillaume entschied sich Chanot für die obere Preislage des Handels. »Glaub mir«, riet er seinem Sohn Adolphe, »außer mit dem Alten und Schönen ist in diesem Geschäft kein Geld zu machen.« Er schlug drei Leitlinien vor. Die erste Regel war, das Netz weit zu spannen – zum Beispiel durch Aufträge und Kontakte in London. Die zweite Regel war, ein Inventar und eine Reserve an guter Ware anzulegen, auch wenn sie teuer war und vielleicht Zeit brauchte, um verkauft werden zu können. Die dritte Regel war, den Markt zu beobachten und kennenzulernen – im Klartext: Folge den Strads. Ein Londoner Kollege sagte im Jahr 1852 zu Chanot, dass die lokalen Sammler italienische Geigen bevorzugten. Die meisten davon befanden sich nun in England. Wo so viele echte verfügbar waren, gab es wenig Anlass, über Kopien nachzudenken.121