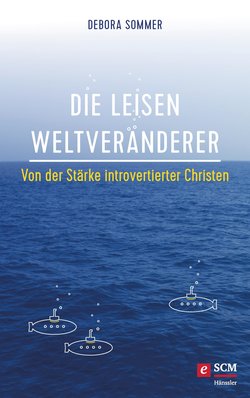Читать книгу Die leisen Weltveränderer - Debora Sommer - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
VORWORT
November 2011. Entspannt liege ich neben meinem Ehemann auf einer bequemen Liege an einem Swimmingpool in Eilat/Israel. Zum gefühlt hundertsten Mal trällert Sting aus dem Lautsprecher: I’m an alien. I’m a legal alien. I’m an Englishman in New York. Zu Deutsch: Ich bin ein Fremder. Ich bin ein rechtmäßiger Fremder. Ich bin ein Engländer in New York. Ich atme tief durch. Ich mag dieses Lied. Es bringt ein Lebensgefühl zum Ausdruck, das mir vertraut ist – auch wenn ich keine Engländerin bin. Nämlich das Gefühl, sich fremd zu fühlen. Und damit meine ich nicht das Fremdsein jenes Augenblicks, das durchaus nachvollziehbar gewesen wäre für eine Touristin im Ausland. Ich meine vielmehr das eigenartige Gefühl des Fremdseins in der Heimat. In einem vertrauten Umfeld. Unter Menschen, deren Sprache ich spreche.
Sich fremd fühlen in der Heimat
Anders als Sting, in dessen Lied unüberhörbar Nationalstolz mitschwingt, fühlte ich mich lange Zeit vielmehr verwirrt und einsam als stolz. Verwirrt von meinen eigenen Empfindungen und unsicher, ob es auch andere gibt, die so empfinden wie ich. Jahrelang hatte ich keine Ahnung, zu welchem »fremden Volk« ich denn gehöre und worin dieses Gefühl des Fremdseins gründet. Heute weiß ich, dass ich zum »Volk der Introvertierten« gehöre. Und zwar zur extremen Sorte. Den stillen Beobachtern (die nicht unbedingt auf den ersten Blick als solche zu erkennen sind und die gelegentlich sogar extrovertiert scheinen mögen). Solchen, die sich tief in ihrem Innersten vorstellen könnten, den Rest ihres Lebens – oder zumindest einen großen Teil davon – in der Einsamkeit zu verbringen. In einem abgelegenen Kloster, einem Häuschen am Meer, der Idylle eines gemütlichen Apartments mit inspirierender Aussicht auf See und Berge. Umgeben von Büchern, mit Blick auf die endlose Weite und unberührte Natur oder auch als geheime Beobachter der Geschäftigkeit anderer Menschen. Die friedvolle Stille einer Umgebung, speziell das Glitzern und Plätschern von Wasser, übt eine unglaublich beruhigende Wirkung auf mich aus. Ansonsten bräuchte ich keinerlei Ablenkung, Betrieb oder Unterhaltung. Denn die Welt in mir ist so laut, bunt und intensiv, dass meistens Hochbetrieb in mir herrscht.
Andererseits sträubt sich etwas in mir gegen ein Einsiedlerleben jener Art. Insbesondere die Tatsache, dass ich sehnsüchtig verbunden bin mit Menschen, die mir kostbar sind: mit meinem Ehemann, meinen Kindern, meinen Eltern, meiner Schwester und ihrer Familie, Verwandten, meinen Freunden … Ich bin reich beschenkt durch sie. Und möchte an ihrem Leben teilhaben – selbst wenn es mich oft herausfordert und manchmal auch überfordert. Ich möchte an der Begegnung mit meinen Mitmenschen reifen und ihnen auch einen Teil von mir schenken. Ich habe einen Auftrag, der zu Berührungspunkten mit anderen Menschen führt. Das große Bedürfnis nach Rückzug und Einsamkeit auf der einen Seite und der Dienst mit und unter Menschen auf der anderen Seite sind und bleiben jedoch ein großes Spannungsfeld.
Sich fremd fühlen in der geistlichen Heimat
Als besonders beklemmend erlebe ich es, wenn mich das Gefühl des Fremdseins in meiner »geistlichen Heimat« (wie man in frommen Kreisen so schön sagt) beschleicht. Damit meine ich die christliche Gemeinschaft, der ich angehöre, in meinem Fall eine Schweizer Freikirche. »Geistliche Heimat« steht dabei nicht selten austauschbar für die wirklichkeitsferne Vorstellung einer geistlichen Großfamilie, in der »Glaubensgeschwister« – allen Unterschieden und Meinungsverschiedenheiten zum Trotz – harmonisch miteinander umgehen. Ich frage mich: Wie sollte in einer »geistlichen Familie« dieser Dimension automatisch funktionieren, was selbst in der eigenen Familie ein intensives Übungsfeld für alle Beteiligten darstellt? Das Gefühl der Fremdheit im Kontext der christlichen Kirche rührt nicht zuletzt daher, dass Gemeinschaft als einer der wichtigsten Werte deklariert wird. Doch was ist, wenn mir Gemeinschaft schwerfällt? Wenn mich die Begegnung mit anderen Menschen unglaublich viel Kraft kostet? Wenn ich mich unsicher und unwohl fühle unter vielen Menschen, selbst wenn sie mir mehrheitlich vertraut sind? Wenn es mich überfordert, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen? Macht mich dies zu einem ungeistlichen Menschen? Stimmt etwas nicht mit mir?
Während ich an anderen ihre ausgeprägte Gabe und Fähigkeit, Gemeinschaft und Gastfreundschaft zu leben, bewundere, fällt der Blick auf meinen eigenen Beitrag in dieser Hinsicht äußerst ernüchternd aus. Gaben wie Kontaktfähigkeit und Gastfreundschaft, die prototypmäßig als Markenzeichen einer frommen Christin gelten, scheinen in meinem Fall irgendwie vergessen worden zu sein. Auf unangenehme Weise fühle ich mich mit diesen (von mir so empfundenen) Defiziten nicht der christlichen Norm entsprechend. Ungenügend qualifiziert, meinen Teil zur Gemeinschaft beizutragen. Es kostet mich große Anstrengung und sehr viel Überwindung, überhaupt auf andere Menschen zuzugehen. Menschen einzuladen und zu bewirten, würde ich je nach Verfassung manchmal nicht ungerne. Aber ehrlich gesagt fühle ich mich ziemlich überfordert damit. Andere Menschen mögen mein Verhalten als distanziert deuten, vielleicht sogar als arrogant. Im Grunde genommen sind es Hilflosigkeit und Ausdruck einer Begrenzung, mit der ich lebe und an der ich oft auch leide. Andere Introvertierte erleben diese Begrenzung anders und empfinden Gastfreundschaft in einem überschaubaren Rahmen als durchaus angenehm und erstrebenswert.
Dafür habe ich andere Begabungen. Die Leidenschaft des Forschens, des Schreibens, des Lehrens, des Musizierens. Lange Zeit hat sich mir die Frage aufgedrängt: Sind diese Begabungen für eine christliche Gemeinschaft denn überhaupt von Bedeutung? Anderen introvertierten Christen mit anderen Gaben mag es ähnlich gehen.
Dieser innere Konflikt introvertierter Christen kann sich auch in weiteren Fragen äußern. Zum Beispiel: Brauche ich die christliche Gemeinschaft überhaupt? Es kostet so viel Kraft und ist auch oft mit Enttäuschungen verbunden, anderen Menschen zu begegnen. Ist es in einem solchen Fall nicht viel sinnvoller, am Sonntag zu Hause zu bleiben und mir in der Geborgenheit meiner eigenen vier Wände eine Radio- oder Fernsehpredigt anzuhören? Weiter stellt sich wiederholt und auf belastende Weise die Frage, wie ich den christlichen Auftrag erfüllen soll, andere Menschen mit dem Evangelium zu erreichen und ihnen die gute Nachricht von Jesus zu erzählen. Dies geschieht über Beziehungen. Doch was ist, wenn mir Beziehungen schwerfallen? Kann ich dem christlichen Auftrag unter solchen Voraussetzungen je gerecht werden?
Neulich in London
April 2017. Gemächlich schlendere ich mit meinem siebzehnjährigen Sohn am Südufer der Themse entlang. Wir genießen die Zweisamkeit und den herrlichen Frühlingstag in London mit allen Sinnen. Plötzlich erregen sanfte Klänge meine Aufmerksamkeit. Sie heben sich vom Stimmengewirr der Straßenkünstler ab und treffen mich mitten ins Herz. Da ist er wieder, jener Song. Englishman in New York. Meisterhaft interpretiert von einem jungen Musiker mit Gitarre. Für einen Bruchteil der Sekunde protestiert mein Verstand gegen die Widersprüchlichkeit der Situation: Ich bin ein Engländer in New York – gesungen in England? Was den Künstler wohl dazu bewegt hat, dieses Lied in sein Repertoire aufzunehmen? Ist er vielleicht gar kein Engländer, sondern ein Ausländer – a legal alien, ein rechtmäßiger Fremder? Hat er – falls er gebürtiger Engländer ist – vielleicht schon mal eine vergleichbare Situation im Ausland erlebt? Oder kennt vielleicht auch er jenes Gefühl, sich in der eigenen Heimat fremd zu fühlen? Energisch gebiete ich meinem inneren Gedankenkarussell Einhalt. Möglicherweise hat sich der Sänger all diese Gedanken gar nicht gemacht, sondern war schlicht und einfach überzeugt von dem Song und seiner positiven Wirkung auf die Passanten.
Während wir am Quai zum Musiker aufschließen, neigt sich der Song bereits dem Ende zu. Die Musik tanzt mit dem Frühlingswind um die Wette und versinkt in der Geräuschkulisse des geschäftigen Aprilmorgens. Gebannt lausche ich den letzten Worten des Liedes: Be yourself no matter what they say. – Sei du selbst, egal was die anderen sagen. Erst als der Straßenmusiker in meine Richtung schaut, fällt mir auf, dass ich die Einzige bin, die stehen geblieben ist. Schnell eile ich meinem Sohn nach, der sich schon wundert, wo ich geblieben bin. Federleichte Klänge und Worte, aber so unfassbar schwer und gewichtig in der Umsetzung …
Nichtsdestotrotz will ich dranbleiben und weiter an mir arbeiten. Ich will mehr und mehr wagen, ich selbst zu sein. Und ich möchte auch andere dazu ermutigen, genau das zu tun. Die Vorstellung davon, was geschehen könnte, wenn ganz viele Introvertierte damit beginnen, ihrer Persönlichkeit entsprechend zu leben und zu handeln (auch und ganz besonders im christlichen Kontext), beflügelt meine Schritte und pulsiert durch die Zeilen dieses Buches.
Debora Sommer, Strengelbach (Schweiz), im Juli 2017